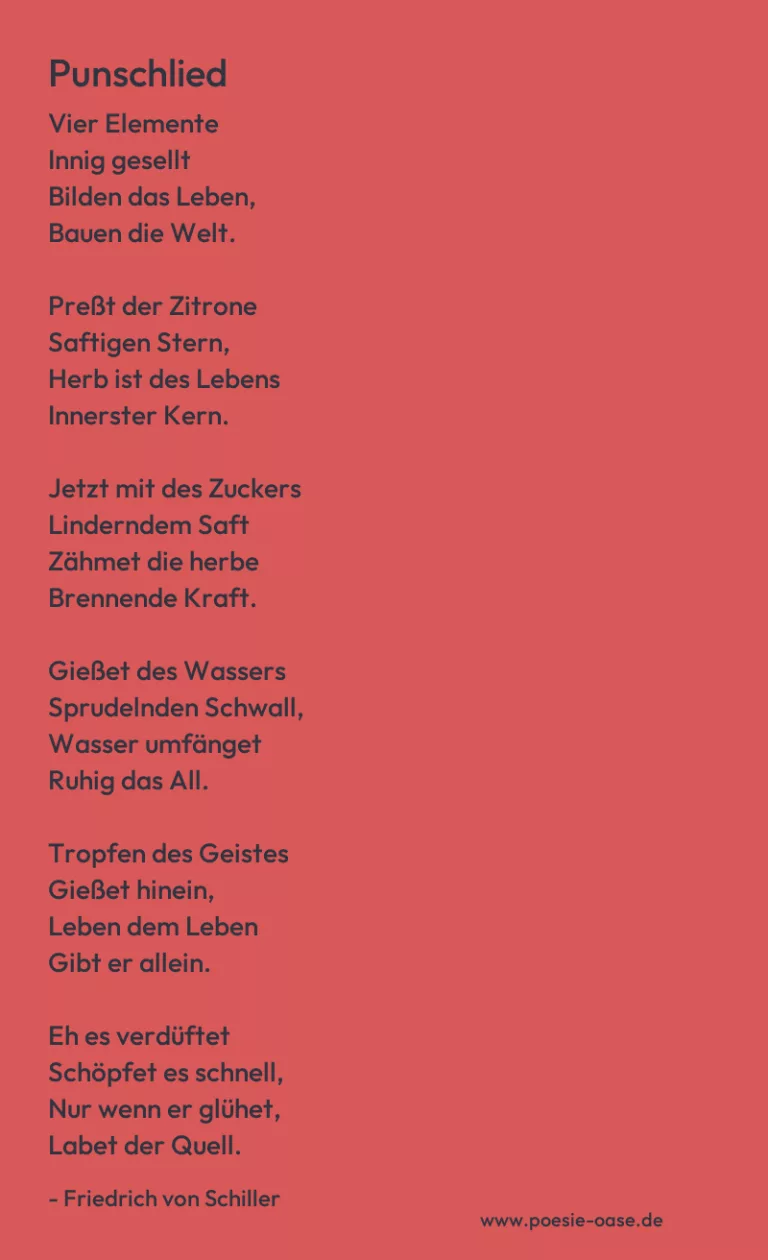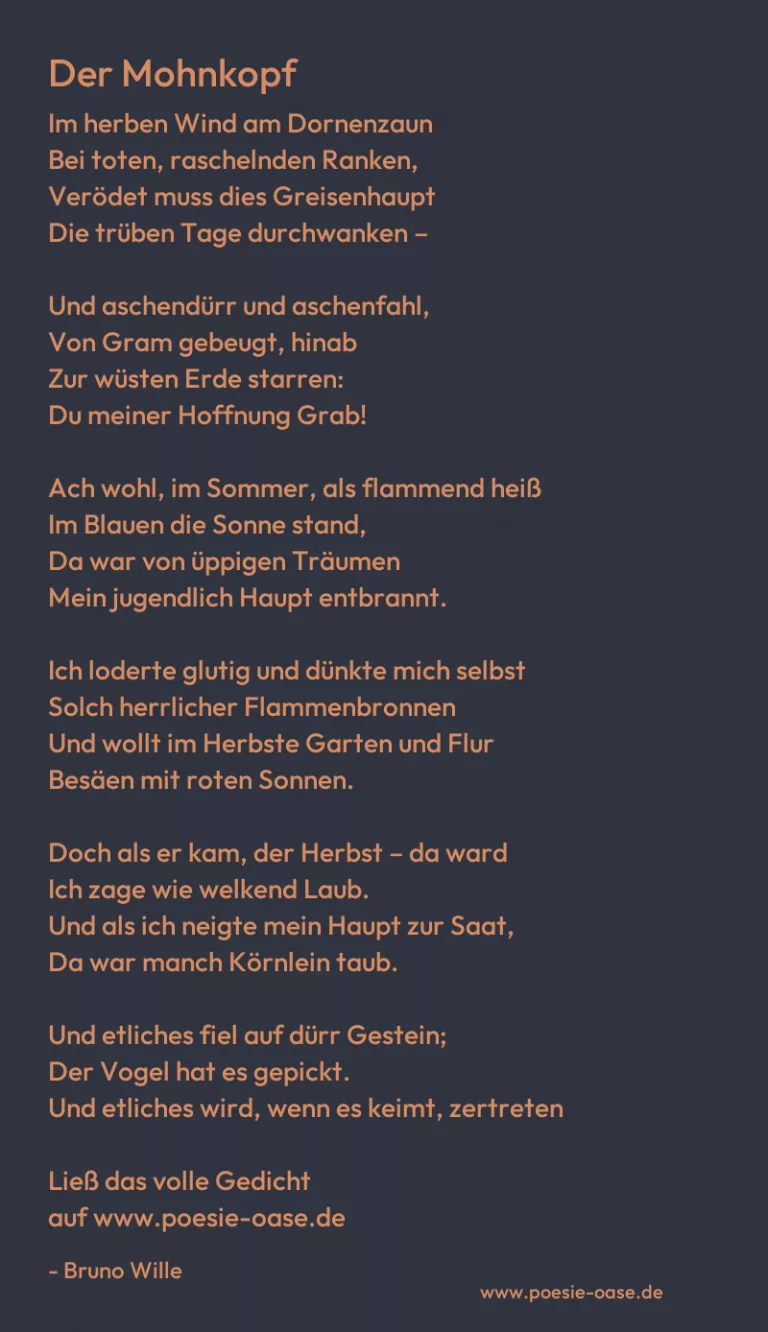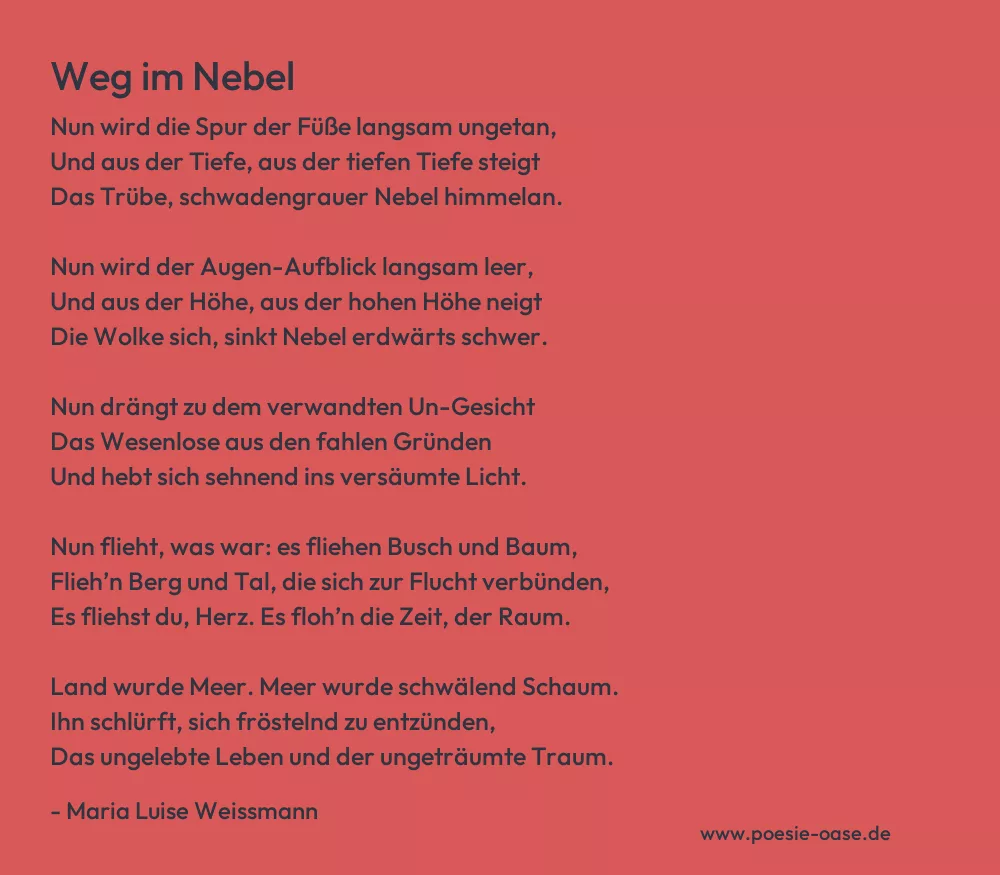Weg im Nebel
Nun wird die Spur der Füße langsam ungetan,
Und aus der Tiefe, aus der tiefen Tiefe steigt
Das Trübe, schwadengrauer Nebel himmelan.
Nun wird der Augen-Aufblick langsam leer,
Und aus der Höhe, aus der hohen Höhe neigt
Die Wolke sich, sinkt Nebel erdwärts schwer.
Nun drängt zu dem verwandten Un-Gesicht
Das Wesenlose aus den fahlen Gründen
Und hebt sich sehnend ins versäumte Licht.
Nun flieht, was war: es fliehen Busch und Baum,
Flieh’n Berg und Tal, die sich zur Flucht verbünden,
Es fliehst du, Herz. Es floh’n die Zeit, der Raum.
Land wurde Meer. Meer wurde schwälend Schaum.
Ihn schlürft, sich fröstelnd zu entzünden,
Das ungelebte Leben und der ungeträumte Traum.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
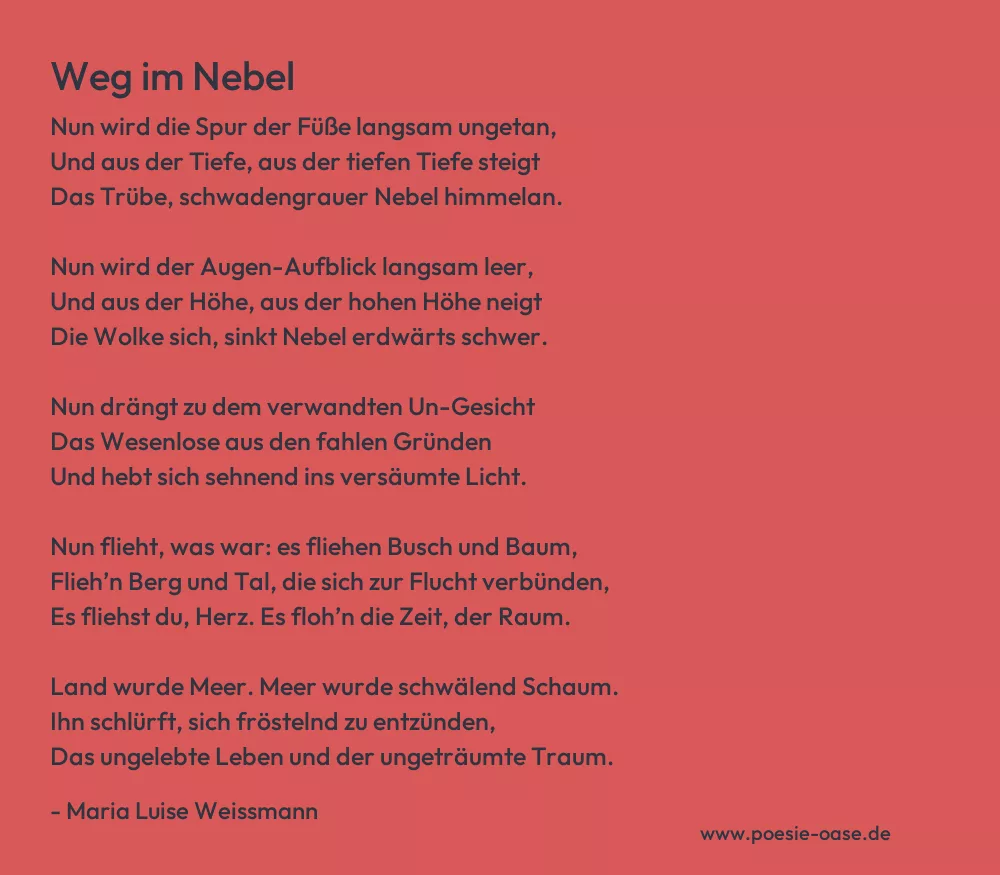
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Weg im Nebel“ von Maria Luise Weissmann beschreibt eine schleichende Auflösung von Orientierung und Sinn, die sich durch den Nebel als zentrales Motiv manifestiert. Zu Beginn des Gedichts wird die „Spur der Füße“ als „langsam ungetan“ beschrieben, was den Verlust der Richtung und des Ziels signalisiert. Der Nebel, der „aus der Tiefe steigt“, symbolisiert die Unklarheit und die zunehmende Verwirrung, die das Subjekt erfasst. Es entsteht der Eindruck, dass die Welt um die Sprecherin herum zunehmend unscharf wird, dass der Blick in die Zukunft und die Erinnerung sich in einem Nebel verlieren.
Die zweite Strophe führt diesen Prozess fort, indem der „Augen-Aufblick“ „langsam leer“ wird. Hier scheint der Verlust der Wahrnehmung und der Klarheit weiter voranzuschreiten. Die Wolke, die sich von „der Höhe“ neigt und der Nebel, der „erdwärts schwer“ sinkt, verstärken das Bild einer Welt, die von oben nach unten, vom geistigen in den materiellen Bereich, immer mehr in ein trübes, ungreifbares Dasein verfließt. Die Spannung zwischen der Höhe und der Erde deutet auf den Konflikt zwischen geistigem Streben und der ernüchternden Realität hin.
In der dritten Strophe taucht das „verwandte Un-Gesicht“ auf, das vom „Wesenlosen“ aus den „fahlen Gründen“ gedrängt wird. Dies könnte eine Metapher für den Verlust der Identität oder die Entfremdung von einem früheren Selbst sein. Das „verwandte Un-Gesicht“ ist ein unbestimmtes, gesichtsloses Etwas, das in das „versäumte Licht“ drängt, was auf eine Sehnsucht nach Klarheit oder Erleuchtung hinweist – jedoch in einer Welt, die immer mehr in den Nebel der Unbestimmtheit eintaucht.
Im letzten Abschnitt fliehen „Busch und Baum, Berg und Tal“ in einem symbolischen Akt der Flucht vor dem Unvermeidlichen, was die Zerstörung oder die Auflösung der natürlichen Welt suggeriert. Die „Zeit“ und der „Raum“ fliehen ebenfalls, was den Verlust von Struktur und Orientierung noch weiter verstärkt. Der dramatische Wandel, dass „Land zu Meer“ und „Meer zu Schaum“ wird, beschreibt den Zerfall und die Auflösung von allem, was zuvor fest und stabil war. Der abschließende Vers – „Das ungelebte Leben und der ungeträumte Traum“ – bringt die tragische Erkenntnis, dass das Leben und die Träume der Sprecherin nicht verwirklicht werden können, dass sie in der Unklarheit und dem Nebel der Entfremdung vergehen.
Insgesamt veranschaulicht das Gedicht den schmerzlichen Verlust von Klarheit und Richtung, den die Sprecherin im Nebel erfährt. Dieser Nebel wird zum Symbol für die Unbeständigkeit des Lebens und die Unmöglichkeit, die eigenen Wünsche und Träume zu verwirklichen. Es entsteht ein Gefühl der Verwirrung und Resignation, das in der Auflösung von Land und Meer, Zeit und Raum kulminiert.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.