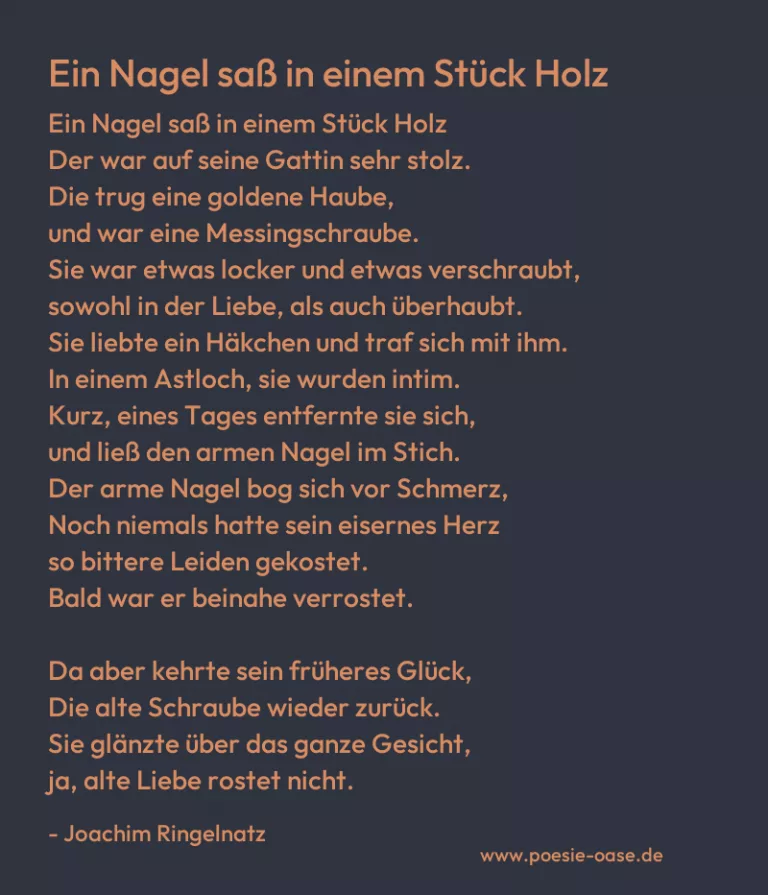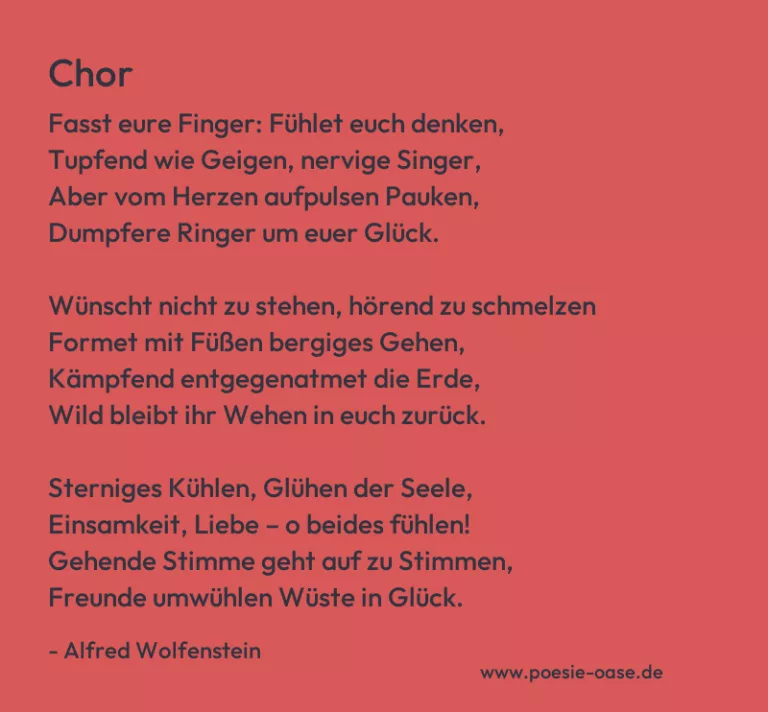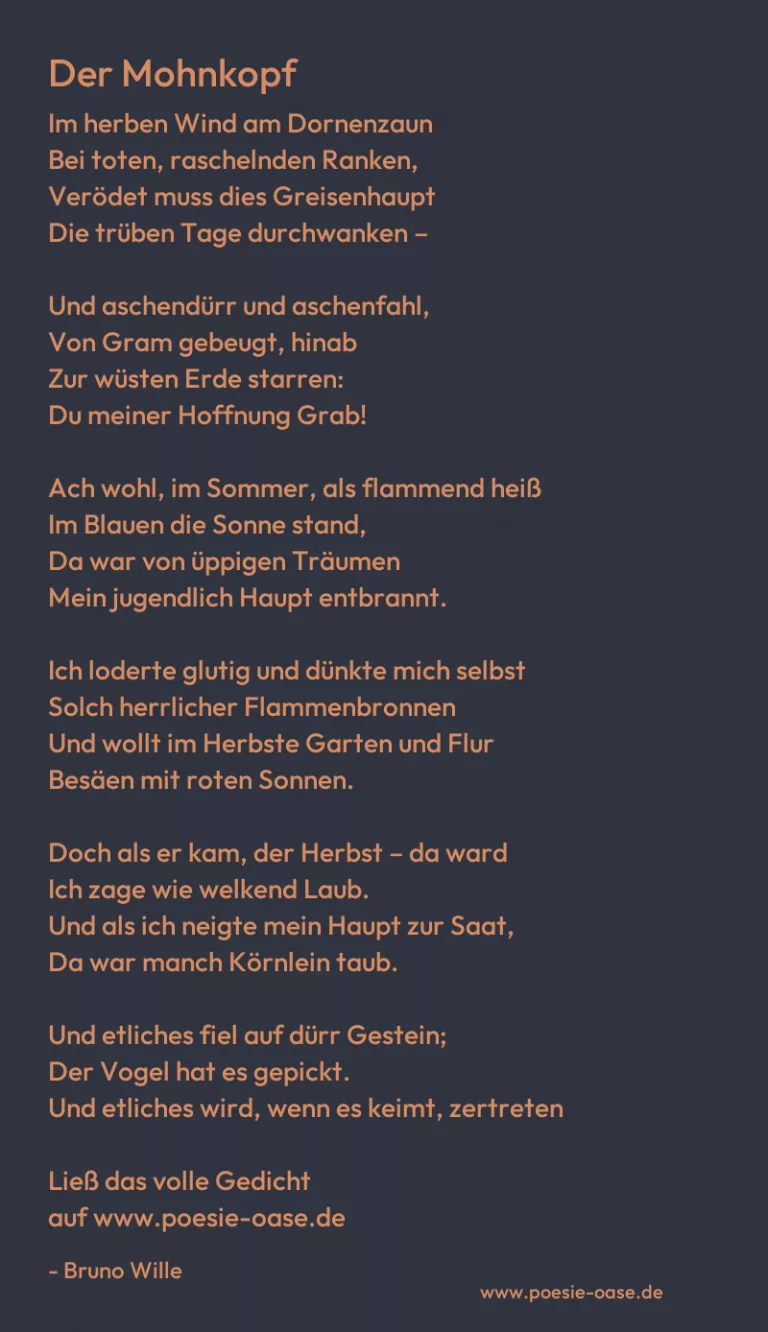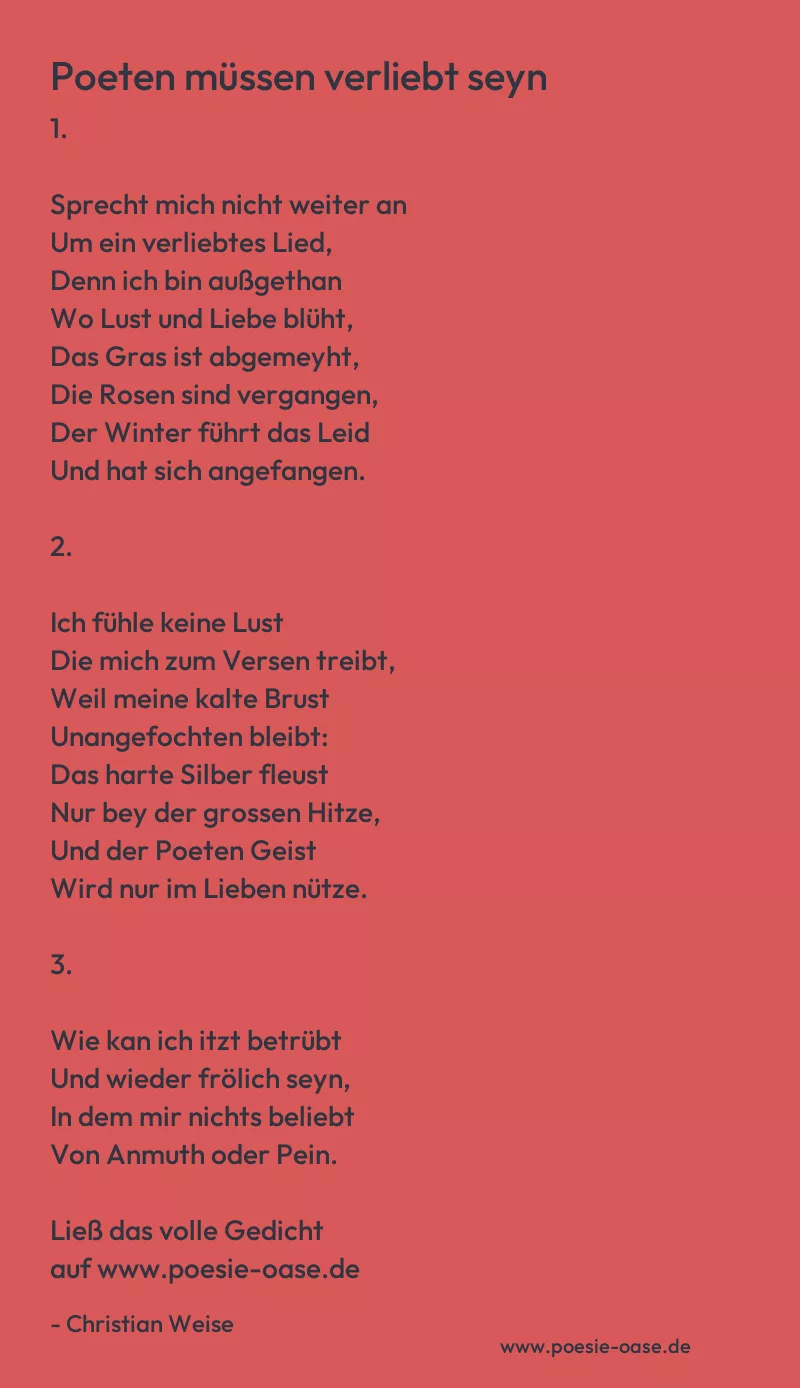1.
Sprecht mich nicht weiter an
Um ein verliebtes Lied,
Denn ich bin außgethan
Wo Lust und Liebe blüht,
Das Gras ist abgemeyht,
Die Rosen sind vergangen,
Der Winter führt das Leid
Und hat sich angefangen.
2.
Ich fühle keine Lust
Die mich zum Versen treibt,
Weil meine kalte Brust
Unangefochten bleibt:
Das harte Silber fleust
Nur bey der grossen Hitze,
Und der Poeten Geist
Wird nur im Lieben nütze.
3.
Wie kan ich itzt betrübt
Und wieder frölich seyn,
In dem mir nichts beliebt
Von Anmuth oder Pein.
Soll mein erfrornes Hertz
Von Glut und Flammen singen,
Und soll der kalte Schertz
Die spröde Feder zwingen?
4.
Ach nein die Aloe,
Der Zucker und Zibeth,
Macht weder wohl noch weh,
Wann der Geschmack vergeht.
Man muß die Eitelkeit
Der Liebe noch ertragen,
Will man von Freud und Leid
Gereimte Reimen sagen.
5.
Der ist fürwar nicht klug,
Der ohn ein Seitenspiel,
Durch einen Selbst-Betrug,
Verschwiegen tantzen will:
Und so wird mein Gedicht
Ein schlechtes Vrtheil fühlen,
Wo die Begierden nicht
Die Sarabande spielen.
6.
Geh zarte Poesie,
Du bleibst mir unbewust,
Geh meine süsse Müh,
Itzt meine saure Lust,
Ich schreibe was ich kan,
Ihr aber meine Brüder,
Sprecht mich nicht weiter an,
Umb Schertz- und Liebes-Lieder.