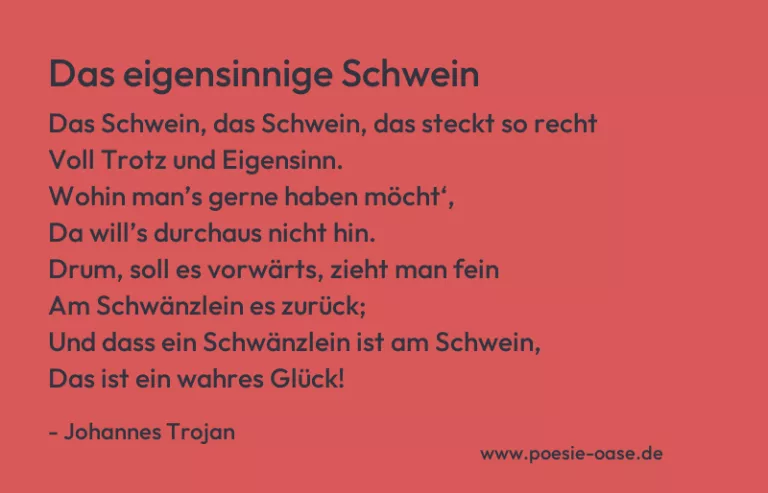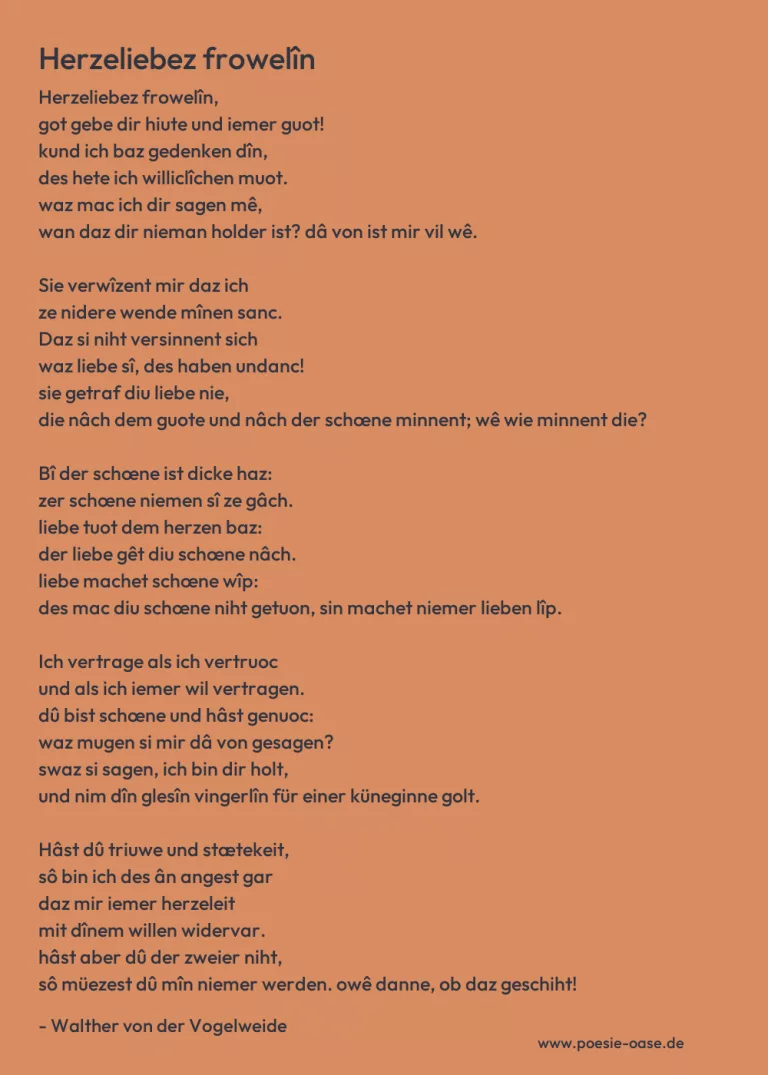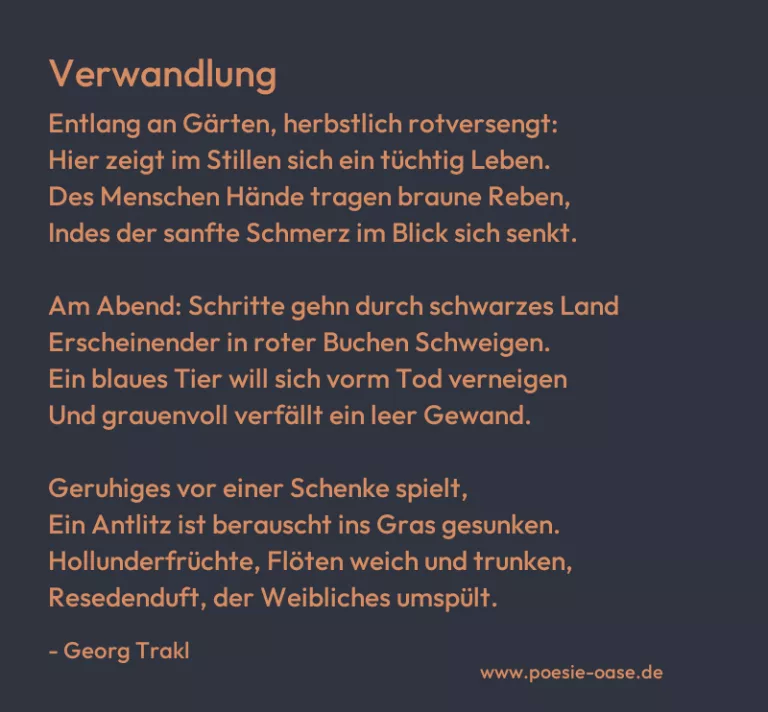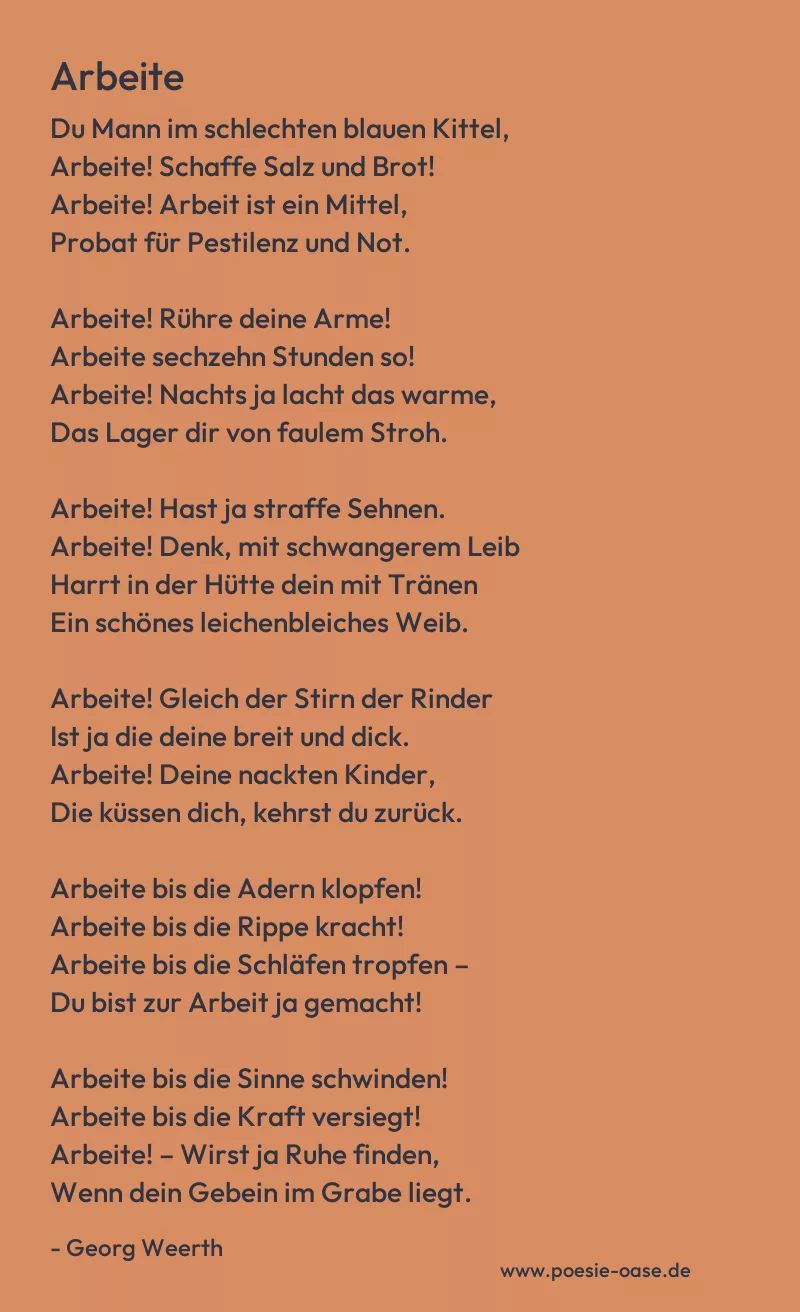Arbeite
Du Mann im schlechten blauen Kittel,
Arbeite! Schaffe Salz und Brot!
Arbeite! Arbeit ist ein Mittel,
Probat für Pestilenz und Not.
Arbeite! Rühre deine Arme!
Arbeite sechzehn Stunden so!
Arbeite! Nachts ja lacht das warme,
Das Lager dir von faulem Stroh.
Arbeite! Hast ja straffe Sehnen.
Arbeite! Denk, mit schwangerem Leib
Harrt in der Hütte dein mit Tränen
Ein schönes leichenbleiches Weib.
Arbeite! Gleich der Stirn der Rinder
Ist ja die deine breit und dick.
Arbeite! Deine nackten Kinder,
Die küssen dich, kehrst du zurück.
Arbeite bis die Adern klopfen!
Arbeite bis die Rippe kracht!
Arbeite bis die Schläfen tropfen –
Du bist zur Arbeit ja gemacht!
Arbeite bis die Sinne schwinden!
Arbeite bis die Kraft versiegt!
Arbeite! – Wirst ja Ruhe finden,
Wenn dein Gebein im Grabe liegt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
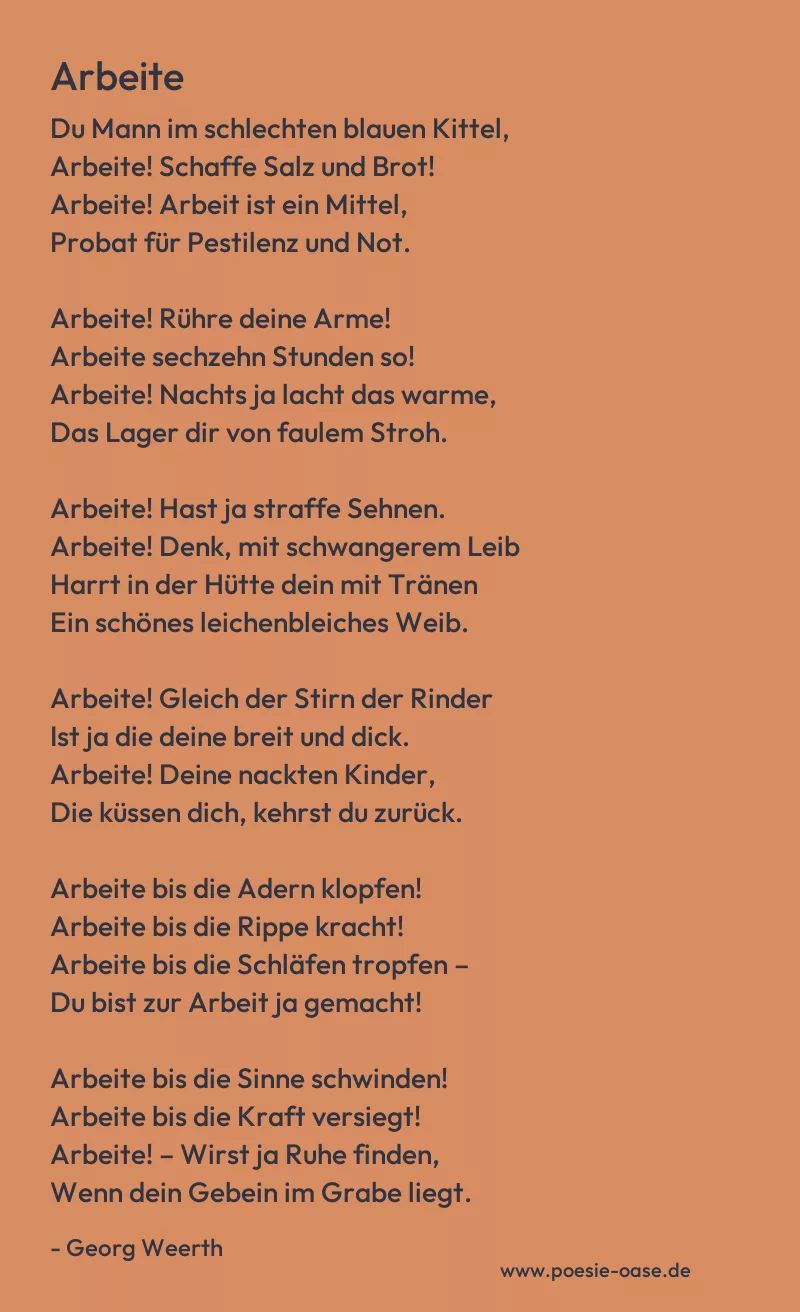
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Arbeite“ von Georg Weerth schildert auf eindringliche und fast schon quälende Weise die harte Realität der Arbeiterschaft und die gnadenlose Ausbeutung der einfachen Menschen. Der Dichter spricht direkt den „Mann im schlechten blauen Kittel“ an, der unaufhörlich arbeiten muss, um das tägliche Überleben zu sichern. Das „schlechte“ Bild des Kittels unterstreicht dabei die Armut und den niedrigen sozialen Status des Arbeiters. Arbeit wird als eine fast erzwungene, leidvolle Tätigkeit dargestellt, die lediglich als Mittel zum Überleben dient. Der imperativische Ruf „Arbeite!“ hallt in jeder Zeile wider, was die Dringlichkeit und Unentrinnbarkeit der Situation betont.
Im Verlauf des Gedichts wird die Erschöpfung und das Leid des Arbeiters immer deutlicher. Die langen, sechzehn Stunden der Arbeit, die das Bild von „faulem Stroh“ und dem „warmen Lager“ am Ende des Tages kontrastiert, zeigen die erschöpften Erwartungen des Arbeiters. Der „schwangerer Leib“ des „mit Tränen“ harrenden Weibes verweist auf die Verantwortung des Arbeiters, die Familie zu versorgen, was die psychische und körperliche Belastung der Arbeit noch weiter intensiviert. Es wird ein Bild der ständigen Pflicht und der Lasten gezeichnet, die der Arbeiter tragen muss, ohne dass er je eine wirkliche Pause oder Ruhe findet.
Die Darstellung der „straffen Sehnen“ und der „breiten und dicken“ Stirn zeigt den physischen Tribut, den die Arbeit vom Arbeiter verlangt. Die Arbeit selbst ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine existenzielle Belastung. Die Kinder, die „nackt“ den Arbeiter „küssen“, symbolisieren die nächste Generation, die ebenfalls dem gleichen Schicksal ausgesetzt ist, ohne Ausweg aus diesem Kreislauf. Das Gedicht verdeutlicht die soziale Vererbung von Armut und die Perspektivlosigkeit, die den Arbeitern zugeschrieben wird.
In den letzten Versen wird der Arbeiterschaft ein Zustand der völligen Erschöpfung und des körperlichen Verfalls zugeschrieben. Der imperativische Ton verstärkt sich, was die unbarmherzige Aufforderung zur Arbeit bis zum Zusammenbruch betont. Der „Kopf, der tropft“, die „Adern, die klopfen“, und die „Rippe, die kracht“ sind metaphorische Darstellungen der extremen Belastung und des körperlichen Verfalls. Am Ende wird der Tod als einzige Möglichkeit der „Ruhe“ dargestellt. Dies unterstreicht die zynische Realität der Arbeitswelt, die dem Arbeiter keinen Raum für Erholung lässt und seine einzige Ruhe im Tod findet.
Das Gedicht vermittelt eine düstere Kritik an der Ausbeutung der Arbeiterklasse und der unmenschlichen Arbeitsbedingungen, die für den Arbeiter keine Perspektive bieten, sondern ihn in einem Teufelskreis von Erschöpfung und Not gefangen halten. Weerth setzt eine direkte und schmerzhafte Sprache ein, um die tragische Realität der damaligen Arbeiter zu zeigen, die in ihrer Arbeit zugrunde gehen, ohne jemals eine Chance auf Verbesserung ihres Lebens zu haben.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.