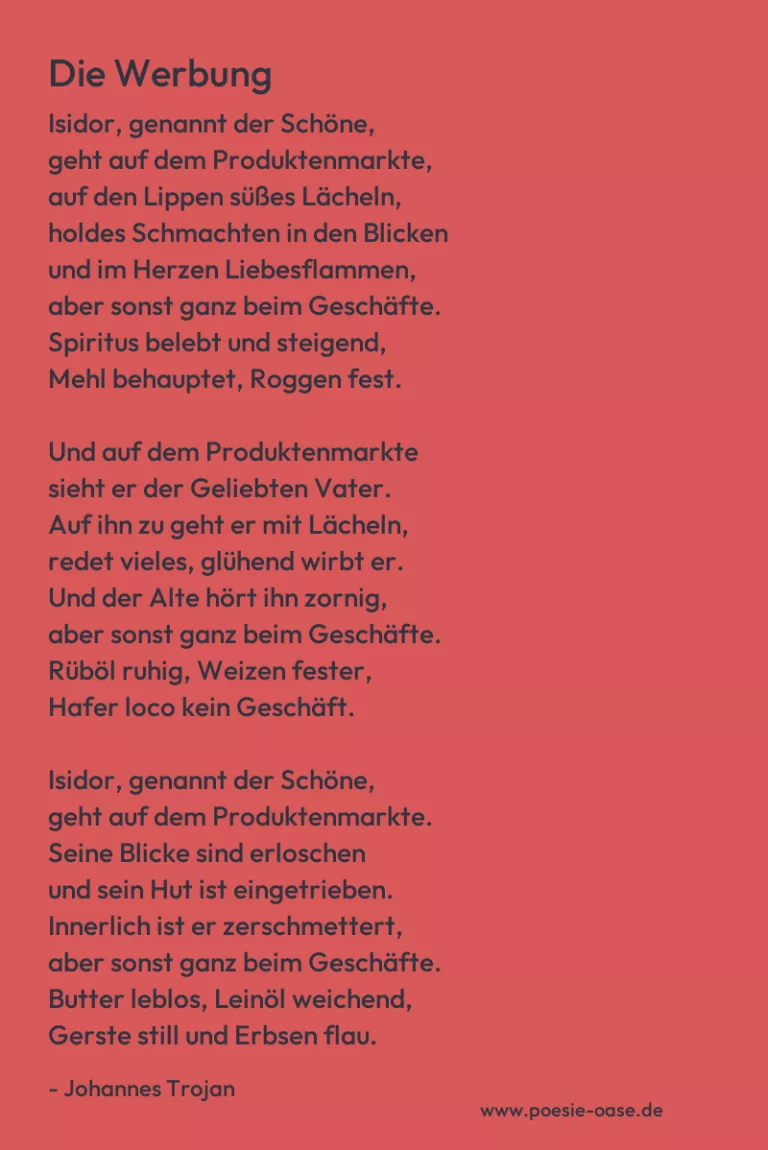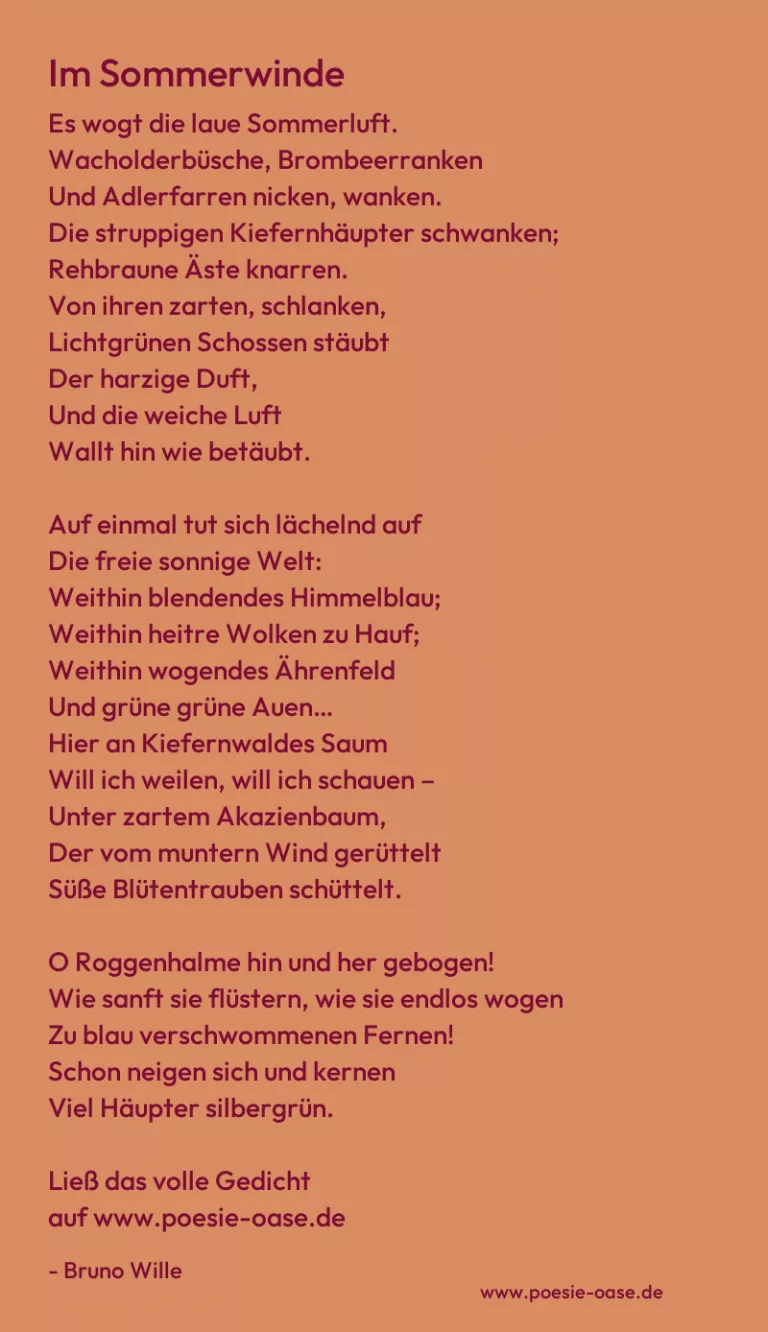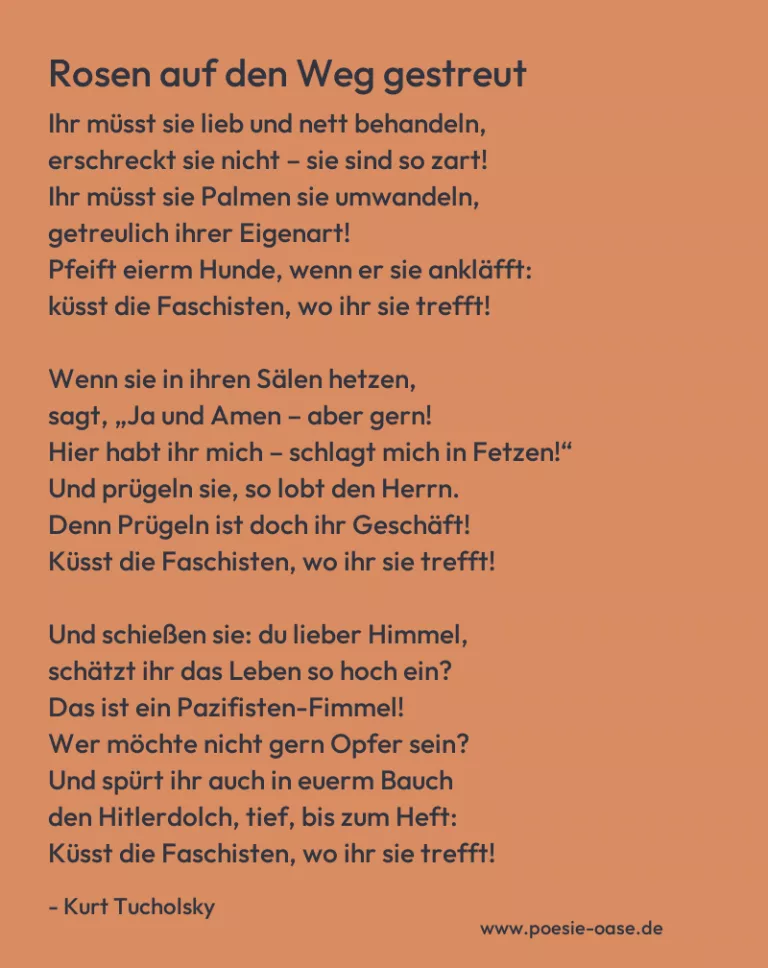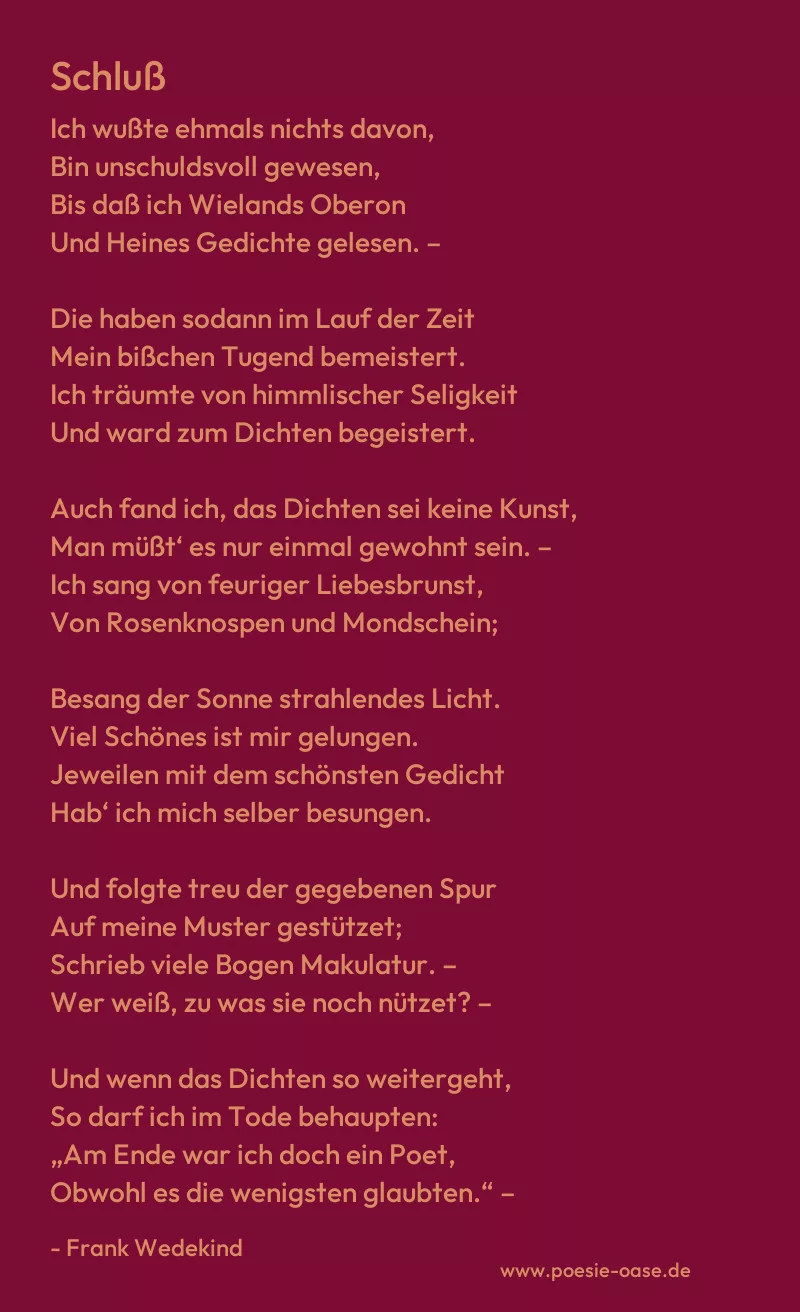Schluß
Ich wußte ehmals nichts davon,
Bin unschuldsvoll gewesen,
Bis daß ich Wielands Oberon
Und Heines Gedichte gelesen. –
Die haben sodann im Lauf der Zeit
Mein bißchen Tugend bemeistert.
Ich träumte von himmlischer Seligkeit
Und ward zum Dichten begeistert.
Auch fand ich, das Dichten sei keine Kunst,
Man müßt‘ es nur einmal gewohnt sein. –
Ich sang von feuriger Liebesbrunst,
Von Rosenknospen und Mondschein;
Besang der Sonne strahlendes Licht.
Viel Schönes ist mir gelungen.
Jeweilen mit dem schönsten Gedicht
Hab‘ ich mich selber besungen.
Und folgte treu der gegebenen Spur
Auf meine Muster gestützet;
Schrieb viele Bogen Makulatur. –
Wer weiß, zu was sie noch nützet? –
Und wenn das Dichten so weitergeht,
So darf ich im Tode behaupten:
„Am Ende war ich doch ein Poet,
Obwohl es die wenigsten glaubten.“ –
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
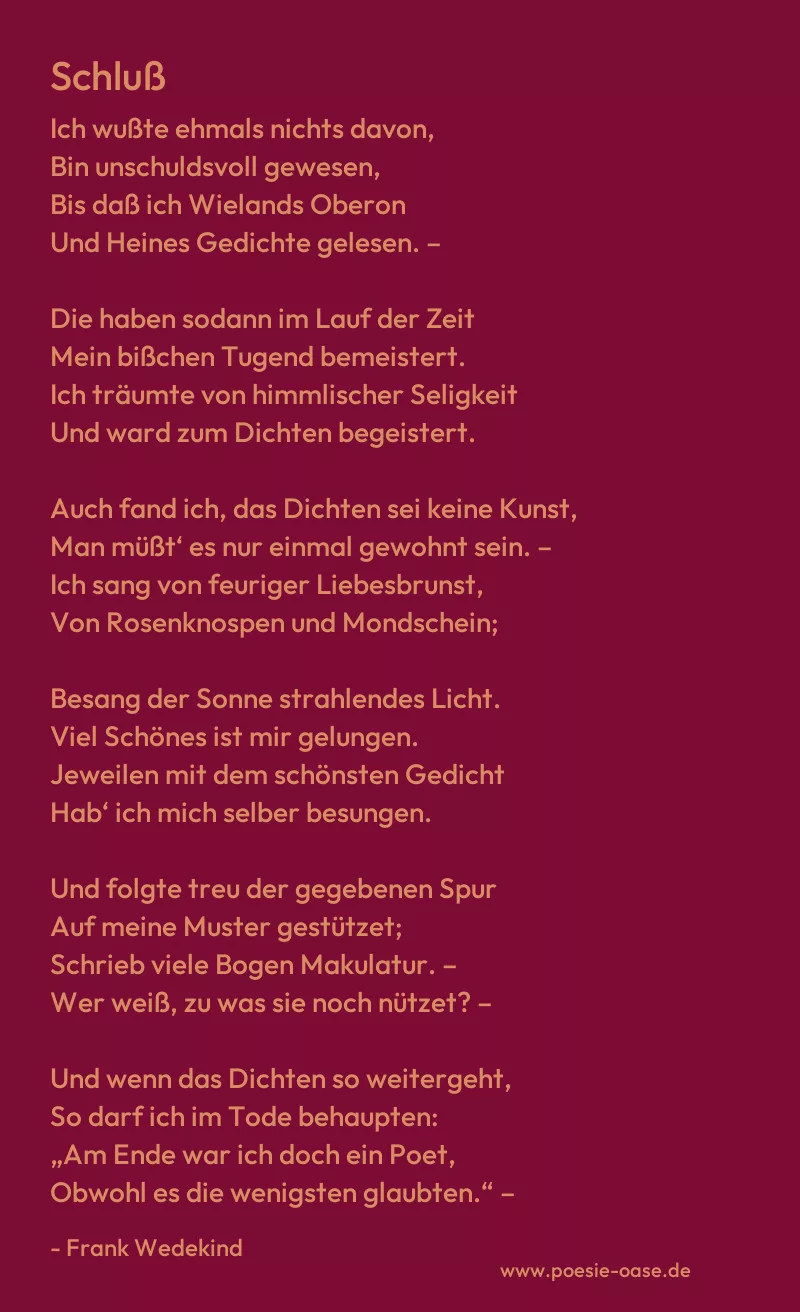
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Schluß“ von Frank Wedekind reflektiert auf humorvolle und selbstkritische Weise über den poetischen Werdegang des Sprechers. Zu Beginn betont der Sprecher, dass er ursprünglich nichts von der Kunst des Dichtens wusste und „unschuldig“ war. Erst durch das Lesen von „Wielands Oberon“ und Heines Gedichten wurde er auf die Möglichkeit des Dichtens aufmerksam. Diese Werke sind für ihn der Auslöser, der ihn von der „Tugend“ in eine neue kreative Welt führte. Die „himmlische Seligkeit“ des Dichtens ist ein romantisches Ideal, das den Sprecher in seinen Bann zieht und ihn mit Leidenschaft erfüllt.
Im Verlauf des Gedichts wird jedoch deutlich, dass der Sprecher das Dichten zunächst als eine Art einfache Tätigkeit ansieht, die keine besondere Kunstfertigkeit erfordert. Er erklärt, dass man es nur „einmal gewohnt sein“ müsse. Diese naiv wirkende Einstellung wird durch das Besingen von „feuriger Liebesbrunst“ und „Rosenknospen und Mondschein“ verstärkt, was stereotypische und kitschige Bilder sind, die in der romantischen Dichtung oft vorkommen. Der Sprecher sieht seine Gedichte als gelungen an, da sie die idealisierte Vorstellung von Liebe und Schönheit widerspiegeln. Doch gleichzeitig ist er sich bewusst, dass viele seiner Werke möglicherweise nicht viel nützen werden („wer weiß, zu was sie noch nützet?“).
Die Selbstkritik des Sprechers wird in der letzten Strophe deutlich, wenn er anerkennt, dass er viele „Bogen Makulatur“ geschrieben hat, also unbrauchbare oder wertlose Werke. Dennoch bleibt der Sprecher hartnäckig in seinem Drang zu dichten, als ob es keine andere Wahl für ihn gäbe. Am Ende des Gedichts kommt eine Art versöhnliche, fast resignierte Erkenntnis: Auch wenn nur wenige an seine Qualitäten als Poet glauben, so kann der Sprecher im Tode dennoch stolz behaupten, ein „Poet“ gewesen zu sein.
Wedekind setzt hier eine Mischung aus Ironie und Selbstreflexion ein, um die Ambivalenz des poetischen Schaffens darzustellen. Der Sprecher begreift sich als Künstler, auch wenn seine Werke in der breiten Öffentlichkeit nicht anerkannt werden. Das Gedicht spielt mit der Idee des „Selbstverständnisses“ als Poet und zugleich mit der Erkenntnis, dass Dichtung nicht immer den hohen Anspruch an Kunst erfüllt, den sie in der Gesellschaft oftmals beansprucht. Es ist eine humorvolle und gleichzeitig nachdenkliche Auseinandersetzung mit der Bedeutung und dem Wert von Literatur im persönlichen und öffentlichen Kontext.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.