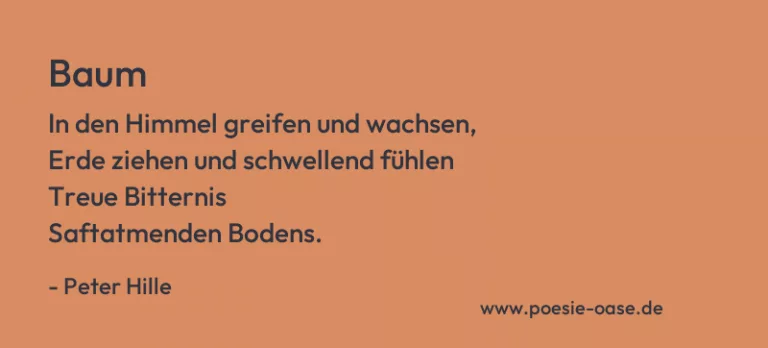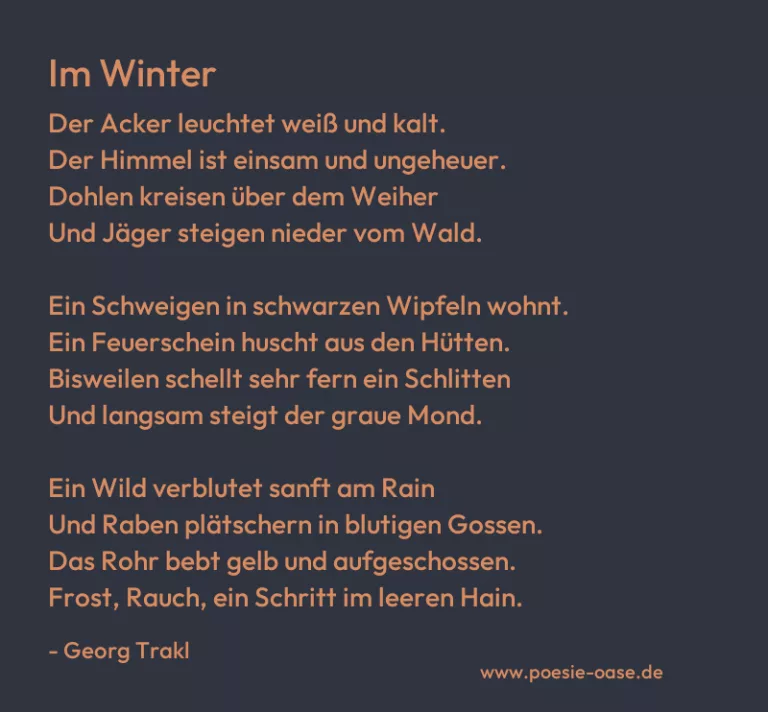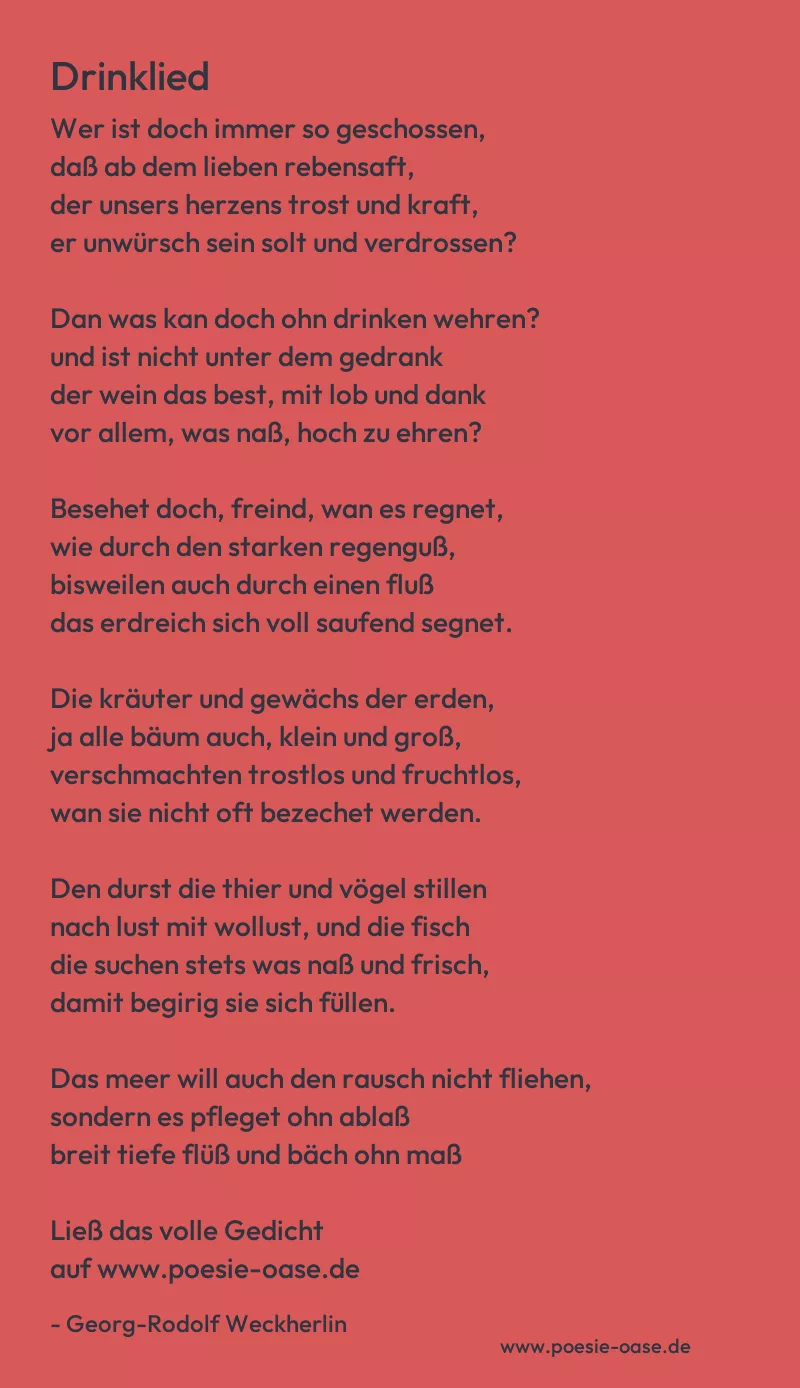Wer ist doch immer so geschossen,
daß ab dem lieben rebensaft,
der unsers herzens trost und kraft,
er unwürsch sein solt und verdrossen?
Dan was kan doch ohn drinken wehren?
und ist nicht unter dem gedrank
der wein das best, mit lob und dank
vor allem, was naß, hoch zu ehren?
Besehet doch, freind, wan es regnet,
wie durch den starken regenguß,
bisweilen auch durch einen fluß
das erdreich sich voll saufend segnet.
Die kräuter und gewächs der erden,
ja alle bäum auch, klein und groß,
verschmachten trostlos und fruchtlos,
wan sie nicht oft bezechet werden.
Den durst die thier und vögel stillen
nach lust mit wollust, und die fisch
die suchen stets was naß und frisch,
damit begirig sie sich füllen.
Das meer will auch den rausch nicht fliehen,
sondern es pfleget ohn ablaß
breit tiefe flüß und bäch ohn maß
garaußend in den wanst zu ziehen.
Ist es dan durch den drunk getroffen,
so fanget es ein wesen an,
als ob es auch wolt jederman
ersäufen, weil es selbs besoffen.
Und warum fallen oft zu haufen
die tobend-brausend-laute wind?
weil sie, zu bausen sehr geschwind,
das meer gern wolten gar aussaufen.
In dem meer und in allen bronnen
die sonn selbs löschet ihren durst,
und der mon wär schon ein bratwurst,
wan er nicht yoll würd von der sonnen.
Drum soll uns fürhin niemand wehren,
wan nichts will unbesoffen sein,
auch mit einander bei dem wein
frolockend tag und nacht zu zehren.
Dan wer unwürsch ist und verdrossen
ab diesem guten rebensaft,
der unsers herzens trost und kraft,
der ist (zwar nüchtern, doch) geschossen.