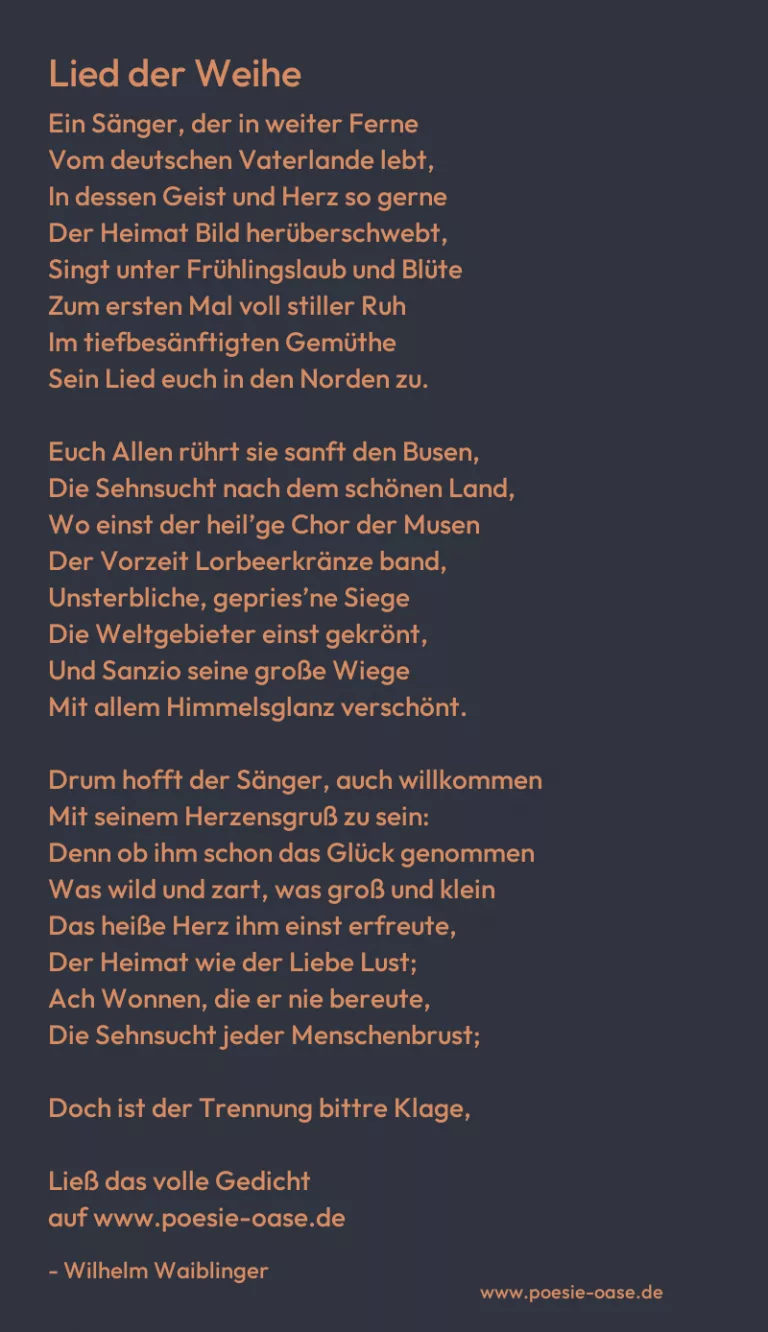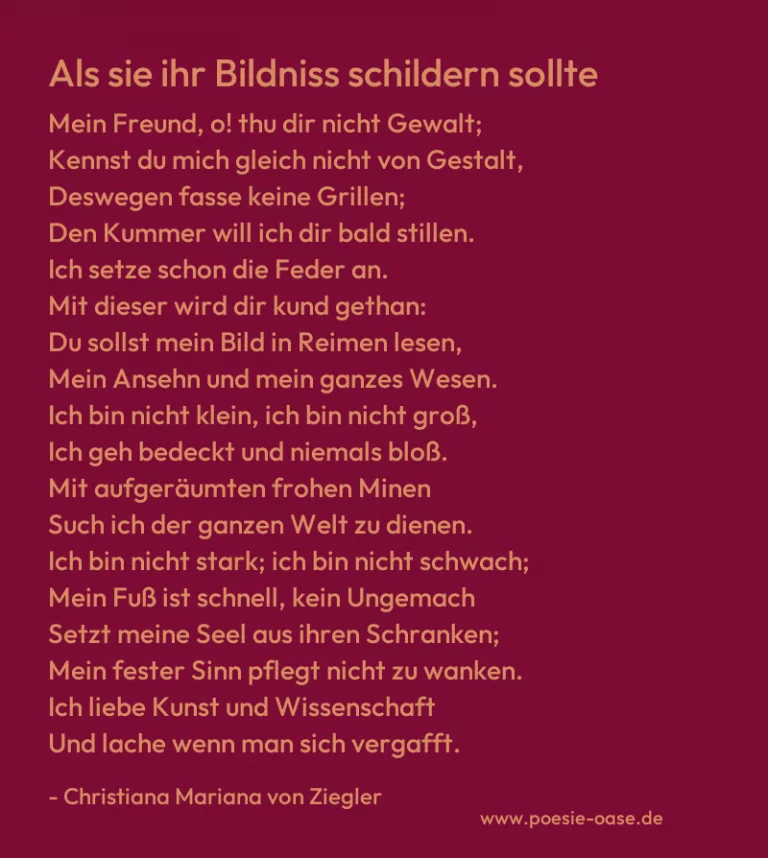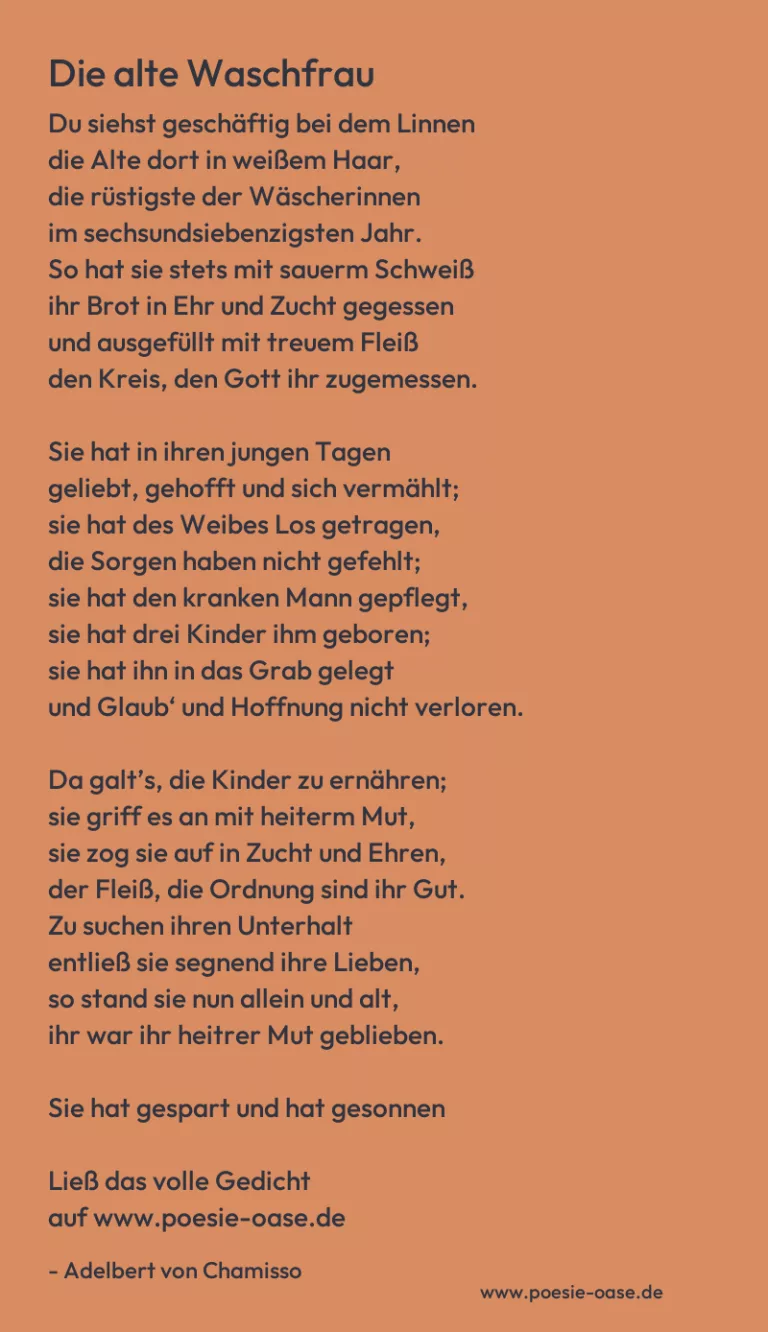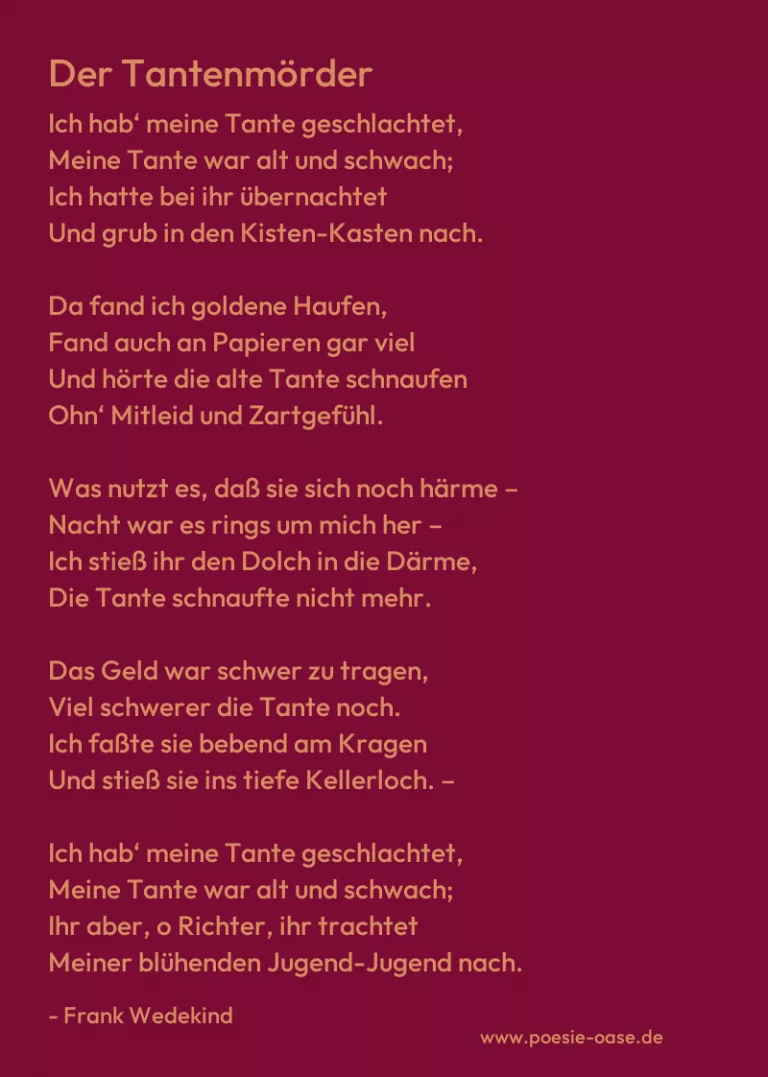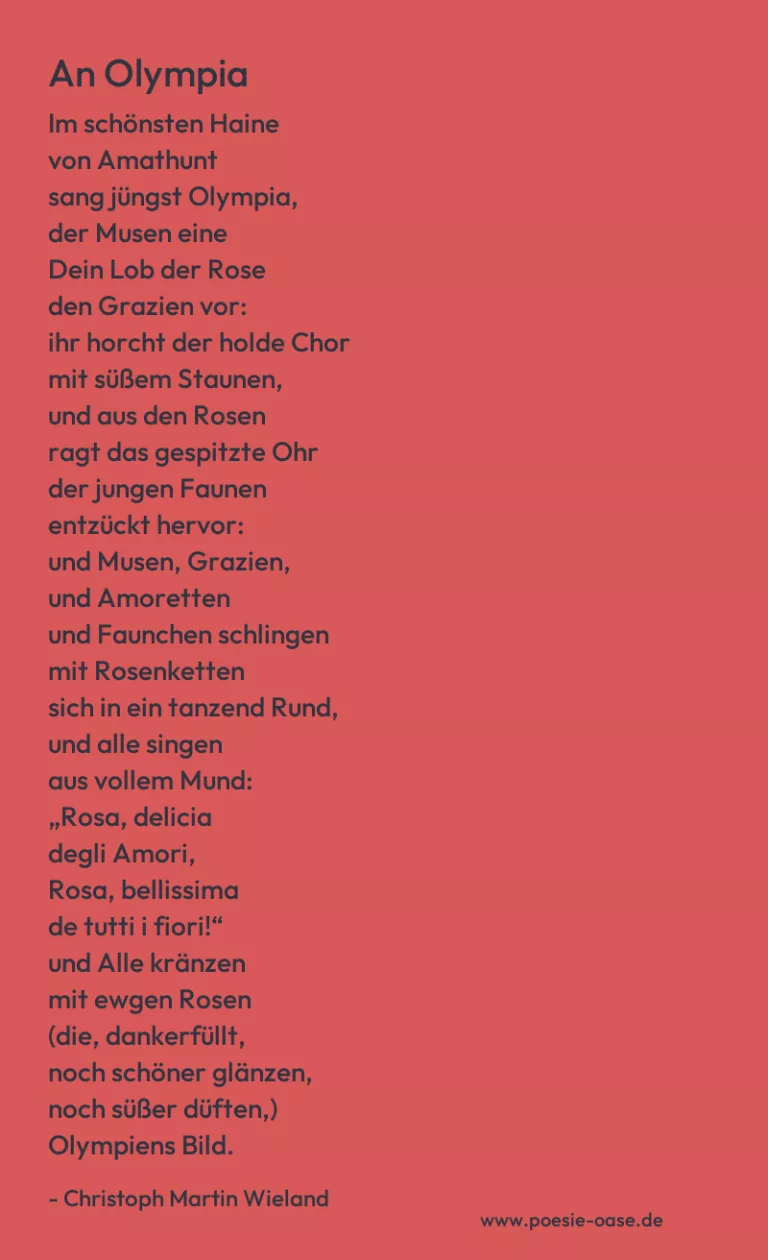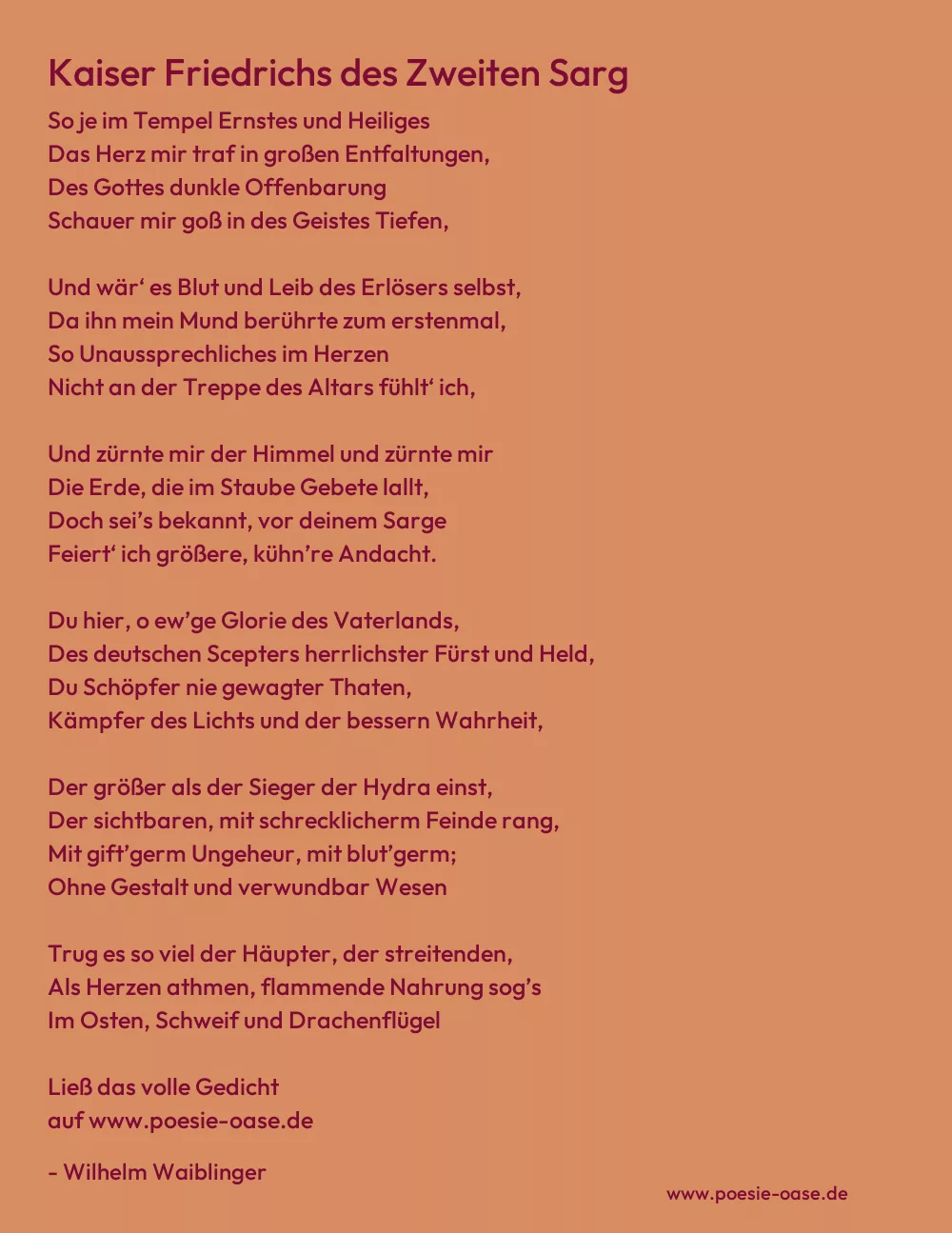So je im Tempel Ernstes und Heiliges
Das Herz mir traf in großen Entfaltungen,
Des Gottes dunkle Offenbarung
Schauer mir goß in des Geistes Tiefen,
Und wär‘ es Blut und Leib des Erlösers selbst,
Da ihn mein Mund berührte zum erstenmal,
So Unaussprechliches im Herzen
Nicht an der Treppe des Altars fühlt‘ ich,
Und zürnte mir der Himmel und zürnte mir
Die Erde, die im Staube Gebete lallt,
Doch sei’s bekannt, vor deinem Sarge
Feiert‘ ich größere, kühn’re Andacht.
Du hier, o ew’ge Glorie des Vaterlands,
Des deutschen Scepters herrlichster Fürst und Held,
Du Schöpfer nie gewagter Thaten,
Kämpfer des Lichts und der bessern Wahrheit,
Der größer als der Sieger der Hydra einst,
Der sichtbaren, mit schrecklicherm Feinde rang,
Mit gift’germ Ungeheur, mit blut’germ;
Ohne Gestalt und verwundbar Wesen
Trug es so viel der Häupter, der streitenden,
Als Herzen athmen, flammende Nahrung sog’s
Im Osten, Schweif und Drachenflügel
Schlug den zertretnen, zermalmten Abend.
Des Rachens unersättlicher Schlund am Strand
Des Tibers gähnt‘ er, Throne zertrümmert‘ er,
Ein groß Jahrtausend war sein Leben,
Rühmt‘ er nicht selbst sich des Himmels Wächter,
Dein Feind, o Friedrich? Größern bekämpfte nie
Ein Held, sei’s denn der Engel des Schwerts vielleicht,
Der Belial schlug. O Staub des Herrschers,
Betet‘ ich Irdisches an, du wärst es.
Des Bannstrahls denk‘ ich, den aufs gekrönte Haupt
Roms frechster Priester schleuderte, Volk und Land
Mit Fluch beladend und der Menschheit
Heiligste Fesseln, der Wüthrich, sprengend.
Du aber, Kaiser, weintest in hohem Zorn
Und riefst: Des Reiches Kronen o bringt mir sie!
Und aufs geweihte Haupt sie setzend
Sprachst du in Flammen gekränkten Herzens:
Wer nähme mir die Krone von diesem Haupt?
Der Worte denk‘ ich, und in der Seele mir
Grollt bittrer Zorn; vom Sarge, dünkt mir,
Stiegest empor du in deiner Hoheit,
Des Domes Säulen stürzend und fragend: Wer,
Wer nähme mir die Krone vom Kaiserhaupt?
Und Hände ringend, Tod im Auge,
Riefe der Staufe: Wo ist mein Enkel?
Sein Blut komm‘ über euch und den Priesterstuhl,
Mein letztes Blut, mein theuerstes, über euch
Komm‘ es! Gerichtet hat die Stimme
Längst schon der Menschheit, und kommen wird er,
Der Tag, wo Jener richtet, der mich dem Staub
Anheim gab, fordern wird er von euch die Schuld,
Und ist auch dreifach eure Krone,
Dreifach mit Greueln beladen ist sie!
So dünkt mir, spricht weissagend der Geist; doch längst
Grollt ihm der Priester, grollt ihm die Mutter selbst,
Die allbarmherz’ge, nicht mehr; friedlich
Ruhet im Tempel des Kaisers Asche.
Und fern vom goldnen Altar erschallt der Chor
Zu Friedrichs Einsamkeit und des Vaters Sarg,
Als wollt‘ er ihren Zorn, als wollt‘ er
Reuig den rächenden Gott besänft’gen.