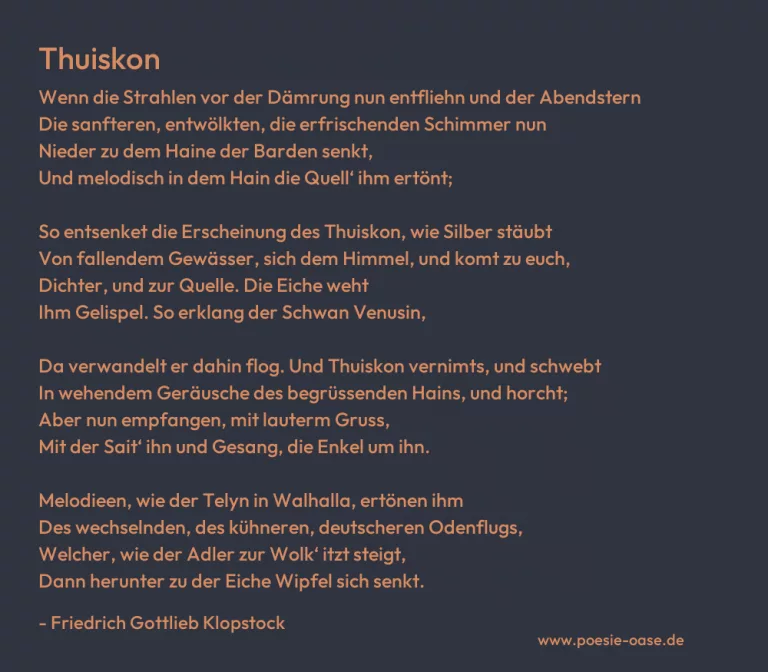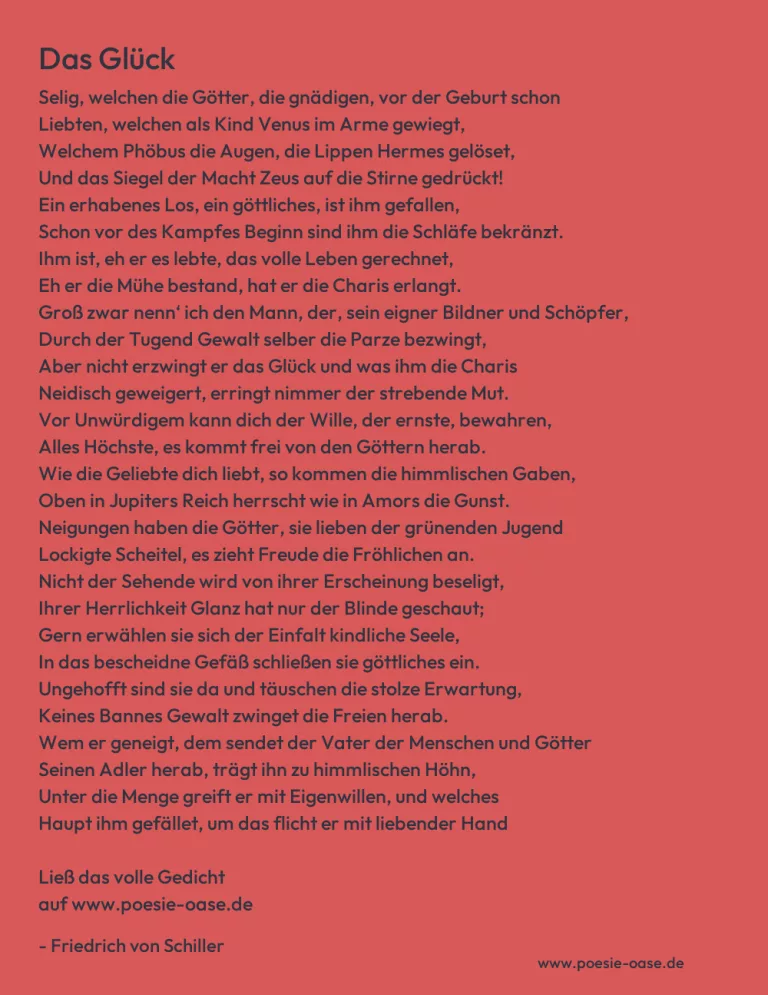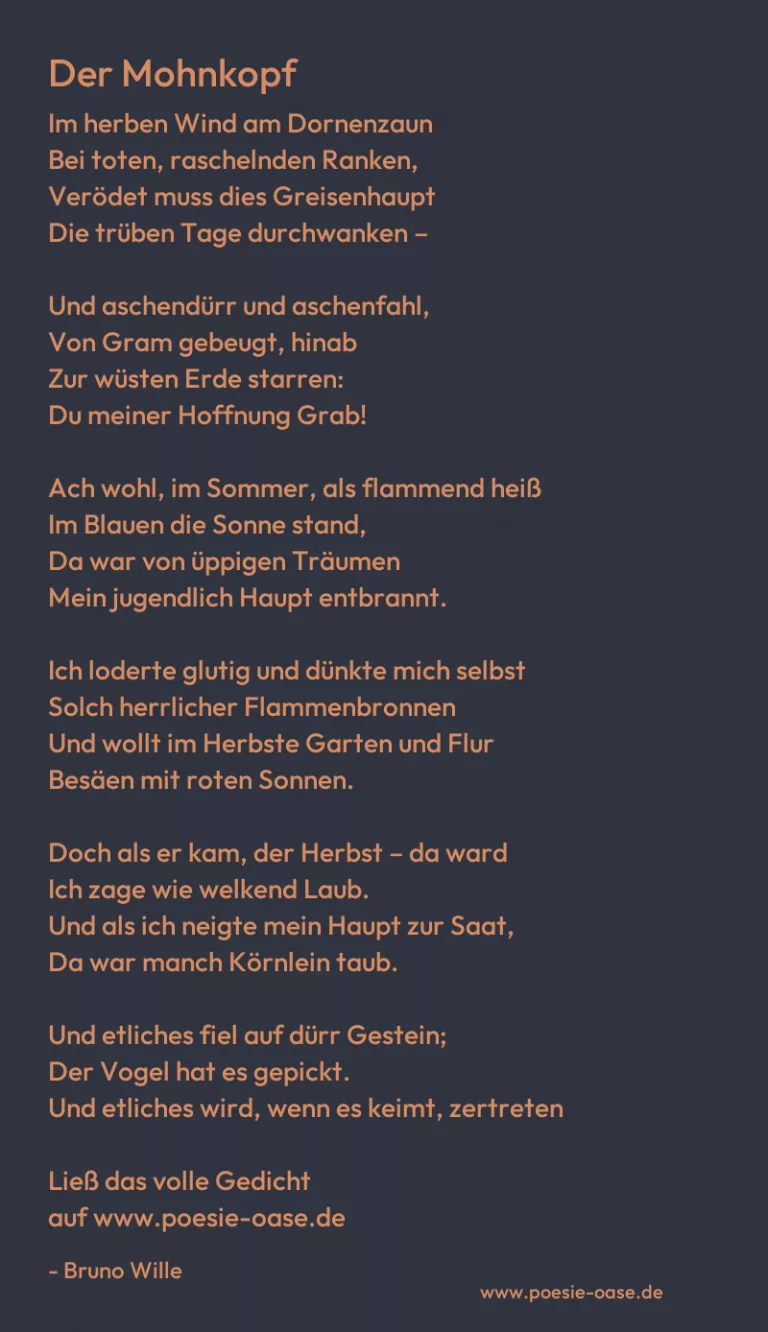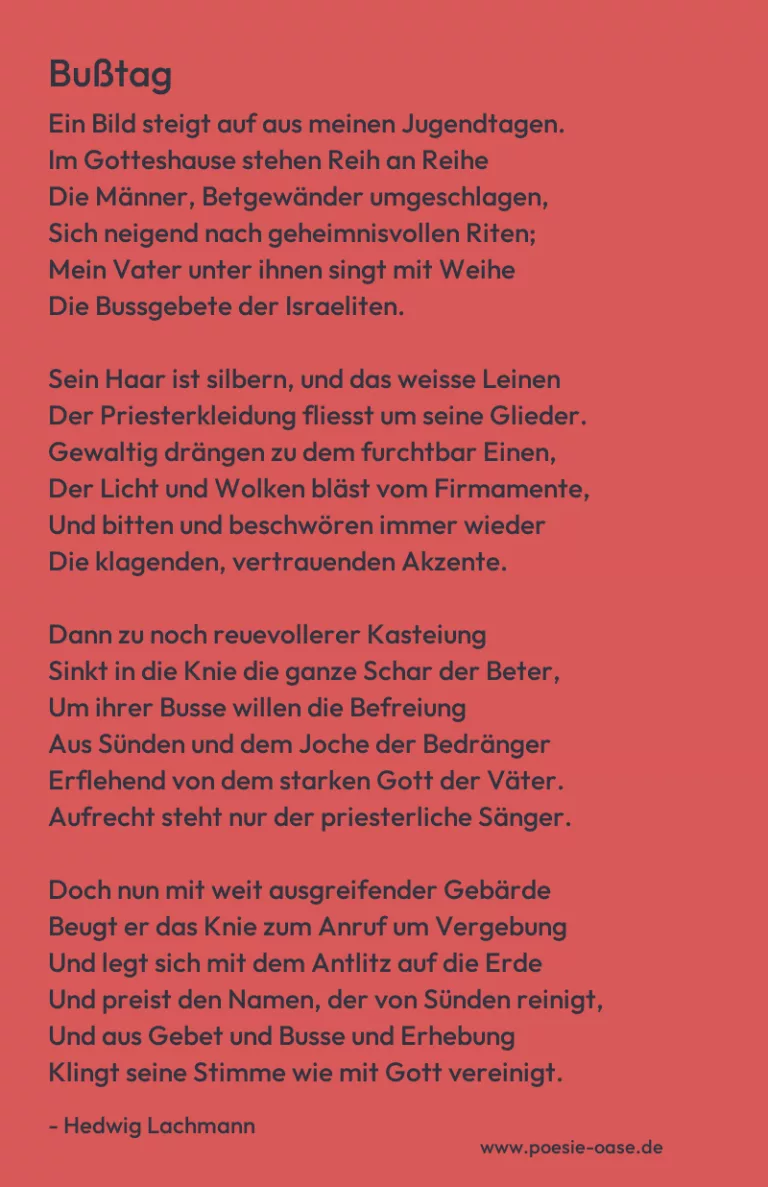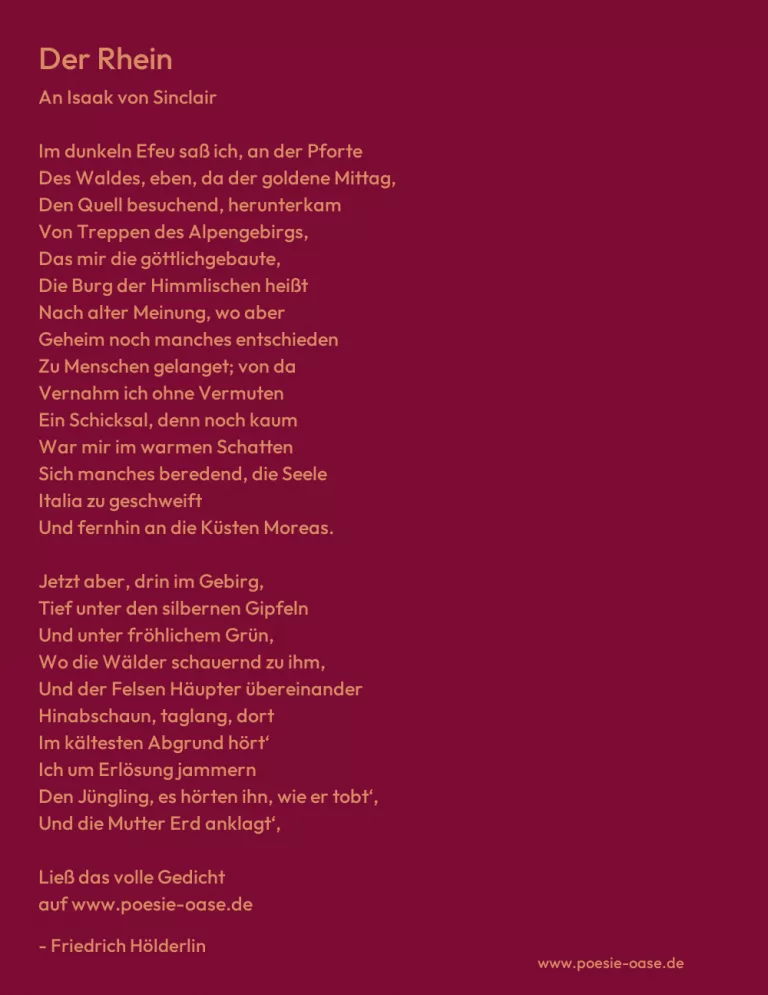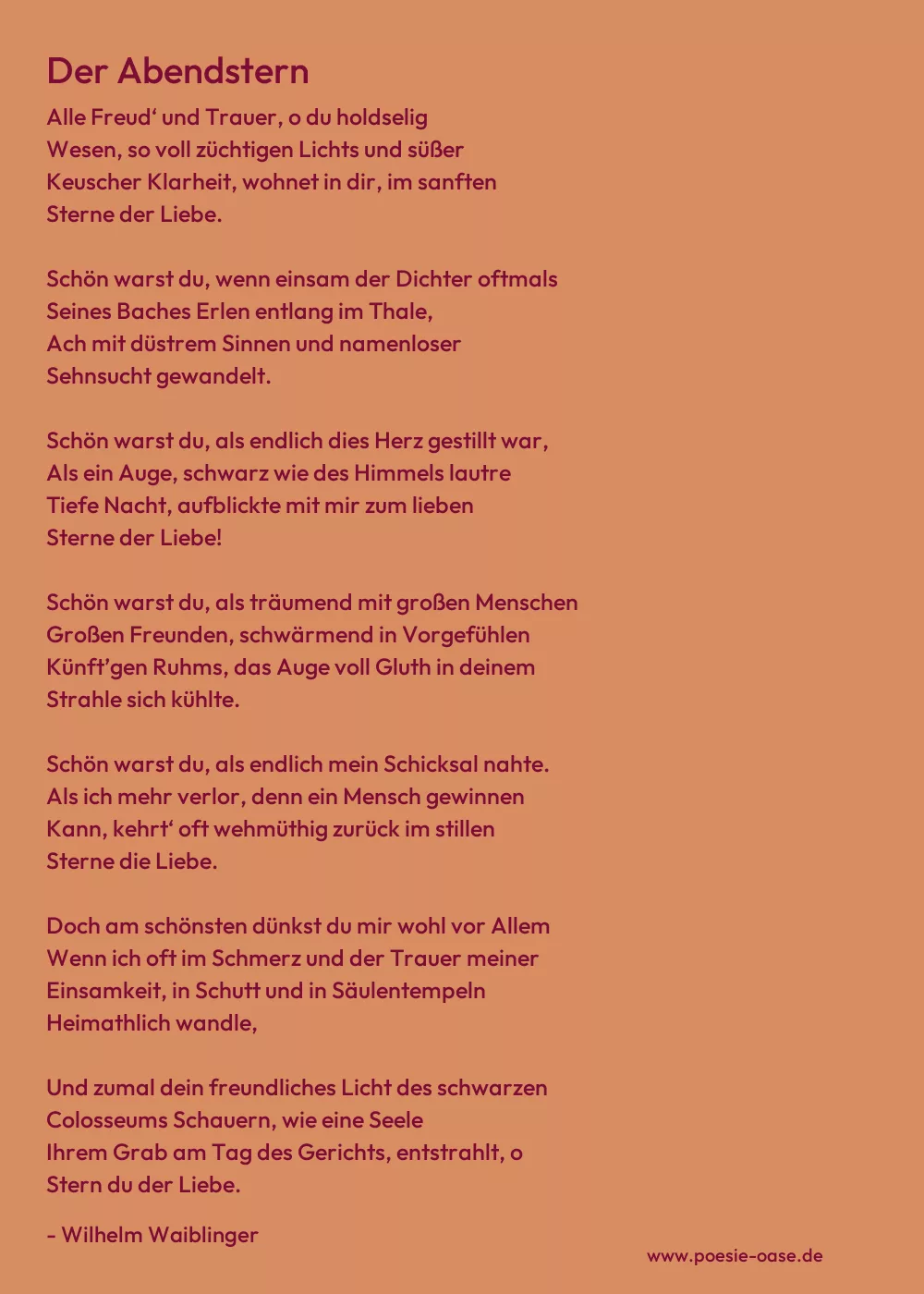Alle Freud‘ und Trauer, o du holdselig
Wesen, so voll züchtigen Lichts und süßer
Keuscher Klarheit, wohnet in dir, im sanften
Sterne der Liebe.
Schön warst du, wenn einsam der Dichter oftmals
Seines Baches Erlen entlang im Thale,
Ach mit düstrem Sinnen und namenloser
Sehnsucht gewandelt.
Schön warst du, als endlich dies Herz gestillt war,
Als ein Auge, schwarz wie des Himmels lautre
Tiefe Nacht, aufblickte mit mir zum lieben
Sterne der Liebe!
Schön warst du, als träumend mit großen Menschen
Großen Freunden, schwärmend in Vorgefühlen
Künft’gen Ruhms, das Auge voll Gluth in deinem
Strahle sich kühlte.
Schön warst du, als endlich mein Schicksal nahte.
Als ich mehr verlor, denn ein Mensch gewinnen
Kann, kehrt‘ oft wehmüthig zurück im stillen
Sterne die Liebe.
Doch am schönsten dünkst du mir wohl vor Allem
Wenn ich oft im Schmerz und der Trauer meiner
Einsamkeit, in Schutt und in Säulentempeln
Heimathlich wandle,
Und zumal dein freundliches Licht des schwarzen
Colosseums Schauern, wie eine Seele
Ihrem Grab am Tag des Gerichts, entstrahlt, o
Stern du der Liebe.