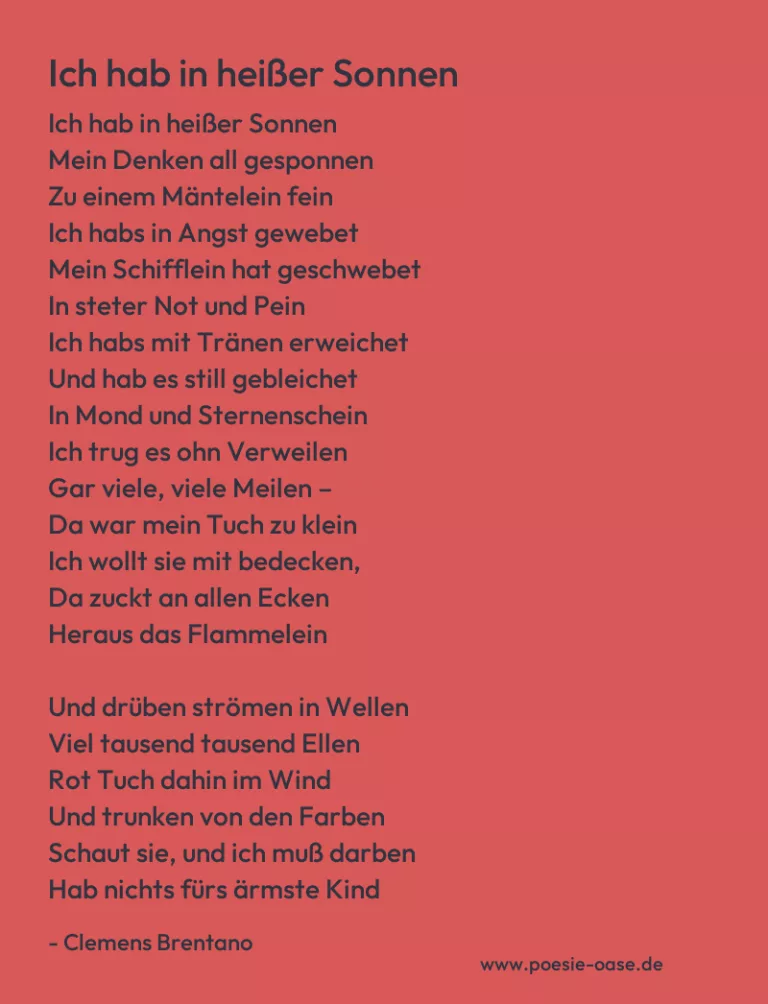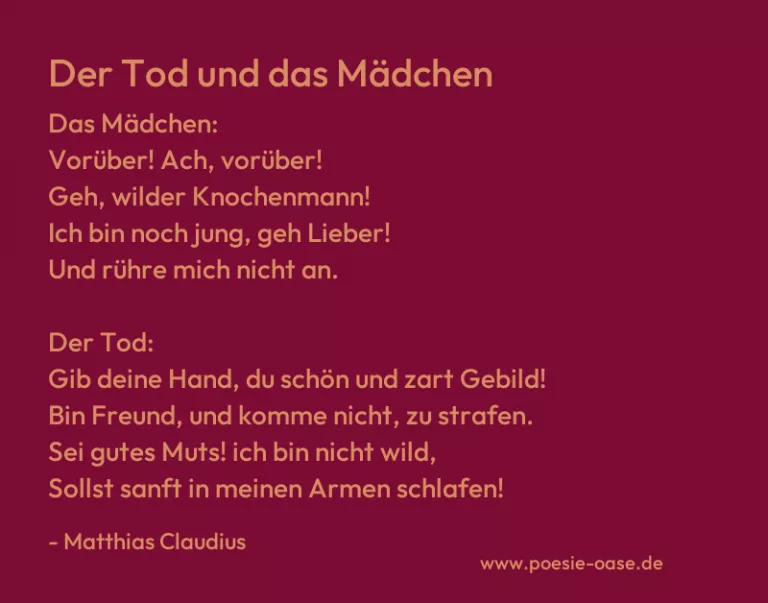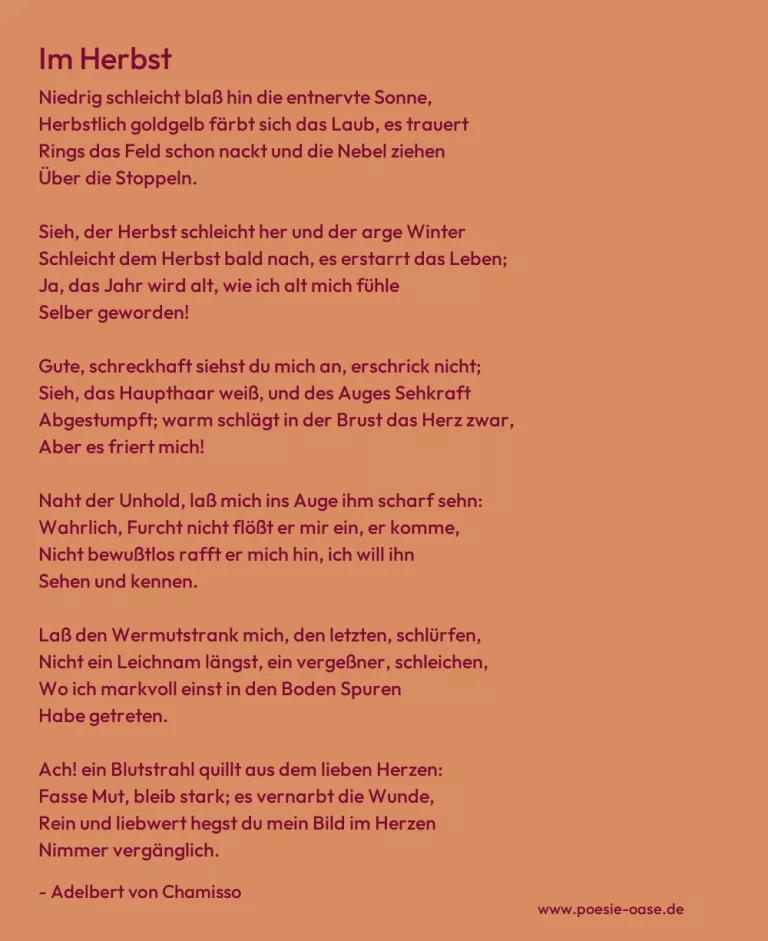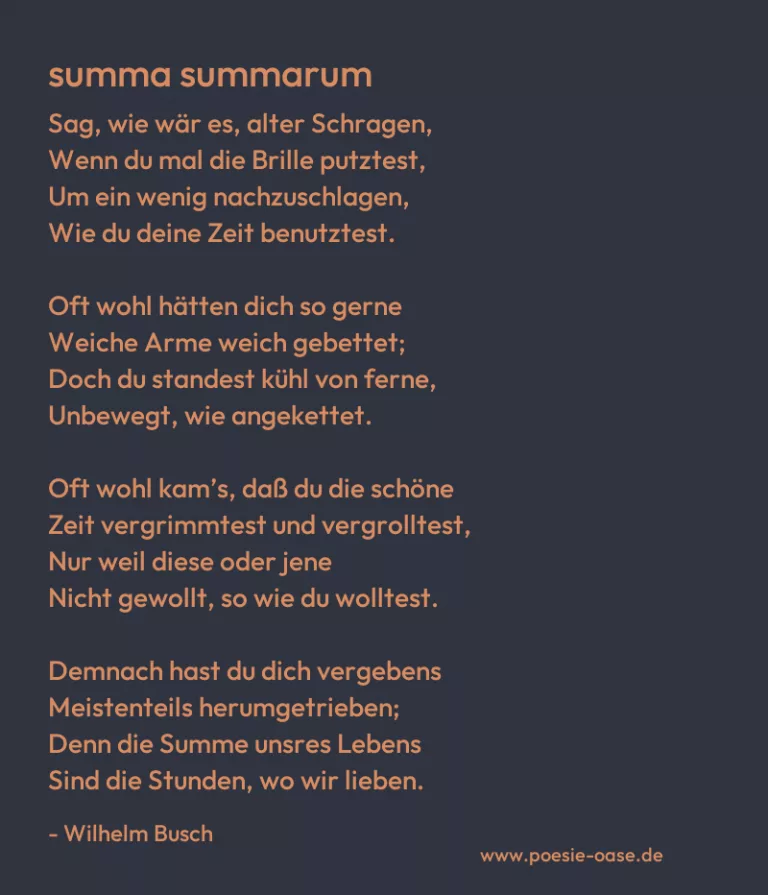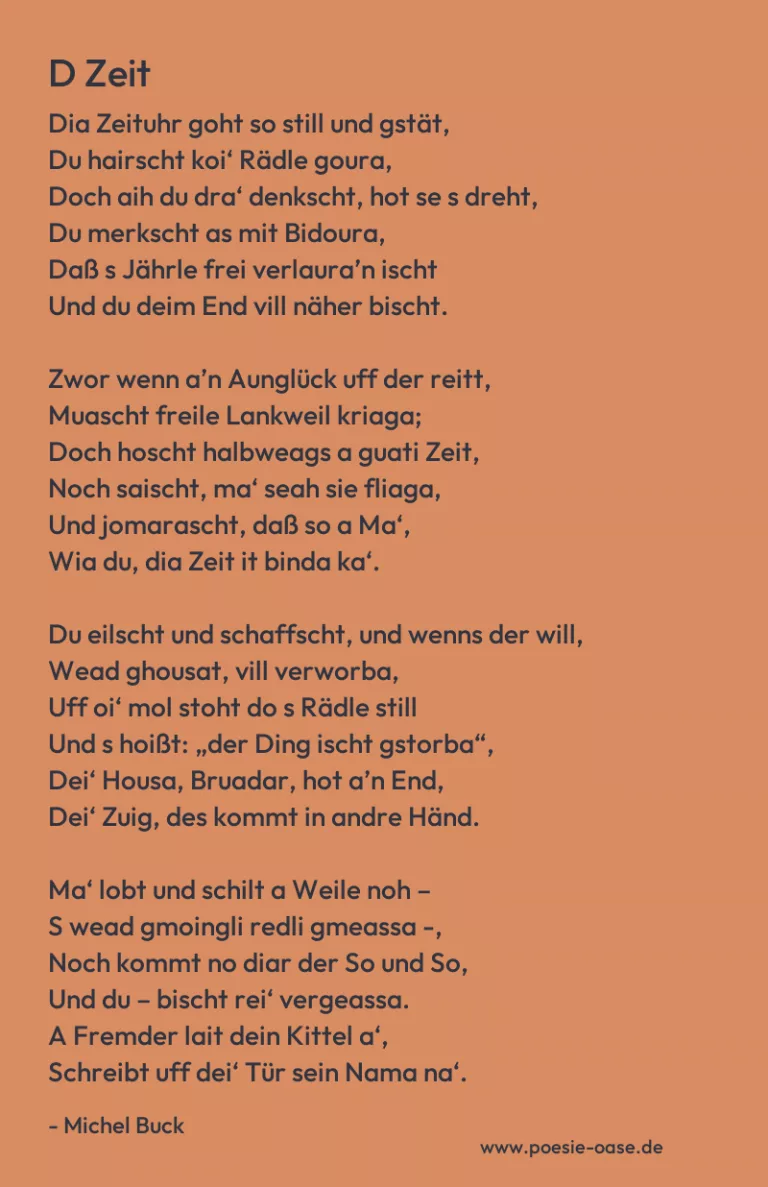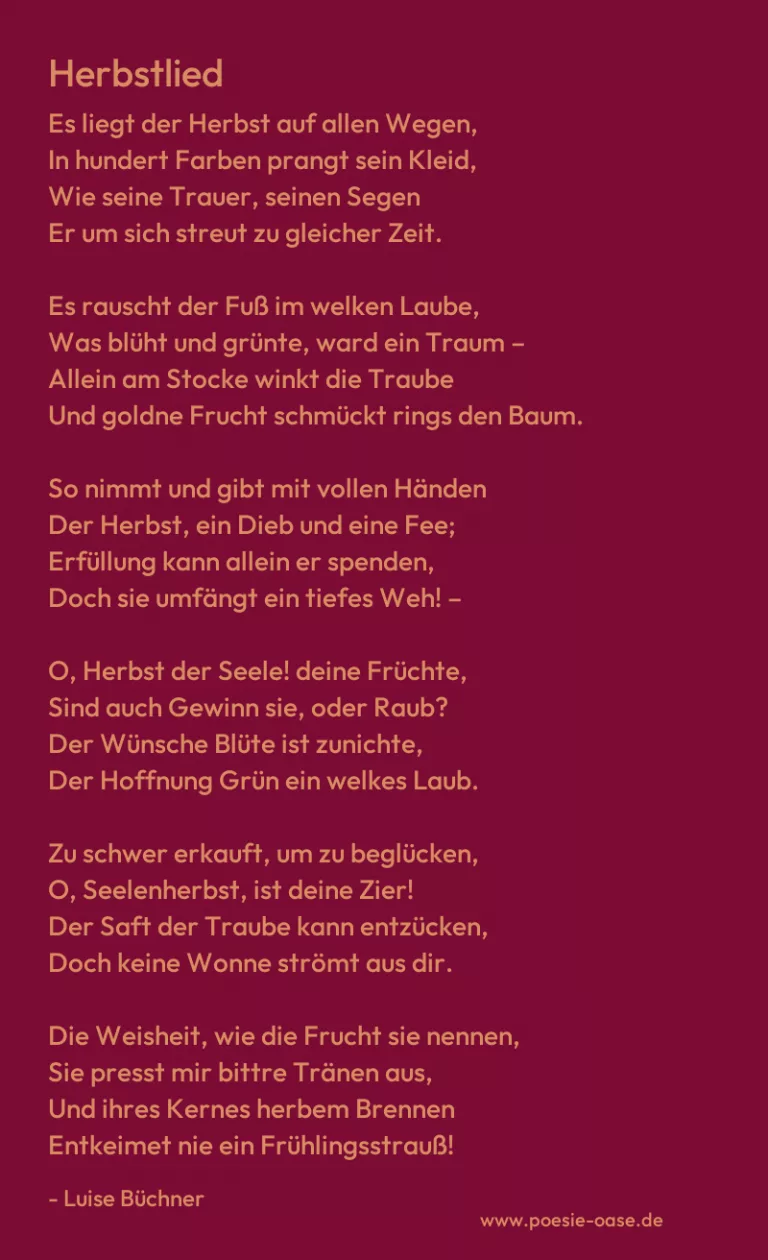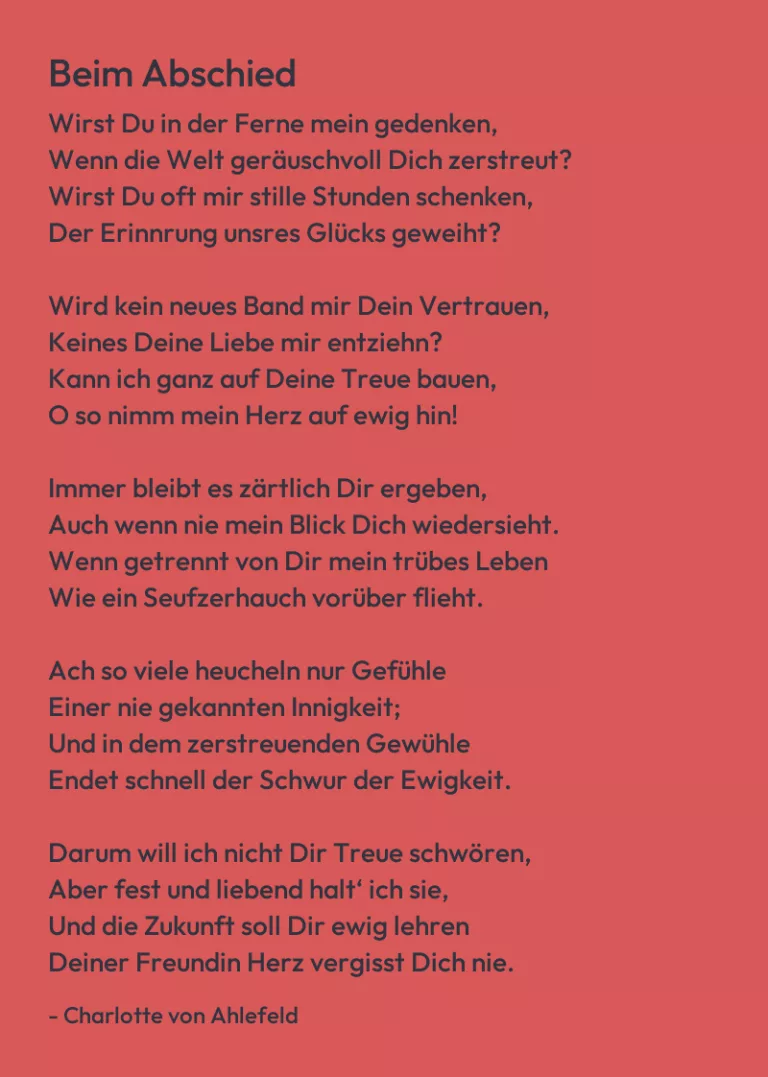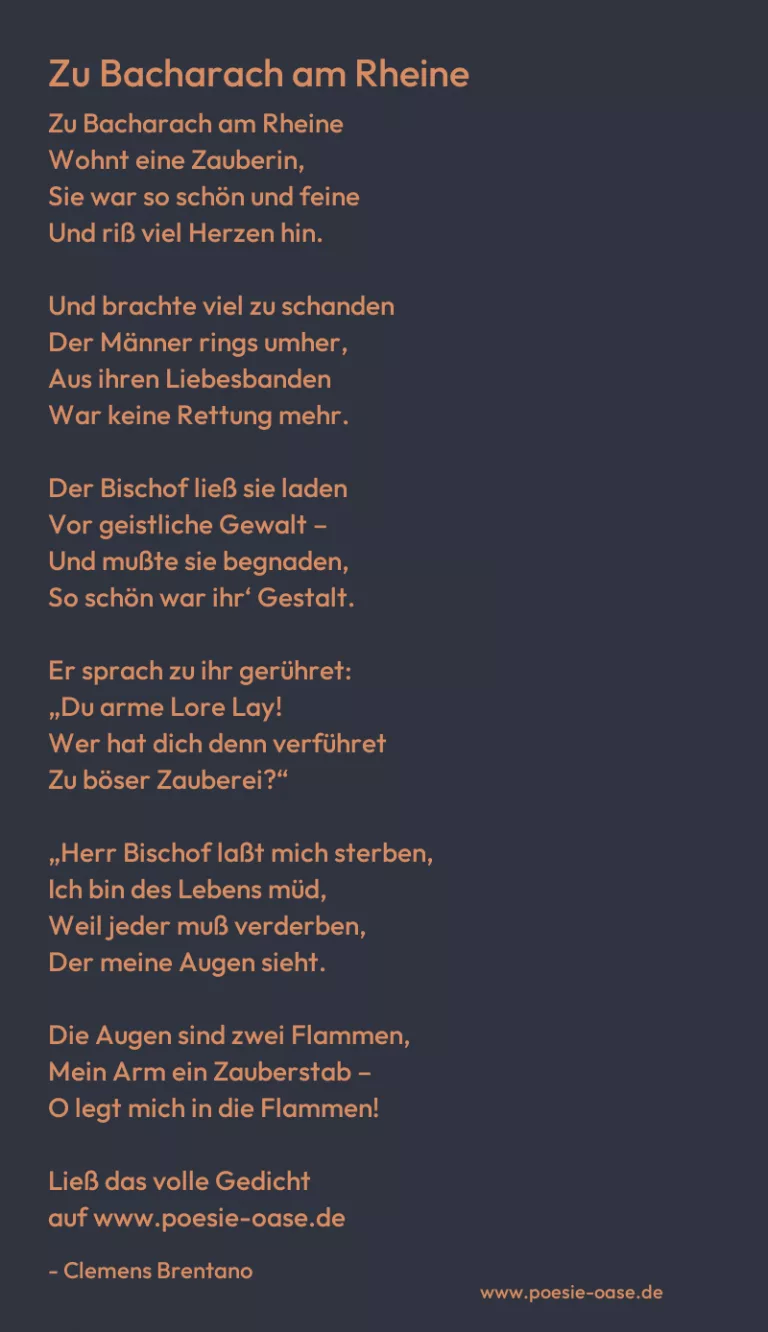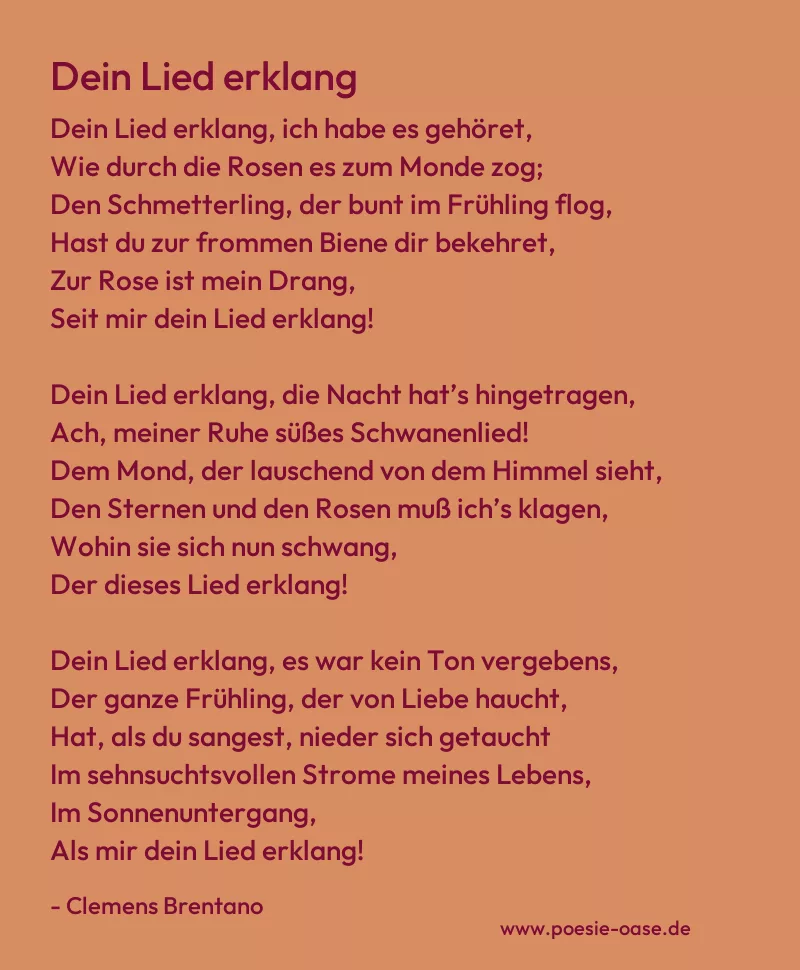Dein Lied erklang
Dein Lied erklang, ich habe es gehöret,
Wie durch die Rosen es zum Monde zog;
Den Schmetterling, der bunt im Frühling flog,
Hast du zur frommen Biene dir bekehret,
Zur Rose ist mein Drang,
Seit mir dein Lied erklang!
Dein Lied erklang, die Nacht hat’s hingetragen,
Ach, meiner Ruhe süßes Schwanenlied!
Dem Mond, der lauschend von dem Himmel sieht,
Den Sternen und den Rosen muß ich’s klagen,
Wohin sie sich nun schwang,
Der dieses Lied erklang!
Dein Lied erklang, es war kein Ton vergebens,
Der ganze Frühling, der von Liebe haucht,
Hat, als du sangest, nieder sich getaucht
Im sehnsuchtsvollen Strome meines Lebens,
Im Sonnenuntergang,
Als mir dein Lied erklang!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
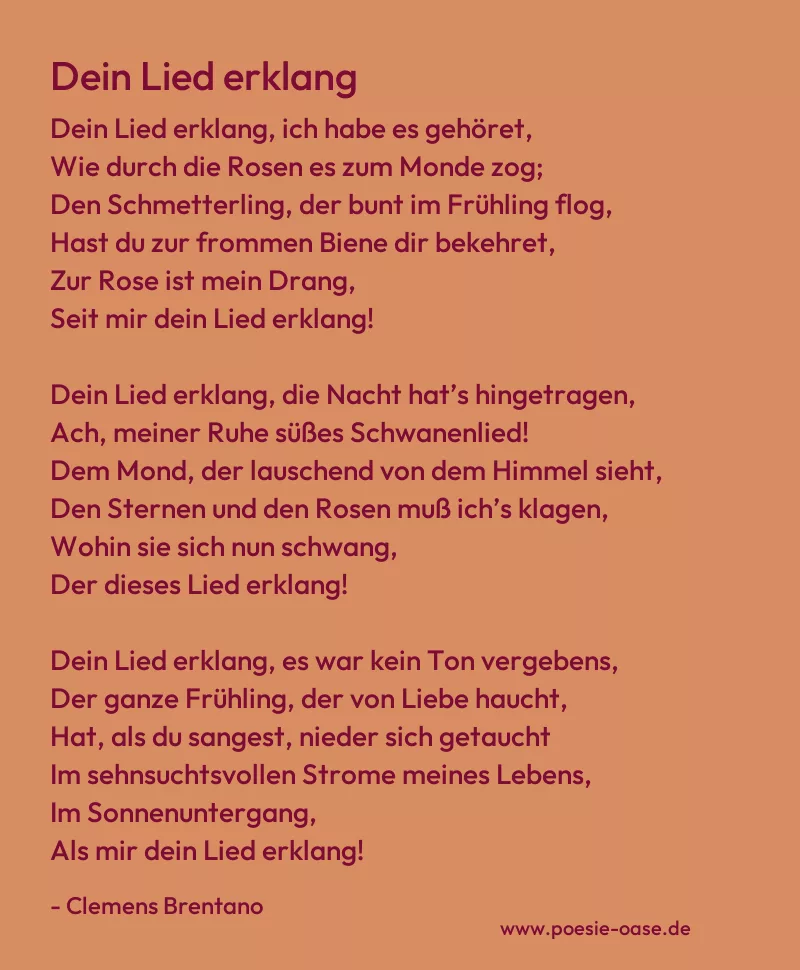
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Dein Lied erklang“ von Clemens Brentano ist ein zartes, klangvolles Bekenntnis zur Wirkung der Liebe, vermittelt durch Musik und Natur. Im Zentrum steht ein Lied – vermutlich von der geliebten Person gesungen –, das das lyrische Ich tief berührt und in einen Zustand sehnsüchtiger Verwandlung versetzt. Brentano verwebt dabei musikalische, florale und himmlische Motive zu einer romantischen, fast mystischen Gefühlswelt.
Die wiederkehrende Zeile „Dein Lied erklang“ wirkt wie ein Refrain und betont die nachhaltige Wirkung des Gesangs. Das Lied zieht durch „Rosen zum Monde“ – ein Bild voll poetischer Anmut, das sowohl Schönheit als auch Entrückung andeutet. Durch das Lied wird sogar der flatterhafte Schmetterling zur „frommen Biene“ bekehrt – eine Metapher für die Verwandlung von leichtsinniger in ernste, treue Liebe. Auch das lyrische Ich selbst erfährt einen Richtungswechsel: Der „Drang“ geht nun zur „Rose“, zum Zentrum des Empfindens und der Liebe.
In der zweiten Strophe gewinnt die Szenerie an nächtlicher Tiefe. Das Lied wird zum „Schwanenlied der Ruhe“, also zu einem Ausdruck zarter Trauer oder Melancholie. Der Mond und die Sterne, klassische Zuhörer romantischer Klagen, werden zu stillen Zeugen der Liebesbewegung. Die Frage, „wohin sie sich nun schwang“, spielt auf die Unsicherheit über das Schicksal der geliebten Person an – oder vielleicht auch auf den schwebenden Zustand der Liebe selbst.
Die dritte Strophe kulminiert in einer fast kosmischen Vereinigung von Natur und Gefühl. Der ganze Frühling beugt sich zum Sänger herab und vermischt sich mit dem „sehnsuchtsvollen Strome“ des Ichs. Das Bild des Sonnenuntergangs verleiht dem Moment eine goldene, vergeistigte Stimmung – der Tag neigt sich, aber etwas Bleibendes, Inneres wurde entzündet. Die Musik hat nicht nur verzaubert, sondern den Frühling selbst in den Seelenraum des Ichs gesogen.
Brentano gelingt mit diesem Gedicht ein feinfühliges Spiel aus Naturmetaphern, musikalischer Suggestion und emotionaler Wandlung. Das Lied wird zur Kraft, die nicht nur hört, sondern verwandelt, verbindet und in die Tiefe des eigenen Empfindens führt – ein typisches Motiv der Romantik, das hier in besonderer Schönheit zur Sprache kommt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.