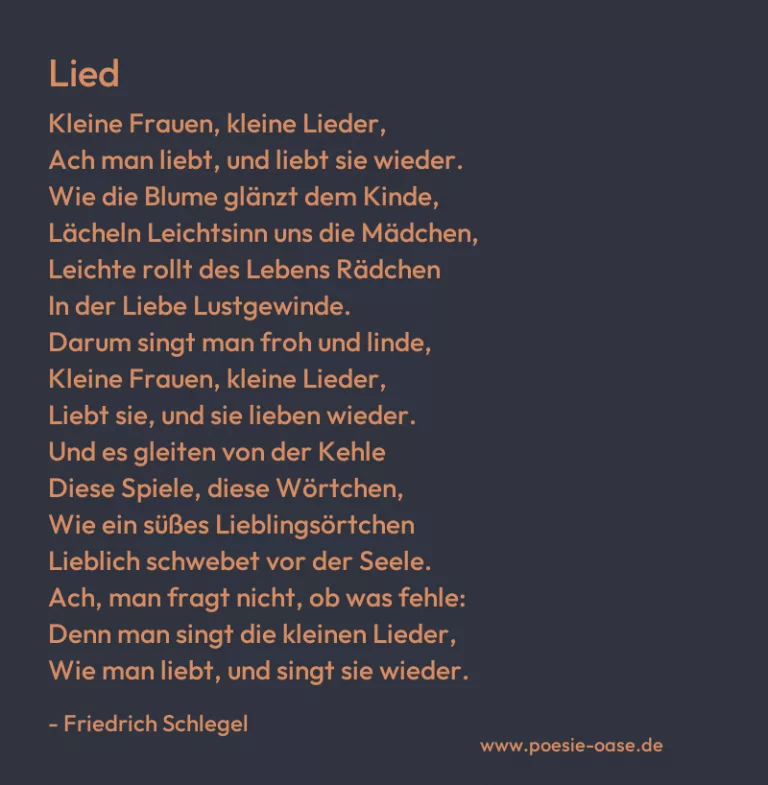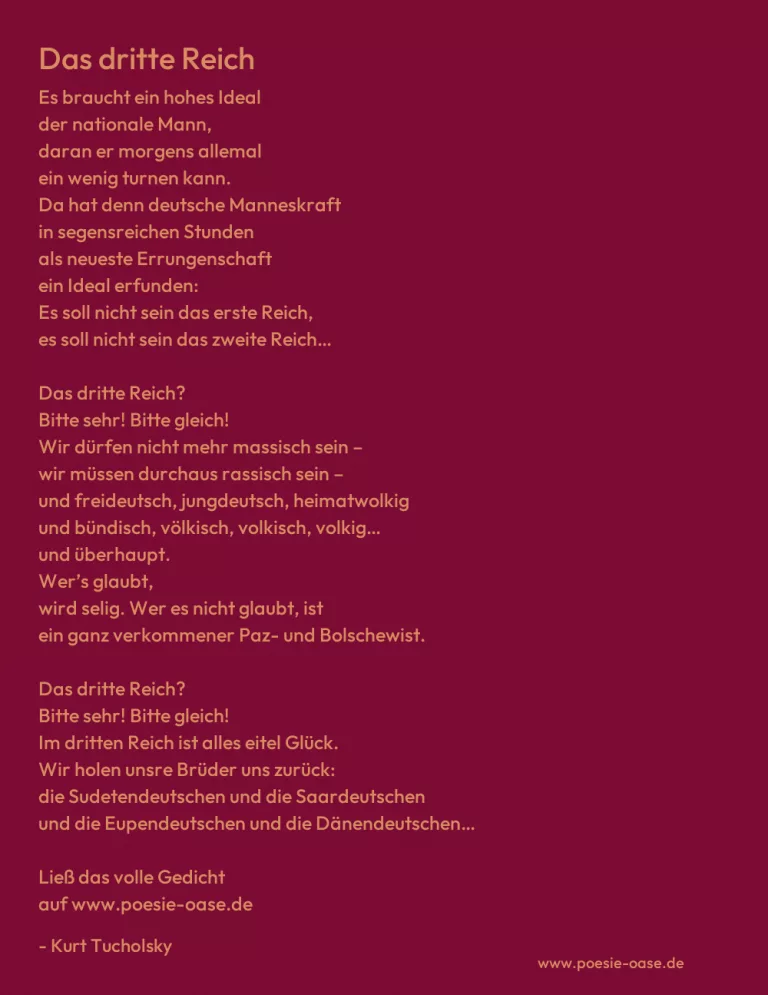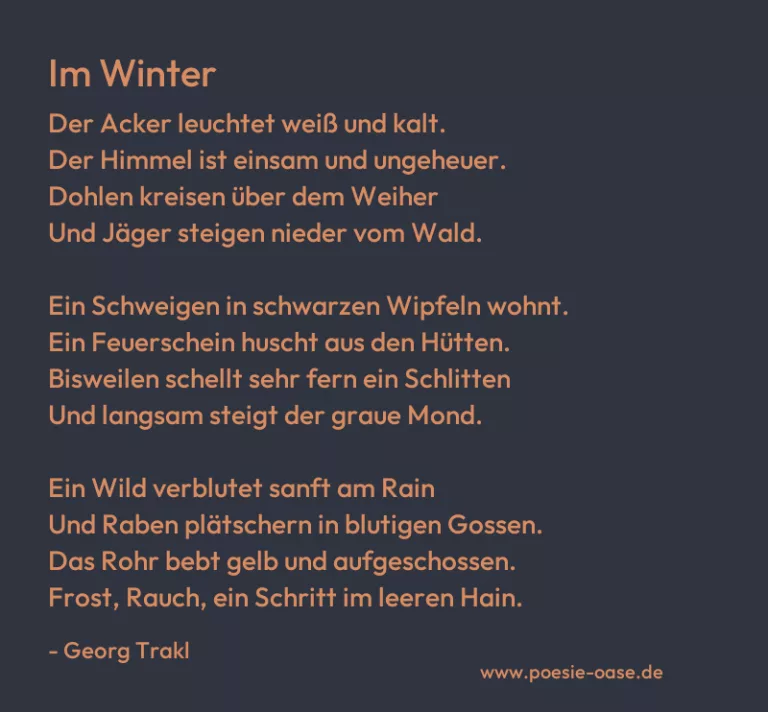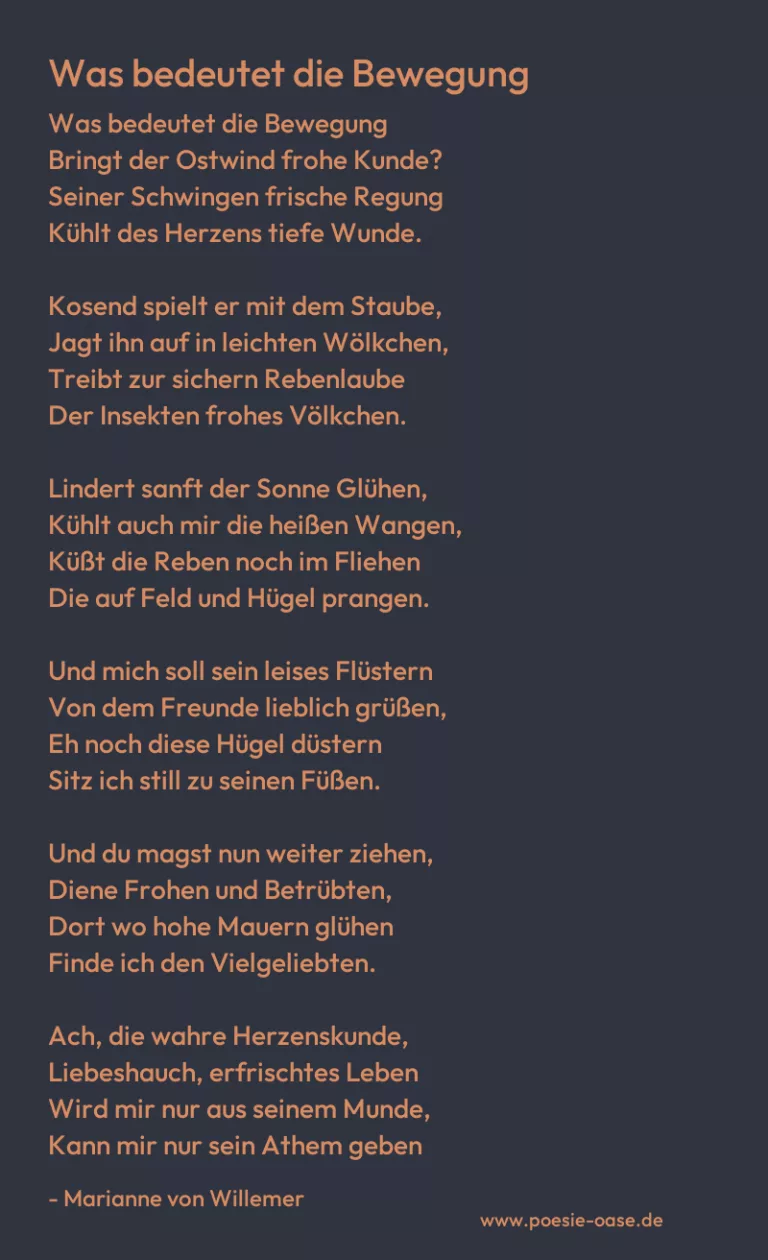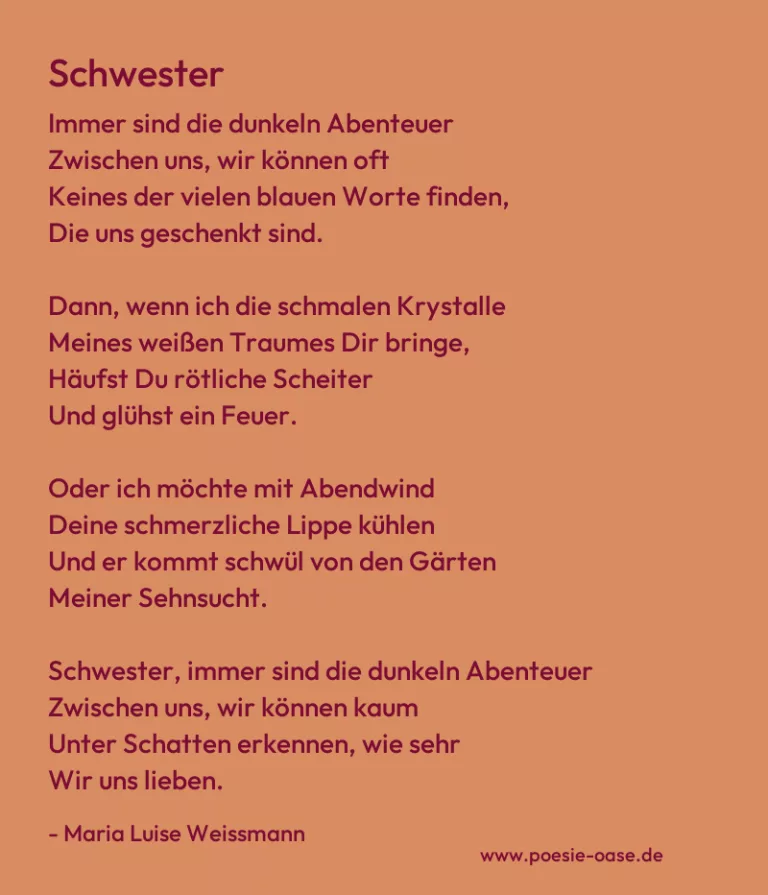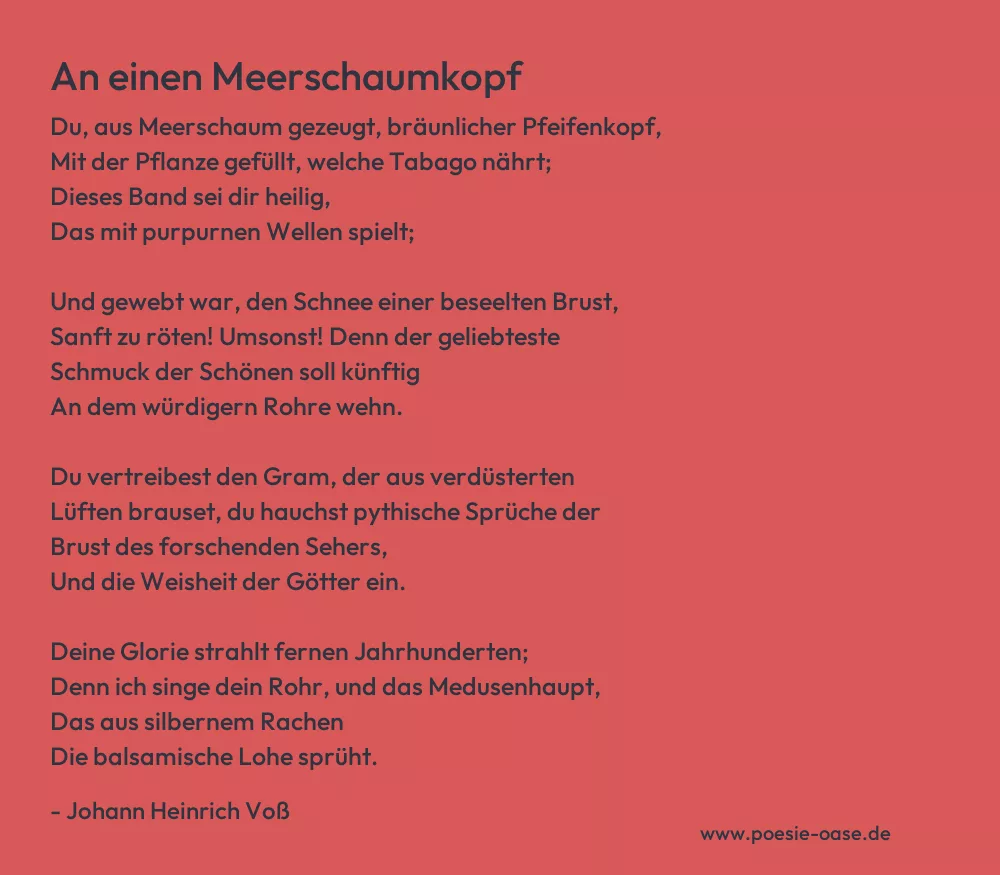An einen Meerschaumkopf
Du, aus Meerschaum gezeugt, bräunlicher Pfeifenkopf,
Mit der Pflanze gefüllt, welche Tabago nährt;
Dieses Band sei dir heilig,
Das mit purpurnen Wellen spielt;
Und gewebt war, den Schnee einer beseelten Brust,
Sanft zu röten! Umsonst! Denn der geliebteste
Schmuck der Schönen soll künftig
An dem würdigern Rohre wehn.
Du vertreibest den Gram, der aus verdüsterten
Lüften brauset, du hauchst pythische Sprüche der
Brust des forschenden Sehers,
Und die Weisheit der Götter ein.
Deine Glorie strahlt fernen Jahrhunderten;
Denn ich singe dein Rohr, und das Medusenhaupt,
Das aus silbernem Rachen
Die balsamische Lohe sprüht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
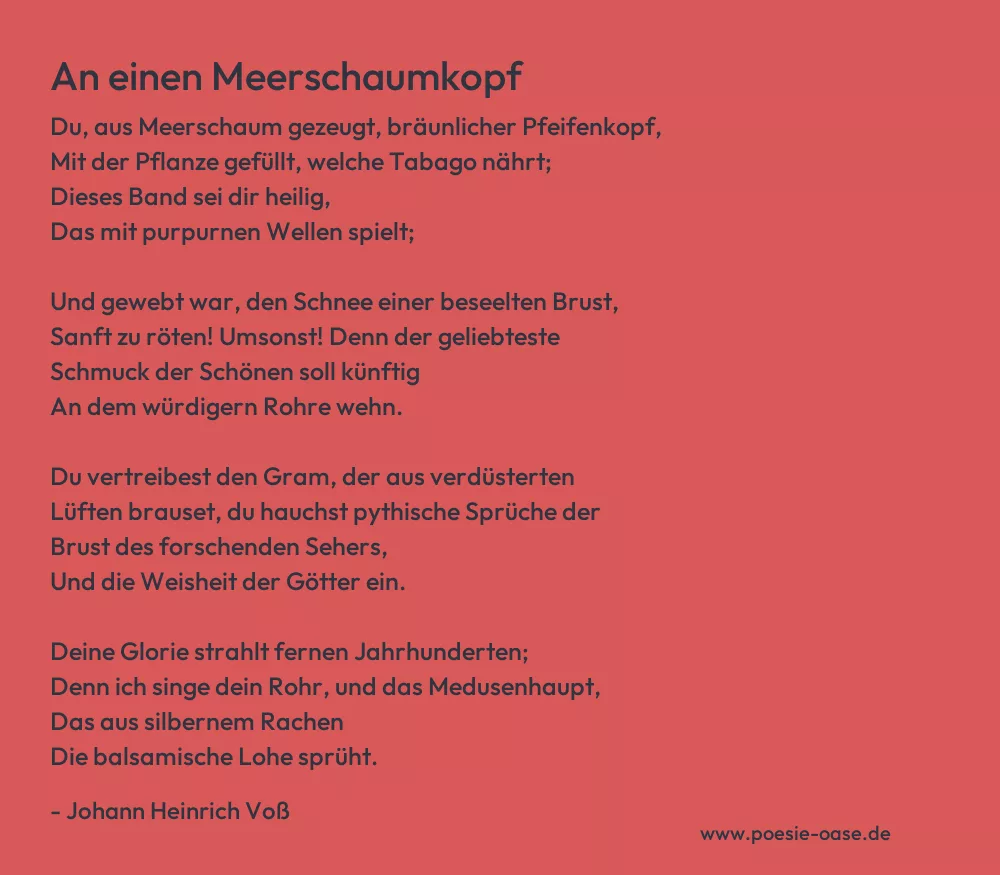
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An einen Meerschaumkopf“ von Johann Heinrich Voß ist eine poetische Hymne auf die symbolische Bedeutung des Meerschaumpfeifenkopfs, der als wertvolles und ehrenhaftes Objekt gepriesen wird. Zu Beginn wird der Pfeifenkopf, „aus Meerschaum gezeugt“, als ein edles und beinahe mystisches Werkzeug beschrieben, das mit Tabak, speziell „Tabago“, gefüllt ist. Das „Band“, das „mit purpurnen Wellen spielt“, stellt eine poetische Metaphorik für das Rauchvergnügen und den symbolischen Akt des Rauchens dar. Das Bild der „purpurnen Wellen“ könnte die spirituelle und verführerische Wirkung des Rauches darstellen, der sich wie ein unsichtbares Band zwischen der Materie und dem Geist webt.
Das Gedicht reflektiert über die Verbindung zwischen dem Meerschaumkopf und einem „sanft roten Schnee“ – möglicherweise eine Anspielung auf die Zärtlichkeit und den inneren Funken, der durch das Rauchen geweckt wird. Doch trotz dieser metaphorischen Schönheit wird die hohe Erwartung enttäuscht, als der „geliebteste Schmuck der Schönen“ „künftig an dem würdigeren Rohre wehen“ soll. Dies könnte auf die Entwicklung oder den Wandel von Kultobjekten hinweisen, die in der Vergangenheit von hohem Wert waren, aber schließlich von einer besseren oder mächtigeren Form ersetzt werden. Hier ist das Rohr also nicht nur ein simples Objekt, sondern ein Symbol für den Wandel und die fortwährende Suche nach dem Höheren und Erhabeneren.
Die folgende Strophe betont die positive und heilende Kraft des Rauchens, das „den Gram vertreibt“, der „aus verdüsterten Lüften brauset“. Der Pfeifenkopf ist hier nicht nur ein Genussmittel, sondern ein Mittel zur Befreiung von inneren Konflikten und Gedanken. Der „pythische Spruch“, der aus dem „Rohr“ kommt, verweist auf eine prophetische oder weise Kraft, die dem Pfeifenrauch innewohnt. Dies verstärkt die Assoziation des Pfeifenkopfs mit einer Art geheimem Wissen oder göttlicher Weisheit. Der Hinweis auf „die Weisheit der Götter“ lässt das Objekt des Gedichts zu einer Quelle der Erkenntnis und Erleuchtung werden.
Im letzten Abschnitt des Gedichts wird der Meerschaumkopf in einer fast epischen Weise verherrlicht. Die „Glorie“ des Pfeifenkopfs strahlt über „ferne Jahrhunderte“, was auf seine unsterbliche Bedeutung und den bleibenden Einfluss hinweist. Die Metapher des „Medusenhaupts“ und des „silbernen Rachens“, der die „balsamische Lohe sprüht“, verleiht dem Gedicht eine mystische und vielleicht sogar übernatürliche Dimension. Das Bild des Rauches als „balsamisch“ und heilsam steht in starkem Kontrast zu den dunklen, bedrohlichen Bildern von Medusa, was dem Gedicht eine tiefere, doppeldeutige Bedeutung verleiht – einerseits als Quelle der Weisheit und der Erhebung, andererseits auch als eine, die in den Mysterien der alten Welt und den Gefahren des Wissens verwurzelt ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.