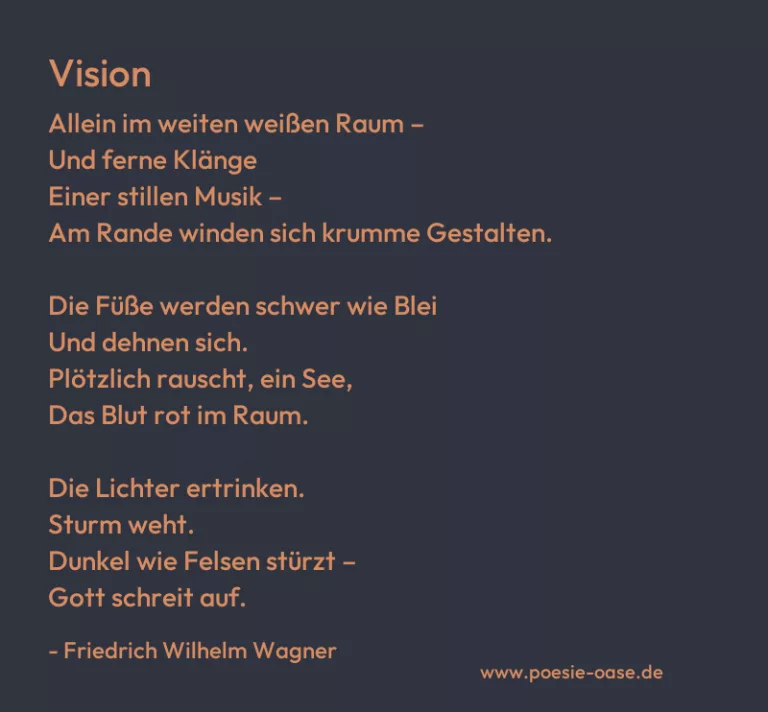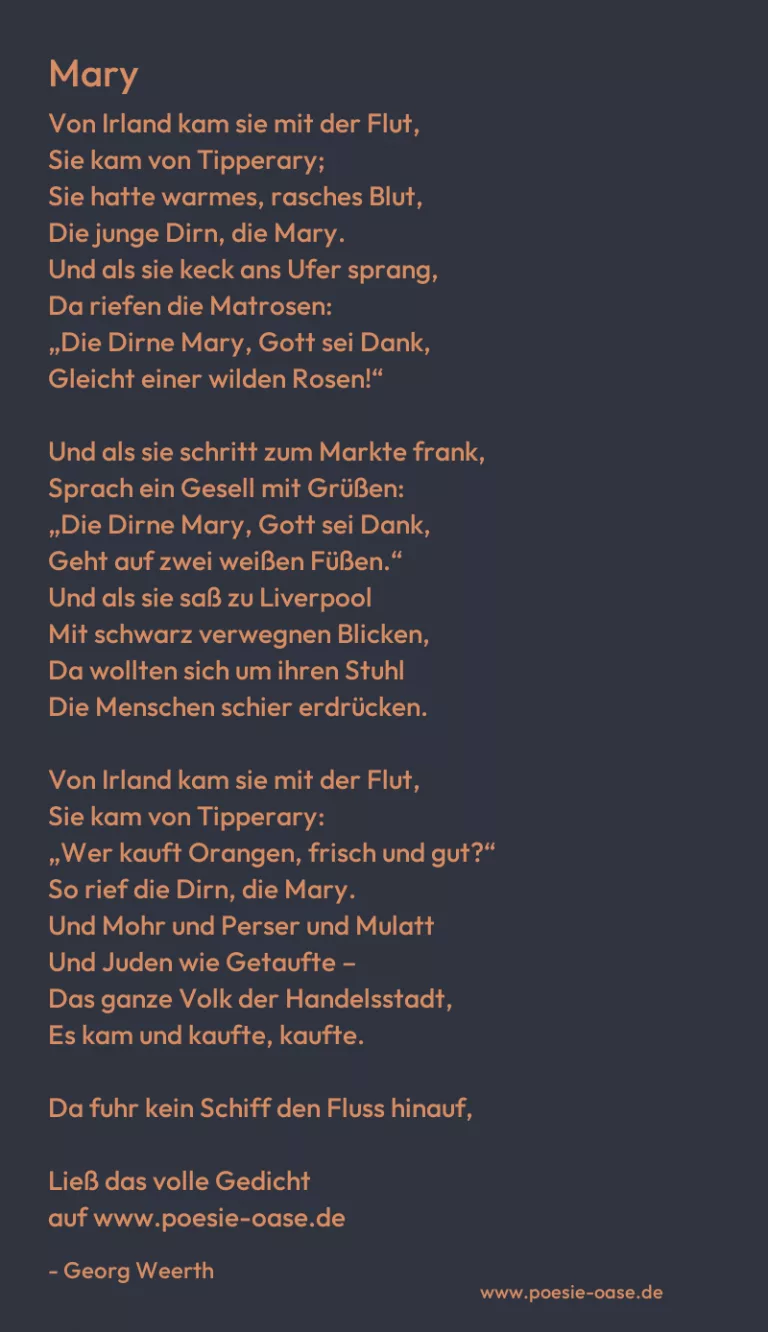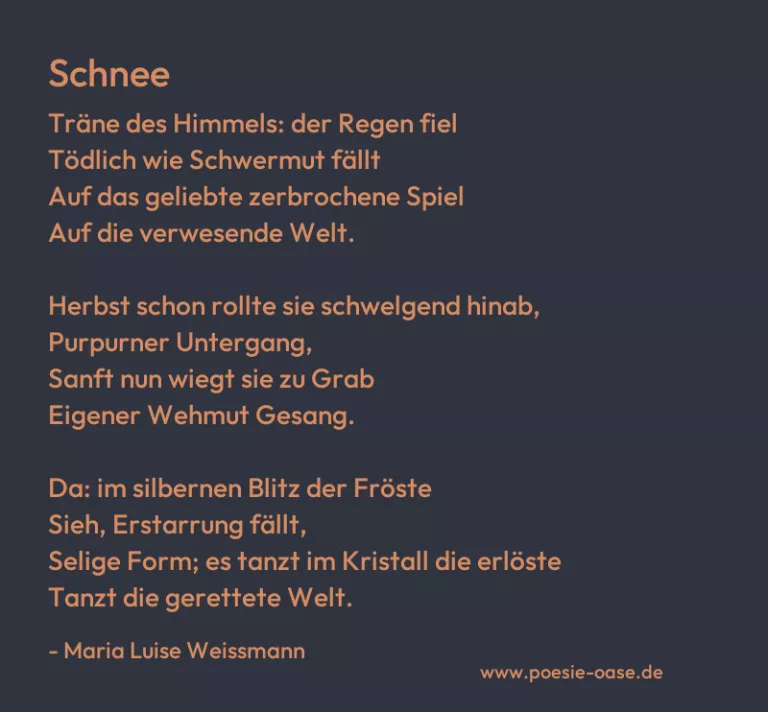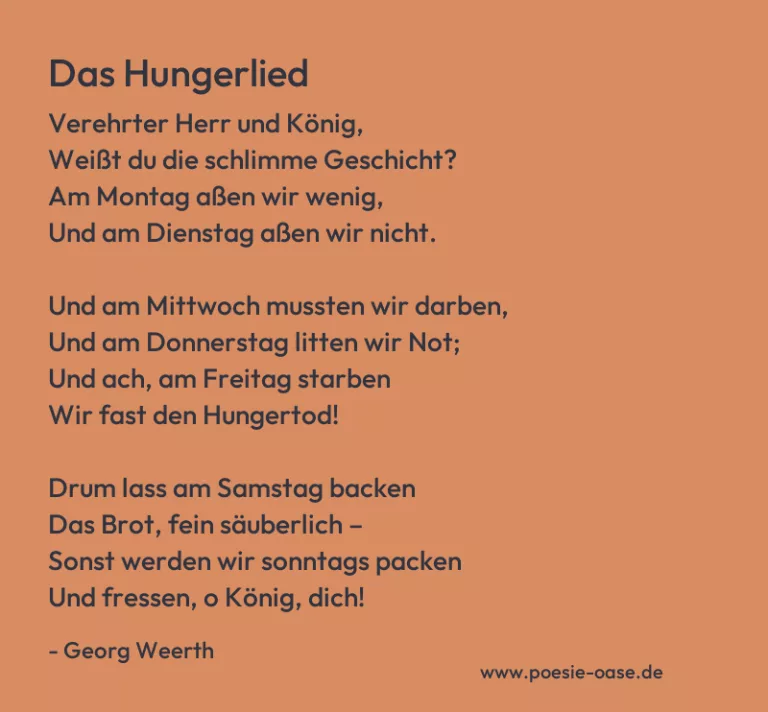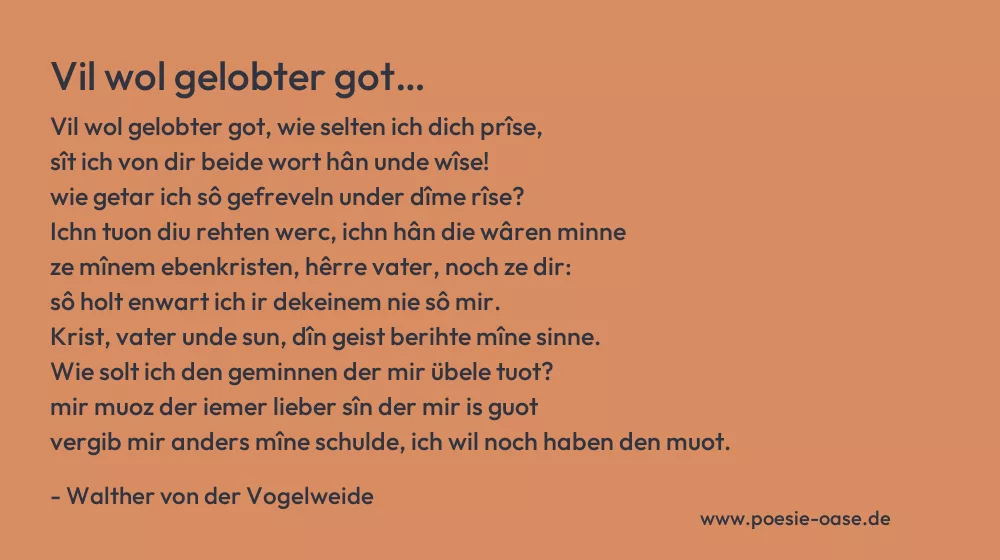Vil wol gelobter got…
Vil wol gelobter got, wie selten ich dich prîse,
sît ich von dir beide wort hân unde wîse!
wie getar ich sô gefreveln under dîme rîse?
Ichn tuon diu rehten werc, ichn hân die wâren minne
ze mînem ebenkristen, hêrre vater, noch ze dir:
sô holt enwart ich ir dekeinem nie sô mir.
Krist, vater unde sun, dîn geist berihte mîne sinne.
Wie solt ich den geminnen der mir übele tuot?
mir muoz der iemer lieber sîn der mir is guot
vergib mir anders mîne schulde, ich wil noch haben den muot.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
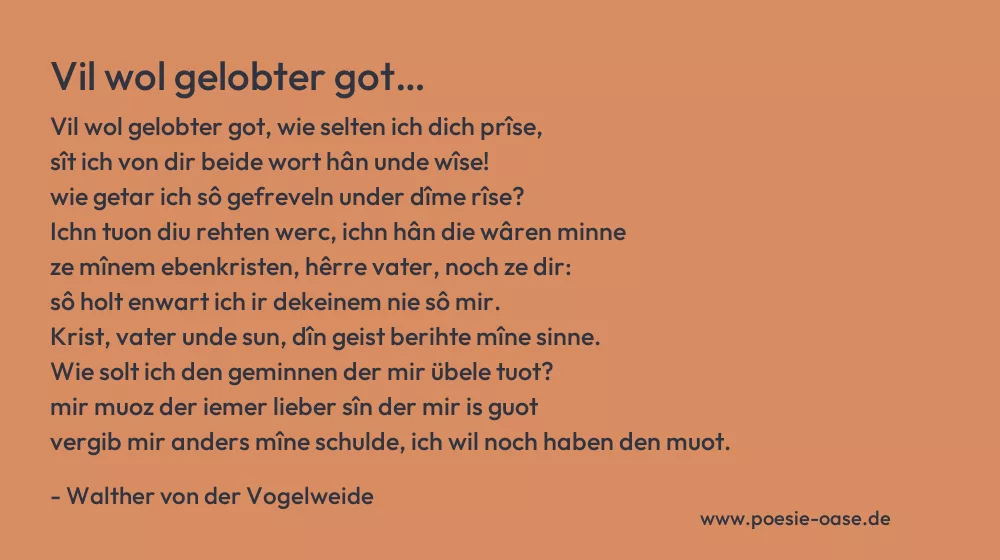
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Vil wol gelobter got…“ von Walther von der Vogelweide ist ein religiöses Loblied, das sich an Gott richtet und den Dichter in seiner demütigen Hingabe und Bitte um Vergebung zeigt. Zu Beginn des Gedichts spricht der Dichter von der Seltenheit, mit der er Gott lobt, und reflektiert darüber, dass er dies bislang eher zurückhaltend getan hat. Diese Selbsterkenntnis ist ein Moment der Reue, der in der gesamten Versform spürbar bleibt. Die Frage nach der „Gefräveln unter dîme rîse“ (also dem Fehlverhalten unter Gottes Huldigung) deutet darauf hin, dass der Dichter sich seiner Fehler und seines nicht immer gerechten Lebens bewusst ist.
Die direkte Ansprache an Gott als „Krist, vater unde sun“ und die Bitte um Hilfe – dass der „geist“ Gottes seine Sinne erleuchten möge – ist ein starkes Zeichen des Glaubens und der Hoffnung auf göttliche Führung. Der Dichter bekennt sich zu seiner Zuneigung und Treue zu Gott und spricht von der „wâren minne“ (wahren Liebe), die er zu Gott empfindet. Diese Worte stehen im Kontrast zur eigenen Schuld und den inneren Zweifeln, die der Dichter zu überwinden sucht. Die Tatsache, dass er sich die göttliche Führung erhofft, lässt auf eine tiefe religiöse Besinnung schließen, die gleichzeitig die menschliche Schwäche und die Notwendigkeit der göttlichen Gnade anerkennt.
Die poetische Struktur des Gedichts trägt zur Wirkung bei, indem sie den Dialog mit Gott aufrechterhält und dabei eine Atmosphäre von Intimität und Hingabe schafft. Das Fehlen von Künstlichkeit in der Sprache und die Bescheidenheit des Bittens verstärken die Ehrlichkeit des Dichters. Die Bitte um Vergebung und die Forderung nach einem „guten“ Gott, der den Gläubigen leitet und von Übel fernhält, weist auf eine grundlegende Thematik der mittelalterlichen Literatur hin, in der der Mensch als Sünder vor Gott tritt und gleichzeitig auf göttliche Hilfe angewiesen ist.
Abschließend kann man sagen, dass Walther von der Vogelweide in diesem Gedicht die menschliche Unvollkommenheit und die Suche nach göttlicher Vergebung thematisiert. Es spiegelt sowohl die Frömmigkeit des mittelalterlichen Menschen wider als auch die tief empfundene Bitte um Gnade, die dem tiefen Glauben und der Demut des lyrischen Ichs entspricht. Das Gedicht fordert die Leser auf, sich ihrer eigenen Fehler bewusst zu werden und die göttliche Gnade als Quelle von Trost und Führung anzunehmen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.