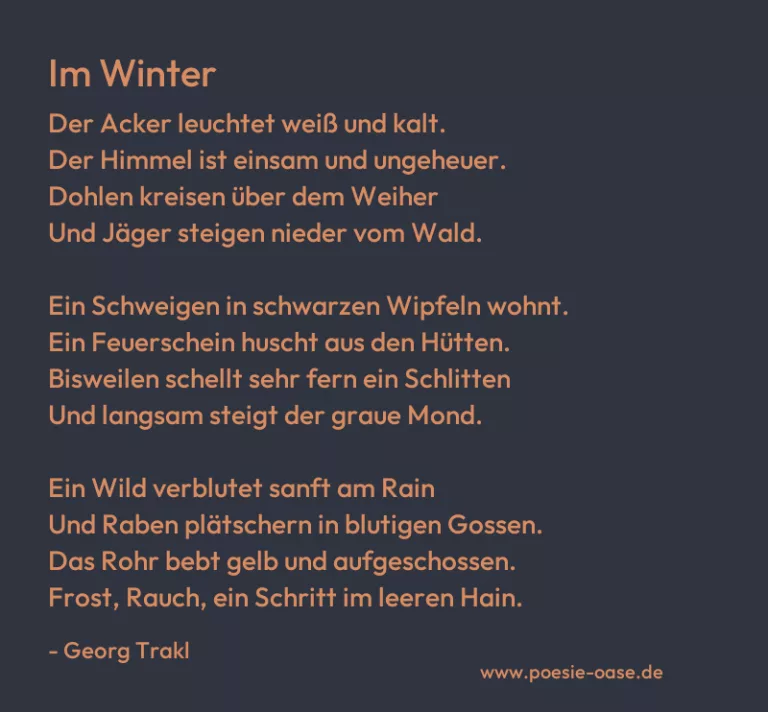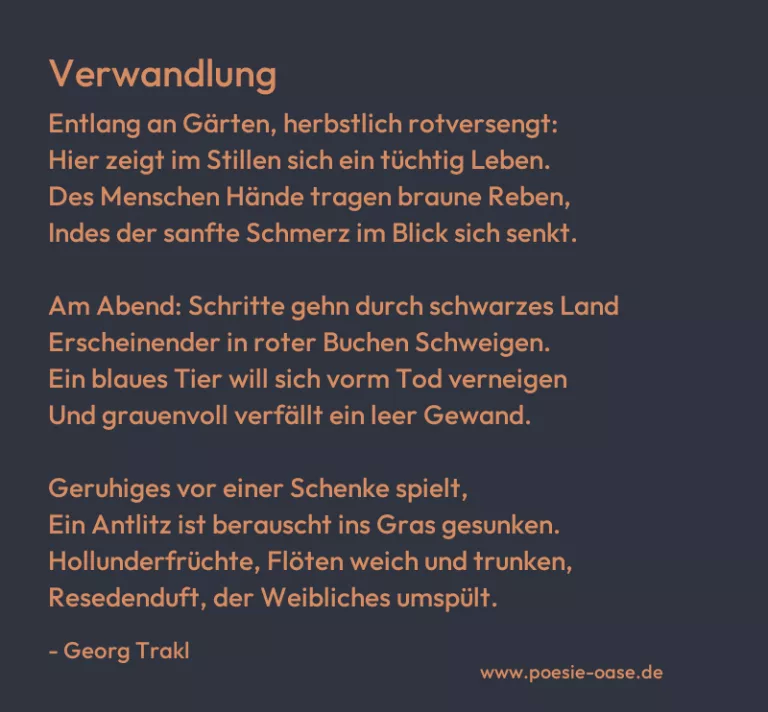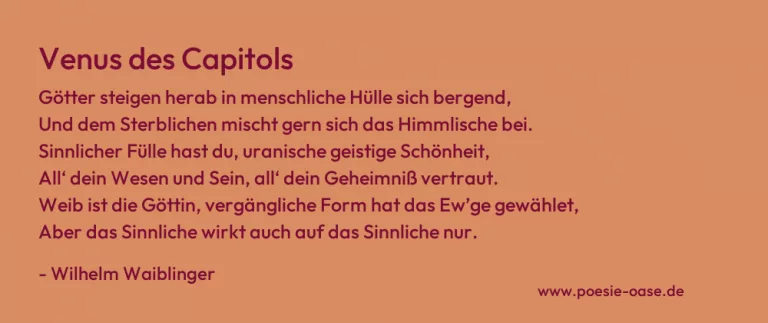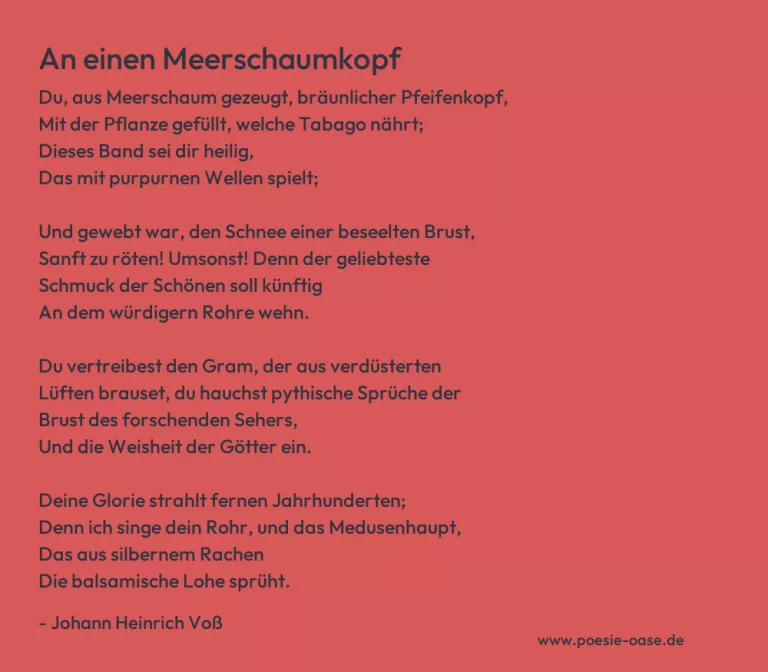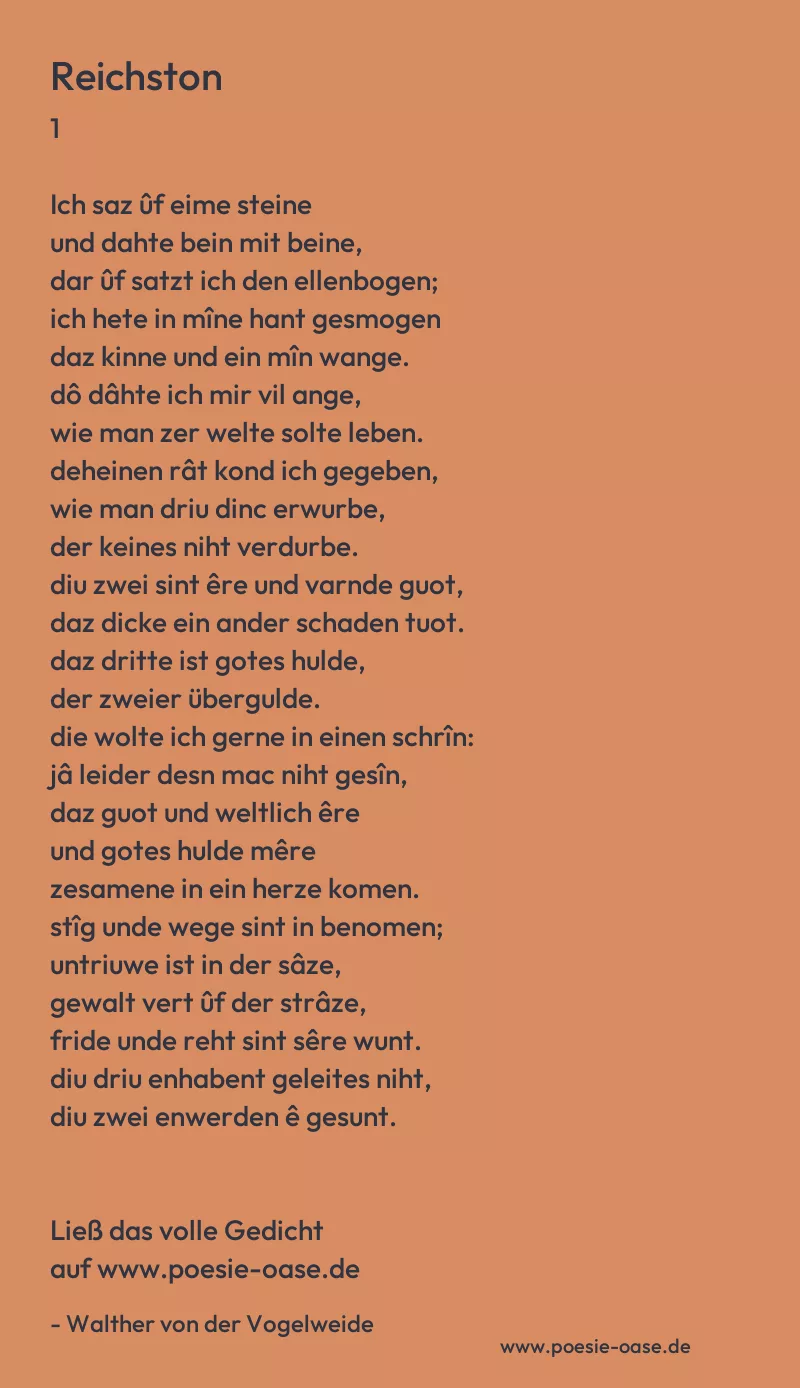Reichston
1
Ich saz ûf eime steine
und dahte bein mit beine,
dar ûf satzt ich den ellenbogen;
ich hete in mîne hant gesmogen
daz kinne und ein mîn wange.
dô dâhte ich mir vil ange,
wie man zer welte solte leben.
deheinen rât kond ich gegeben,
wie man driu dinc erwurbe,
der keines niht verdurbe.
diu zwei sint êre und varnde guot,
daz dicke ein ander schaden tuot.
daz dritte ist gotes hulde,
der zweier übergulde.
die wolte ich gerne in einen schrîn:
jâ leider desn mac niht gesîn,
daz guot und weltlich êre
und gotes hulde mêre
zesamene in ein herze komen.
stîg unde wege sint in benomen;
untriuwe ist in der sâze,
gewalt vert ûf der strâze,
fride unde reht sint sêre wunt.
diu driu enhabent geleites niht,
diu zwei enwerden ê gesunt.
2
Ich hôrte ein wazzer diezen
und sach die vische fliezen,
ich sach swaz in der welte was,
velt, walt, loup, rôr unde gras.
swaz kriuchet unde fliuget
und bein zer erde biuget,
daz sach ich, unde sage iu daz:
der keinez lebet âne haz.
daz wilt und daz gewürme
die strîtent starke stürme,
sam tuont die vogel under in,
wan daz si habent einen sin:
si dûhten sich ze nihte,
si enschüefen starc gerihte.
si kiesent künege unde reht,
si setzent hêrren unde kneht.
sô wê dir, tiuschiu zunge,
wie stêt dîn ordenunge!
daz nû diu mugge ir künec hât,
und daz dîn êre alsô zergât!
bekêrâ dich, bekêre,
die cirkel sint ze hêre,
die armen künege dringent dich.
Philippe setze den weisen ûf,
und heiz si treten hinder sich!
3
Ich sach mit mînen ougen
mann unde wîbe tougen,
daz ich gehôrte und gesach
swaz iemen tet, swaz iemen sprach.
ze Rôme hôrte ich liegen
und zwêne künege triegen.
dâ von huop sich der meiste strît
der ê was oder iemer sît,
dô sich begunden zweien
die pfaffen unde leien.
daz was ein nôt vor aller nôt,
lîp unde sêle lac dô tôt.
die pfaffen striten sêre,
doch wart der leien mêre.
diu swert diu leiten si dernider
und griffen zuo der stôle wider:
si bienen die si wolten
und niht den si solten.
dô stôrte man diu goteshûs.
ich hôrte verre in einer klûs
vil michel ungebære;
dâ weinte ein klôsenære,
er klagete gote siniu leit:
„Owê der bâbest ist ze junc;
hilf, hêrre, dîner kristenheit!“
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
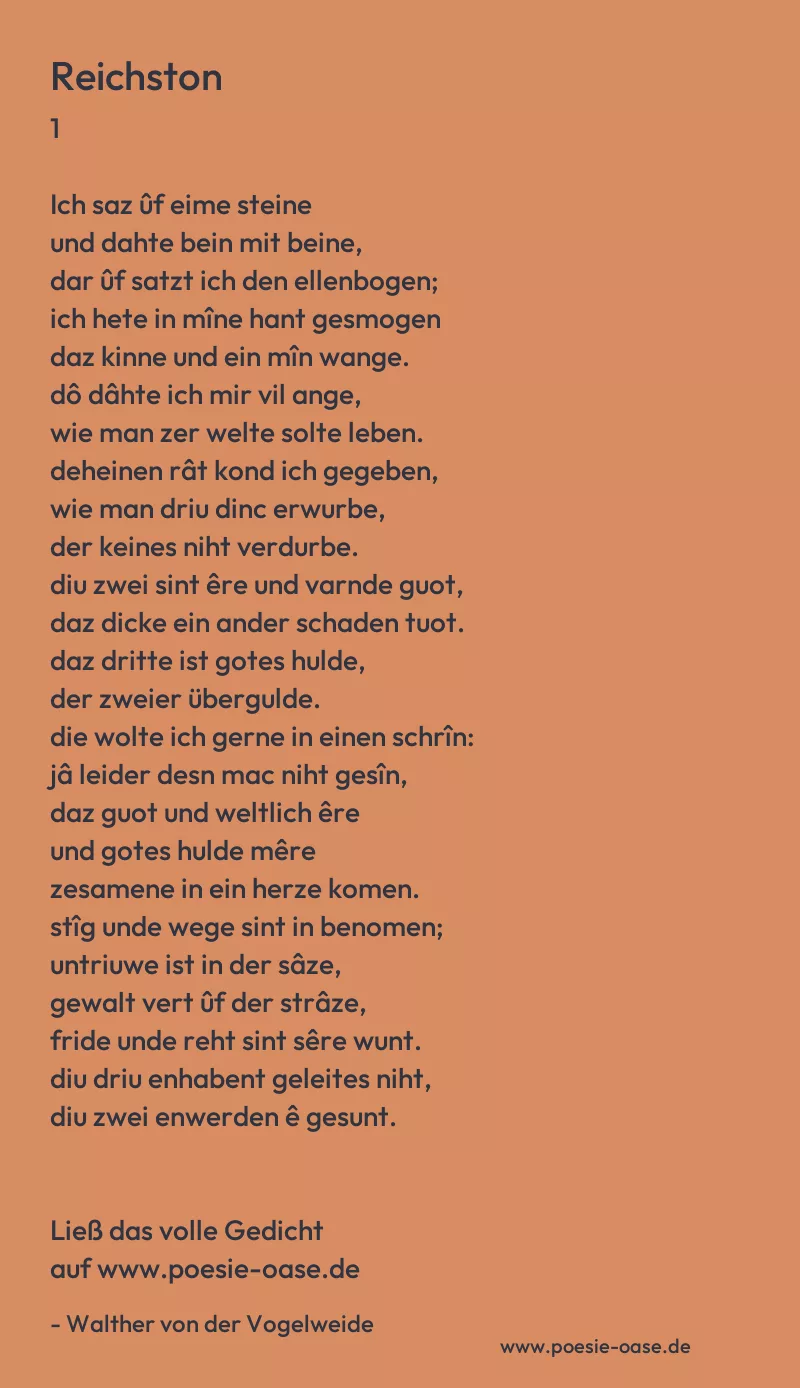
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Reichston“ von Walther von der Vogelweide ist ein dreiteiliges, formal kunstvoll komponiertes Werk, das sowohl persönliche Reflexion als auch politische und gesellschaftliche Anklage in sich vereint. Es zählt zu seinen sogenannten „Reichssprüchen“ – politischen Liedern, in denen Walther nicht mehr den Liebesdichter gibt, sondern als moralkritischer Mahner und scharfer Beobachter des Zeitgeschehens auftritt. Der Titel verweist auf den „Ton“ oder die Melodie, in der das Gedicht gesungen wurde, betont aber auch programmatisch die Reichs- und Weltordnung, um die es hier geht.
Im ersten Teil beginnt Walther in ruhiger, meditativer Haltung: Er sitzt „ûf eime steine“ und denkt nach – eine Szene der Selbstversenkung. Der poetische Ich-Zustand erinnert an philosophische Kontemplation. Das zentrale Problem, das ihn beschäftigt, ist die Unvereinbarkeit von drei Werten: êre (Ehre), varnde guot (Besitz, Reichtum) und gotes hulde (göttliche Gnade). Diese drei scheinen sich gegenseitig auszuschließen; wer weltliche Ehre und Reichtum erlangt, verliert oft Gottes Gnade. Diese existenzielle Zerrissenheit reflektiert die tiefe moralische Krise seiner Zeit. In der Bildlichkeit des verschlossenen „schrîn“ (Schrein) kommt zum Ausdruck, dass das wahre, harmonische Leben – in dem alle drei Güter vereinigt wären – in der Welt nicht erreichbar ist.
Der zweite Teil weitet den Blick auf die Natur. Walther beschreibt in dichterischer Klarheit Wasser, Tiere, Pflanzen – und konstatiert: überall herrscht Kampf. Selbst Tiere leben nicht ohne Hass. Doch im Gegensatz zum Menschen scheinen sie zumindest eine Ordnung zu kennen: „si dûhten sich ze nihte, / si enschüefen starc gerihte“. Tiere ordnen sich, folgen Instinkten, wählen Führer – während der Mensch, insbesondere der „tiuschiu zunge“ (die deutsche Kultur), seine Ordnung verliert. Die Schärfe des Urteils gipfelt in der Anklage: „daz nû diu mugge ir künec hât, / und daz dîn êre alsô zergât!“ – ein drastisches Bild für den Niedergang höfischer und gesellschaftlicher Werte. Der Appell an Philipp von Schwaben, er solle „die Weisen“ nach vorn setzen, ist ein konkreter politischer Ruf zur Vernunft und zur Rückkehr zu gerechter Herrschaft.
Im dritten Teil wird Walther noch deutlicher politisch und zeitkritisch. Er prangert die Lüge und den Machtmissbrauch in Rom an, spricht von „zwêne künege“ (dem Thronstreit zwischen Philipp von Schwaben und Otto IV.) und vom Streit zwischen Geistlichkeit und Laien – ein Konflikt, der das Reich tief spaltete. Besonders heftig fällt die Kritik an der Geistlichkeit aus: Die Pfaffen, so Walther, streiten nicht nur, sondern streben selbst nach weltlicher Macht, reißen das Schwert an sich und vernachlässigen ihre geistliche Aufgabe. Das Bild des weinenden Klosterbruders, der um Hilfe für die Christenheit bittet, schließt das Gedicht mit einer Mischung aus religiöser Klage und politischer Ohnmacht.
„Reichston“ ist ein kraftvolles Dokument mittelalterlicher Gesellschaftskritik. Walther gelingt es, persönliche Weltsicht, Naturbeobachtung und politische Anklage in dichterischer Form zu verbinden. Seine Sprache ist klar, rhythmisch und von hoher moralischer Dringlichkeit. Das Gedicht ist nicht nur Ausdruck der politischen Wirren seiner Zeit, sondern auch ein frühes Beispiel für engagierte Literatur, die moralische Verantwortung gegenüber der Welt einfordert.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.