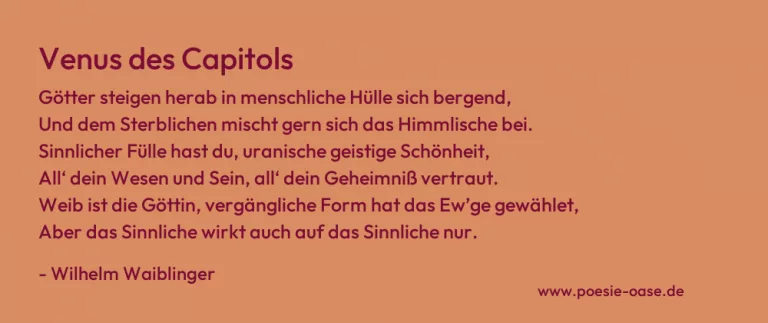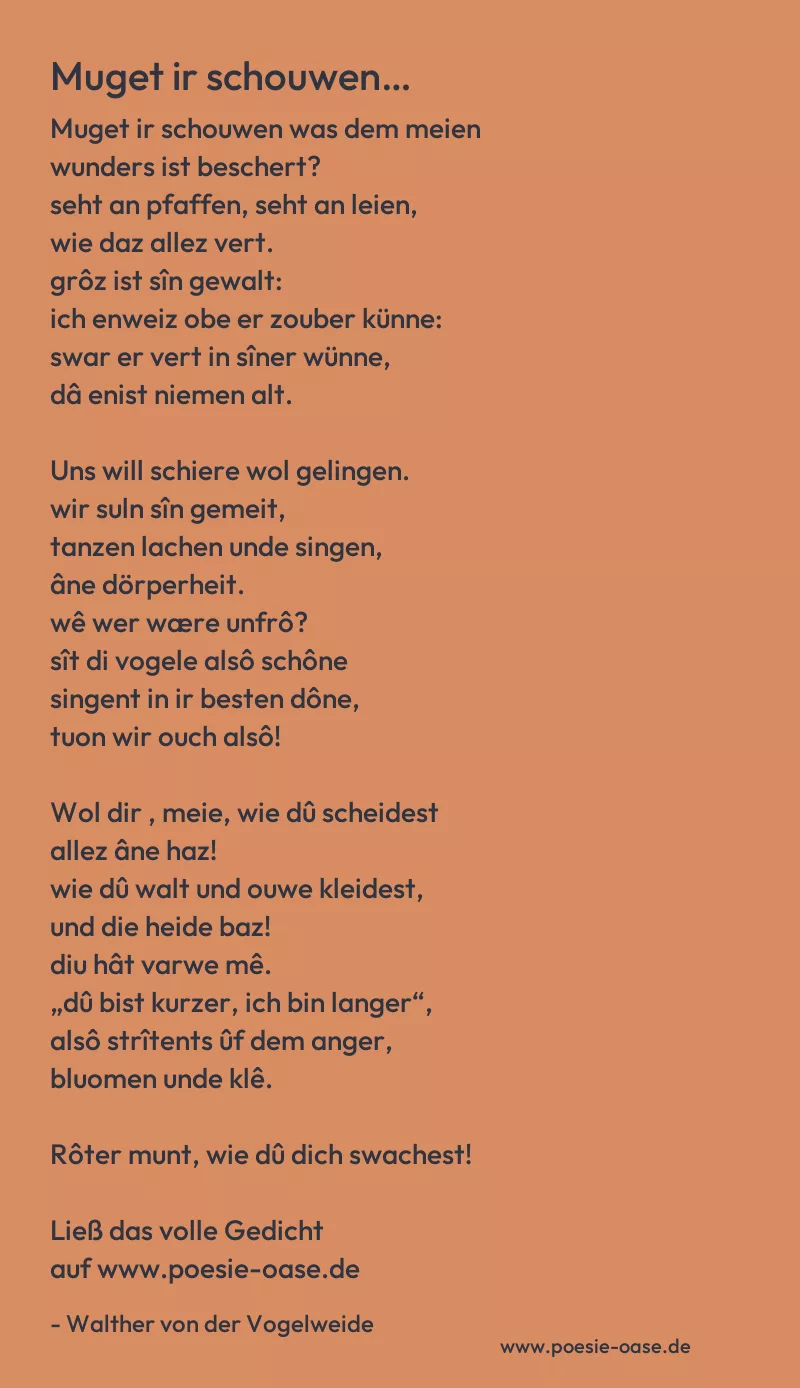Muget ir schouwen…
Muget ir schouwen was dem meien
wunders ist beschert?
seht an pfaffen, seht an leien,
wie daz allez vert.
grôz ist sîn gewalt:
ich enweiz obe er zouber künne:
swar er vert in sîner wünne,
dâ enist niemen alt.
Uns will schiere wol gelingen.
wir suln sîn gemeit,
tanzen lachen unde singen,
âne dörperheit.
wê wer wære unfrô?
sît di vogele alsô schône
singent in ir besten dône,
tuon wir ouch alsô!
Wol dir , meie, wie dû scheidest
allez âne haz!
wie dû walt und ouwe kleidest,
und die heide baz!
diu hât varwe mê.
„dû bist kurzer, ich bin langer“,
alsô strîtents ûf dem anger,
bluomen unde klê.
Rôter munt, wie dû dich swachest!
lâ dîn lachen sîn.
scham dich daz dû mich an lachest
nâch dem schaden mîn.
ist daz wol getân?
owê sô verlorner stunde,
sol von minneclîchem munde
solch unminne ergân!
Daz mich, frouwe, an fröiden irret,
daz ist iuwer lîp.
an iu einer ez mir wirret,
ungenædic wîp.
wâ nemt ir den muot?
ir sît doch genâden rîche:
tuot ir mir ungnædeclîche,
sô sît ir niht guot.
Scheidet, vrouwe, mich von sorgen,
liebet mir die zît:
oder ich muoz an vreuden borgen.
daz ir sælic sît!
muget ir umbe sehen?
sich vreut al diu welt gemeine;
möhte mir von iu ein kleine
vreudelîn geschehen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
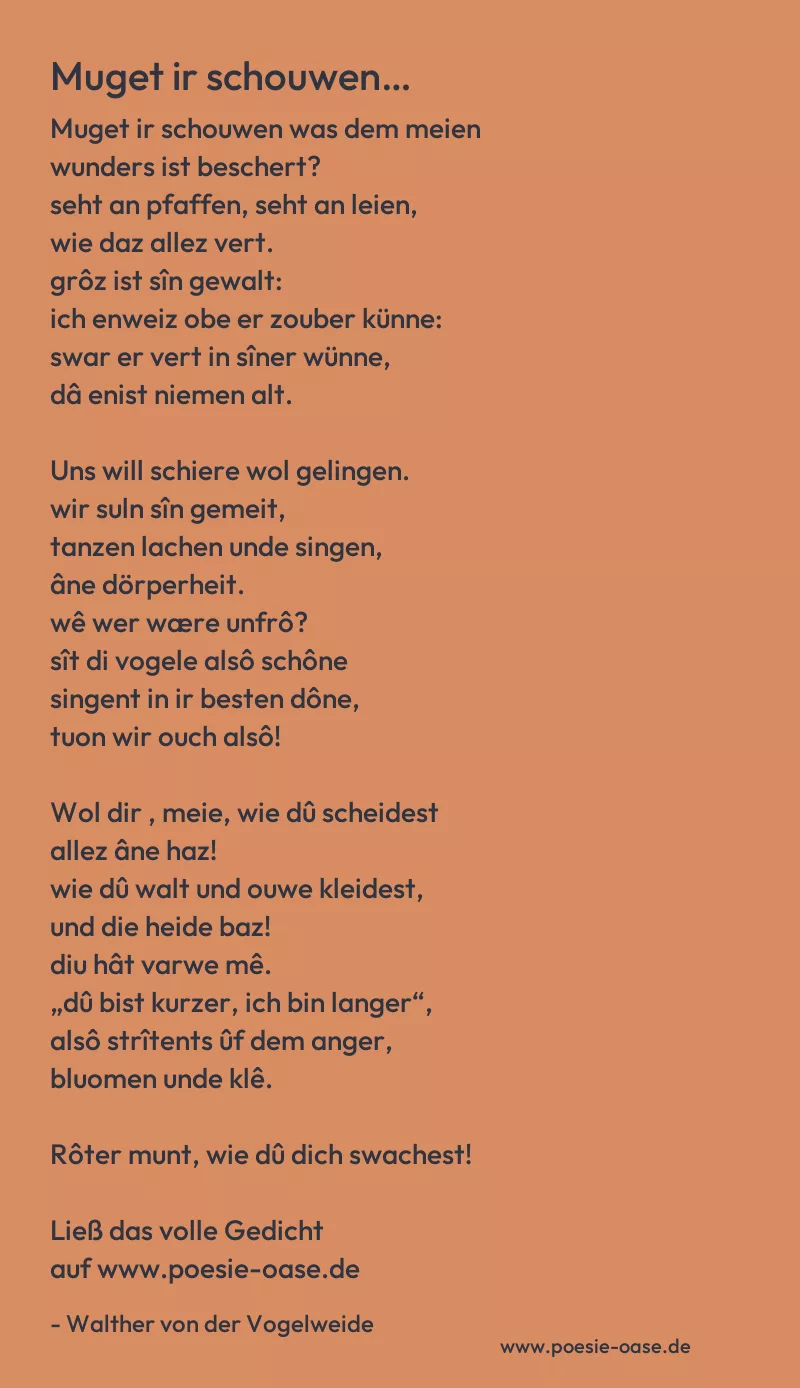
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Muget ir schouwen…“ von Walther von der Vogelweide beginnt als enthusiastisches Frühlingslied, entwickelt sich jedoch rasch zu einer Klage über unerwiderte Liebe. In eindrucksvoller Weise verbindet Walther die äußere Pracht des Monats Mai mit der inneren Gefühlslage des lyrischen Ichs – ein Wechselspiel von Naturfreude und persönlichem Schmerz, das typisch für seine Minnelyrik ist.
Der erste Teil des Gedichts widmet sich dem Staunen über die Macht des Mai: „Muget ir schouwen was dem meien / wunders ist beschert?“ Der Mai wird als beinahe magisch beschrieben, seine belebende Kraft ist so groß, dass sich niemand alt fühlt, wenn er erscheint. Mensch und Natur scheinen sich gleichermaßen dem Frohsinn hinzugeben – Pfaffen und Laien, Vögel und Blumen. Die fröhliche Stimmung soll zum Tanzen, Lachen und Singen anregen – jedoch „âne dörperheit“, also in höfischer, gesitteter Weise.
In der dritten Strophe steigert sich das Naturbild zu einem fast märchenhaften Streit der Blumen auf der Wiese: Wer ist schöner, wer farbenprächtiger – „du bist kurzer, ich bin langer“, sagen sie. Der Mai ist hier eine versöhnende Macht, die Hass vertreibt und die Welt in Farben kleidet. Diese äußere Harmonie steht in scharfem Kontrast zur inneren Unruhe des lyrischen Ichs, die in den folgenden Strophen offenbart wird.
Die vierte Strophe markiert den Wendepunkt: Der Sprecher spricht nun direkt eine Frau an, die ihn auslacht – trotz seines „Schadens“, seines Liebesschmerzes. Der rote Mund, Symbol der Schönheit und Sinnlichkeit, bringt keine Minne, sondern Kränkung. Der Kontrast zwischen äußerer Anmut und innerer Härte wird hier scharf gezeichnet. Die Anklage wird im weiteren Verlauf noch direkter: Die Frau sei „ungenædic“, obwohl sie über Gnade verfüge. Wer diese Gnade nicht gewährt, ist – so das moralische Urteil des Sprechers – auch nicht wirklich gut.
Die letzte Strophe bringt eine resignative Bitte: Die Frau möge ihn von seinem Kummer befreien oder ihm wenigstens ein kleines Zeichen der Freude schenken. Während die ganze Welt sich dem Frühling hingibt, bleibt er ausgeschlossen – seine Freude ist geborgt, nicht echt. Damit endet das Gedicht in einem typischen Motiv der Minne: die Diskrepanz zwischen der Schönheit der Natur und dem Leiden des Liebenden. Walther gelingt es hier meisterhaft, die Stimmung des Frühlings nicht nur als Kulisse, sondern als Kontrastfolie für das innere Erleben des lyrischen Ichs einzusetzen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.