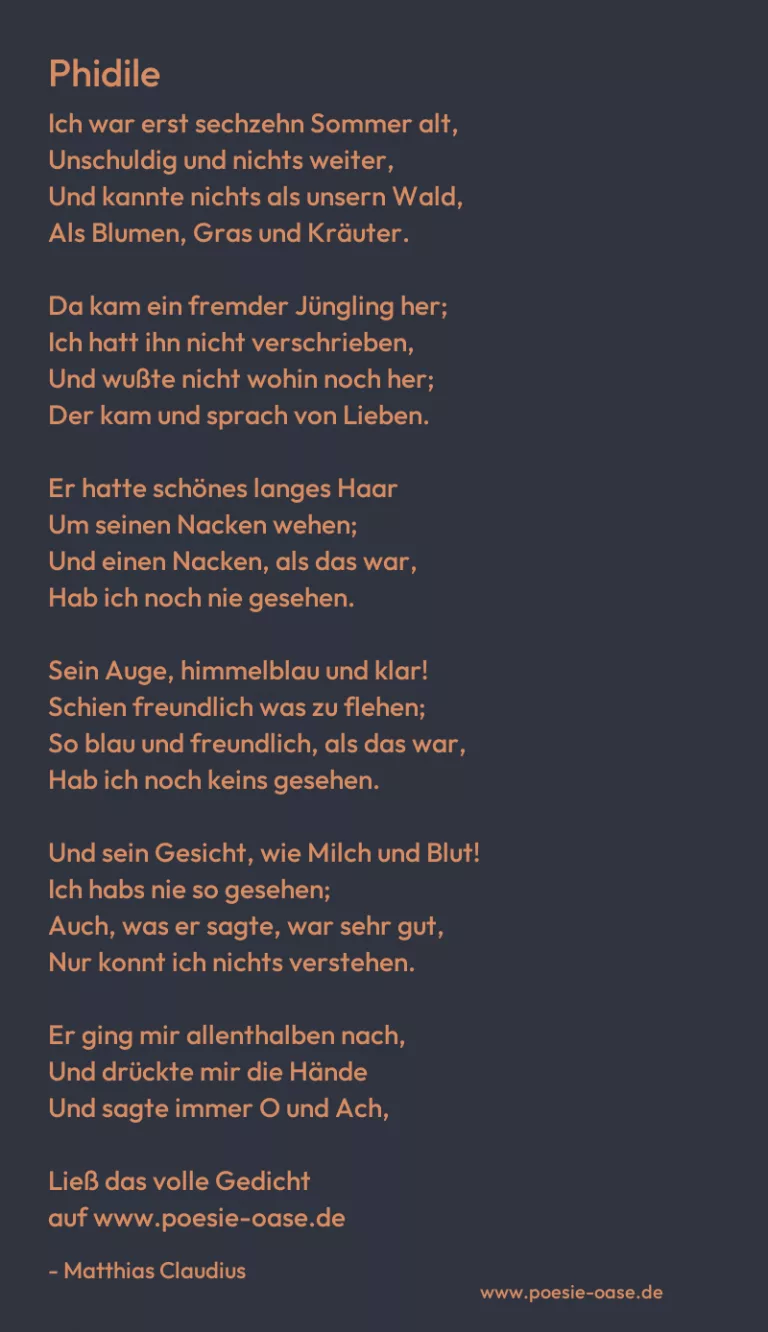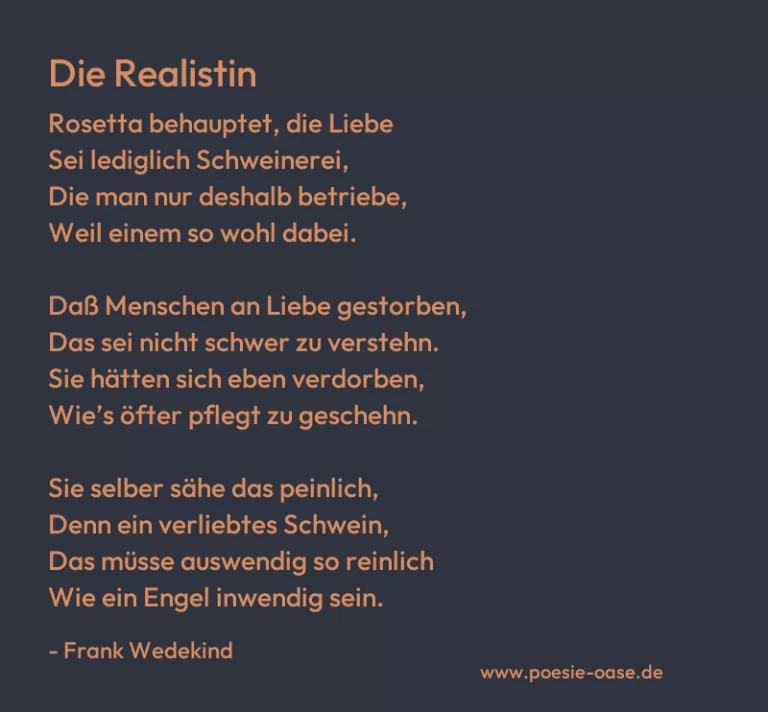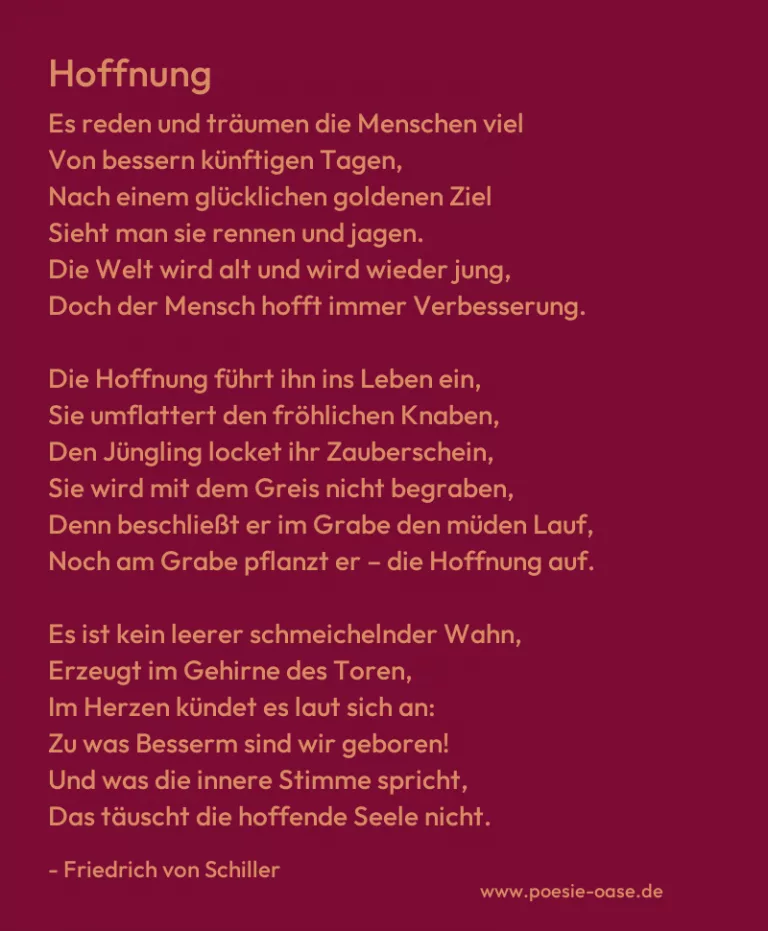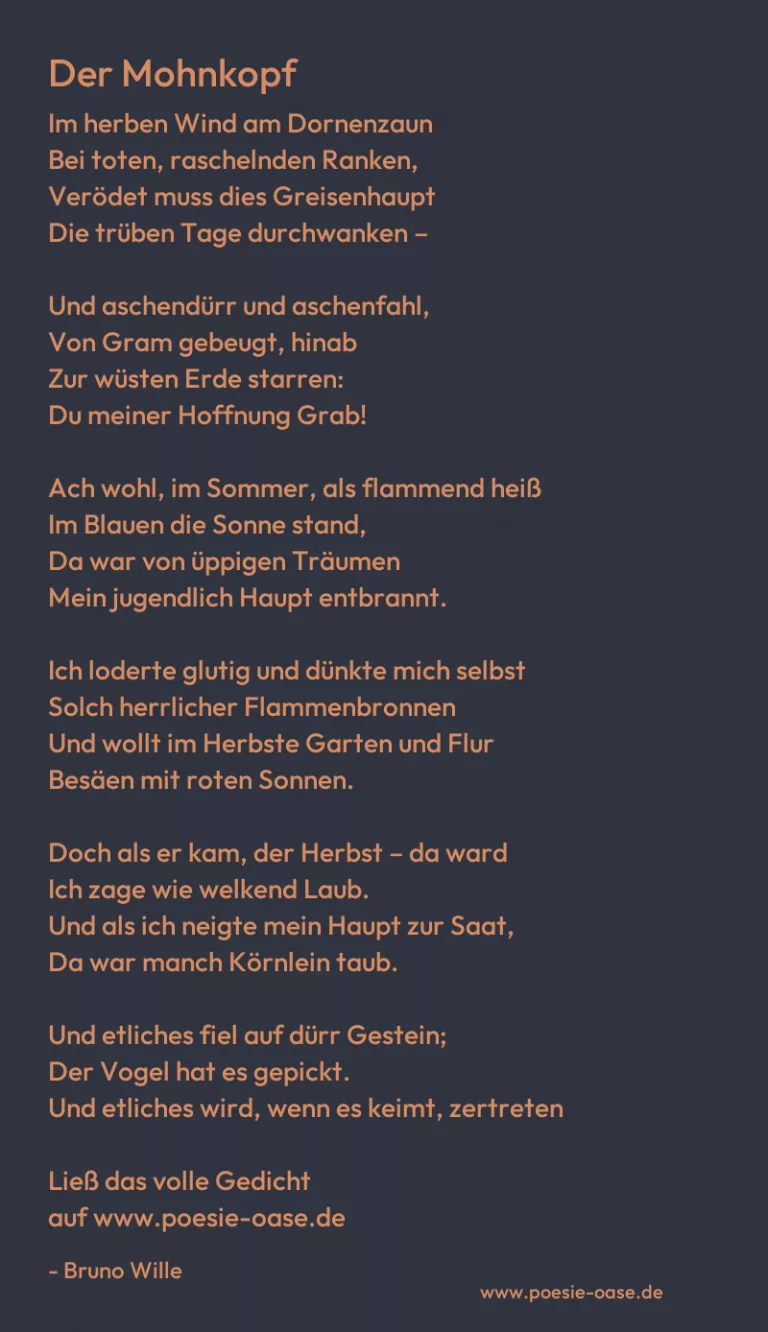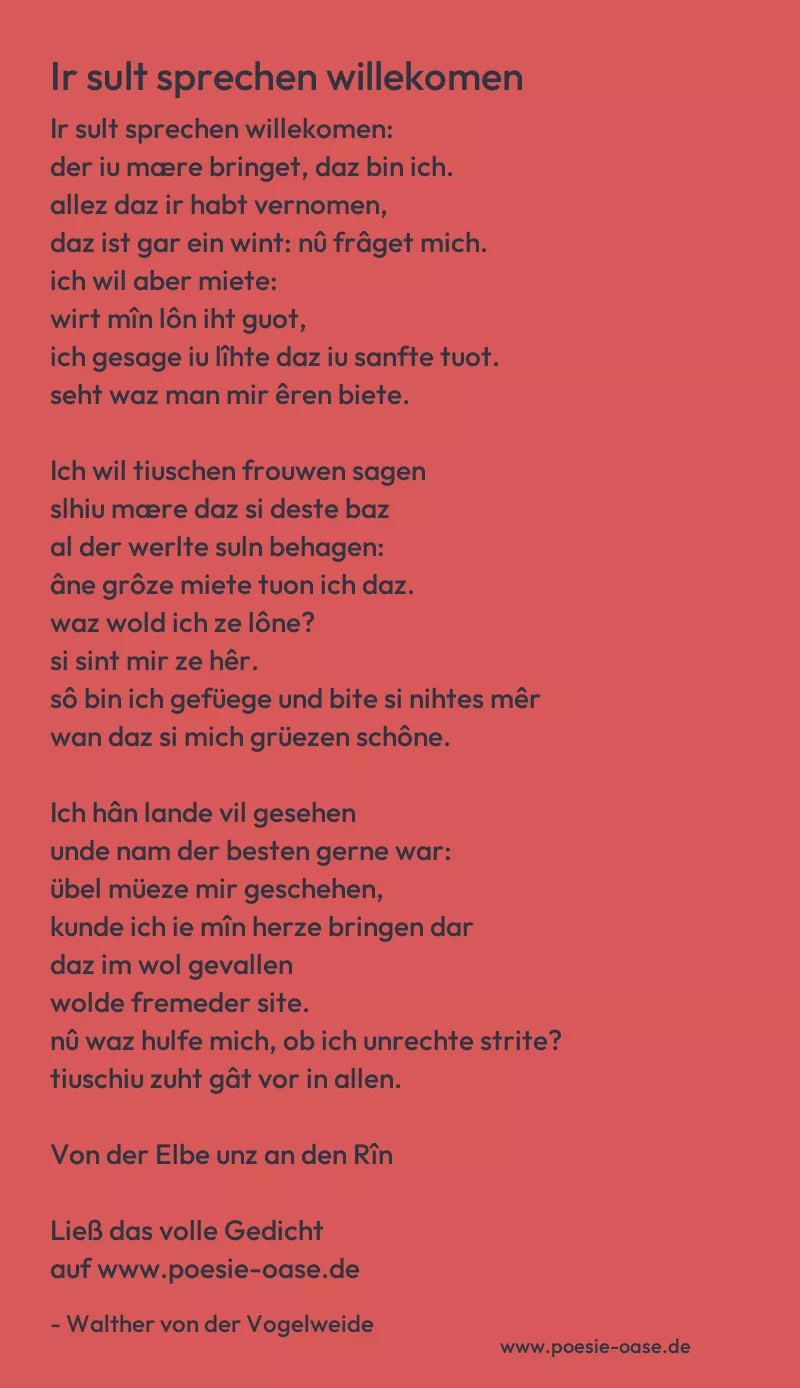Ir sult sprechen willekomen
Ir sult sprechen willekomen:
der iu mære bringet, daz bin ich.
allez daz ir habt vernomen,
daz ist gar ein wint: nû frâget mich.
ich wil aber miete:
wirt mîn lôn iht guot,
ich gesage iu lîhte daz iu sanfte tuot.
seht waz man mir êren biete.
Ich wil tiuschen frouwen sagen
slhiu mære daz si deste baz
al der werlte suln behagen:
âne grôze miete tuon ich daz.
waz wold ich ze lône?
si sint mir ze hêr.
sô bin ich gefüege und bite si nihtes mêr
wan daz si mich grüezen schône.
Ich hân lande vil gesehen
unde nam der besten gerne war:
übel müeze mir geschehen,
kunde ich ie mîn herze bringen dar
daz im wol gevallen
wolde fremeder site.
nû waz hulfe mich, ob ich unrechte strite?
tiuschiu zuht gât vor in allen.
Von der Elbe unz an den Rîn
und her wider unz an Ungerlant
mugen wol die besten sîn,
die ich in der werlte hân erkant.
kan ich rehte schouwen
guot gelâz und lîp,
sem mir got, sô swüere ich wol, daz hie diu wip
bezzer sint danne ander frouwen.
Tiusche man sint wol gezogen,
rehte als engel sint diu wîp getân.
swer si schildet, derst betrogen:
ich entkan sîn anders niht verstân.
tugent und reine minne,
swer die suochen wil,
der sol komen in unser lant: da ist wünne vil!
lange müeze ich leben dar inne!
Der ich vil gedienet hân
und iemer mêre gerne dienen wil,
diust von mir vil unerlân.
iedoch sô tuot si leides mir sô vil.
si kan mir versêren
herze und den muot.
nû vergebez ir got dazs an mir missetuot.
her nâch mac si sichs bekêren.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
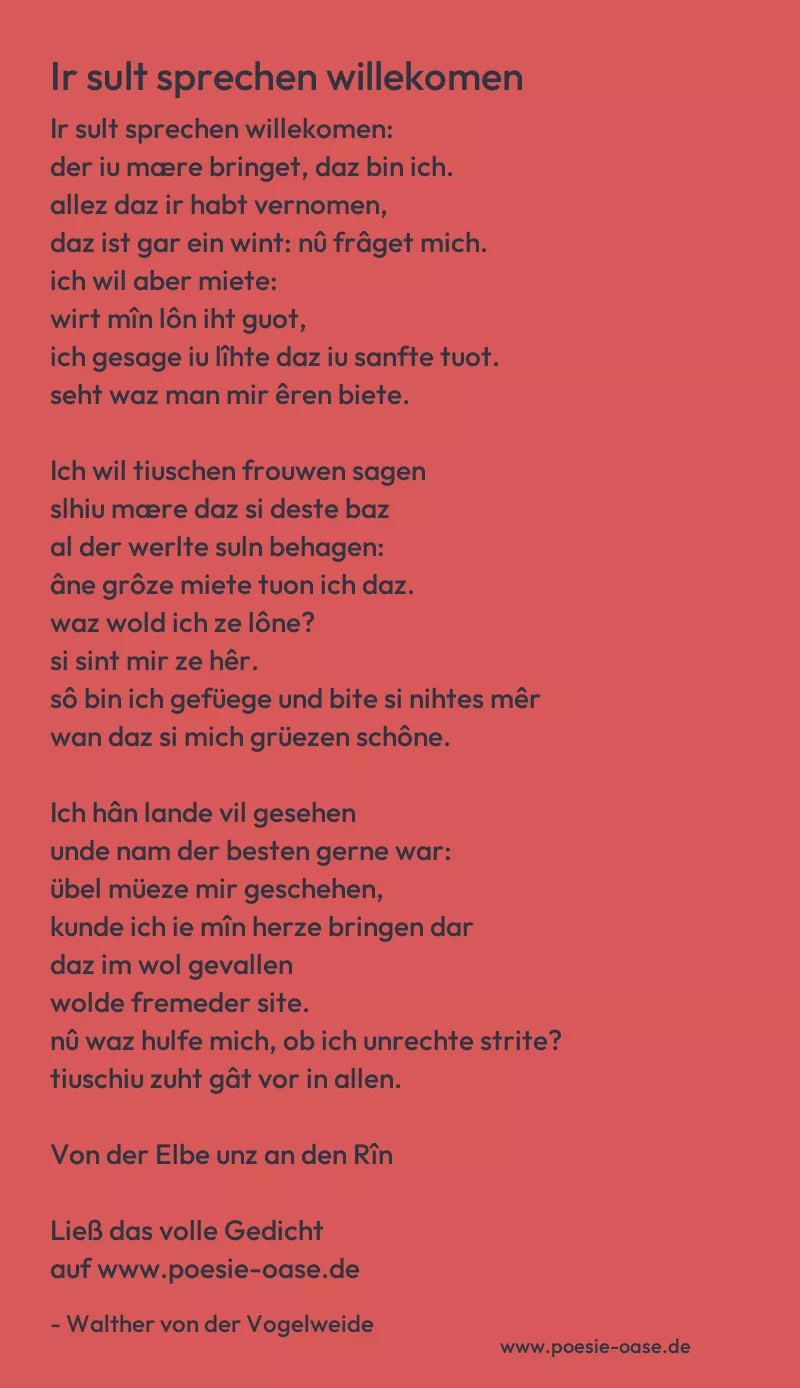
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ir sult sprechen willekomen“ von Walther von der Vogelweide ist eine kunstvolle Lobpreisung der deutschen (tiuschen) Frauen und Sitten, zugleich aber auch ein Ausdruck persönlicher Erfahrung und enttäuschter Liebe. Der Dichter wendet sich direkt an sein Publikum und versteht sich als Botschafter einer wichtigen Botschaft: Die Tugend, Schönheit und Liebenswürdigkeit der Frauen seines Heimatlandes übertreffe alles, was er auf seinen Reisen gesehen habe. Dabei klingt neben Stolz und Bewunderung auch ein leiser Ton von Wehmut und Zurückweisung mit.
Bereits im ersten Vers lädt der Sprecher mit der Formel „Ir sult sprechen willekomen“ dazu ein, seine Botschaft aufzunehmen – er sei es, der die „wahren Nachrichten“ bringe, im Gegensatz zu leeren Gerüchten („daz ist gar ein wint“). Gleichzeitig fordert er eine gewisse Gegenleistung: Anerkennung, Aufmerksamkeit, vielleicht auch Dankbarkeit. Doch statt großer Belohnung genügt ihm ein schönes Grußwort der Frau – ein bescheidener Lohn, der jedoch viel bedeutet.
Zentral im Gedicht ist das Motiv des Vergleichs: Der Sprecher hat viele Länder bereist und Menschen kennengelernt, doch nirgendwo habe er so viel Tugend, Anmut und Liebenswürdigkeit erlebt wie im deutschen Sprachraum – konkret im Gebiet zwischen Elbe, Rhein und Ungarn. Die deutschen Frauen („tiusche wîp“) seien schöner als alle anderen, ihre Haltung und ihr Aussehen „als Engel getân“. Auch die Männer werden nicht vergessen: Sie seien gut erzogen und ehrenhaft. Dieser stolze Nationalstolz wird aber nicht aggressiv, sondern bleibt auf die Werte höfischer Kultur konzentriert.
Am Ende des Gedichts wendet sich der Ton jedoch: Der Sprecher gesteht, dass er einer Frau diene, die ihm viel bedeutet, aber ihm offenbar auch Schmerz zufügt. Trotz seiner aufrichtigen Liebe erfährt er Zurückweisung oder zumindest Kälte. Er bittet Gott um Vergebung für das Unrecht, das sie ihm tut, und hofft auf eine spätere Einsicht ihrerseits. Diese letzte Strophe verleiht dem zuvor selbstbewussten und lobenden Gedicht eine persönliche Tiefe und Ambivalenz – hinter aller Begeisterung für die tiusche Kultur steht ein lyrisches Ich, das verletzt ist, aber dennoch hoffnungsvoll bleibt.
Insgesamt verknüpft Walther in diesem Gedicht patriotisches Lob, höfische Minne und persönliche Liebeserfahrung. Es zeigt die Spannweite seiner Dichtung: zwischen öffentlichem Auftritt und innerer Empfindung, zwischen gesellschaftlicher Idealisierung und individueller Verletzlichkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.