Denn tanzen muss sie.
Dem tollen Rad verflochten
Gliedert sie Chaos,
Schwendet Quellen,
Stampft zuckende Krater.
Im Drang
Des großen Taktes
Tanzt sie Gestirne.
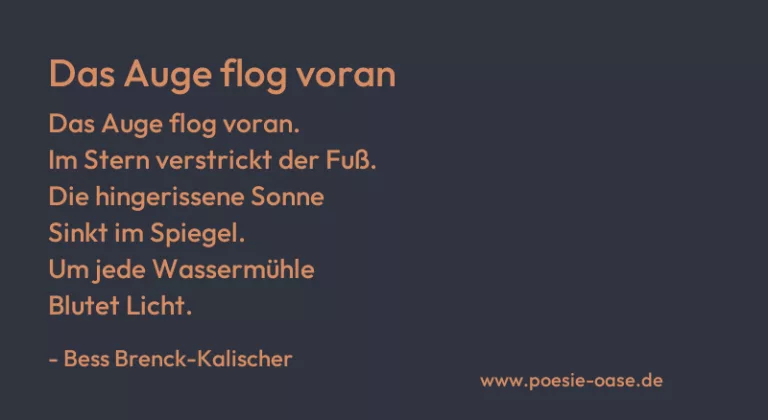
Das Auge flog voran
- Gemeinfrei
- Hoffnung
- Sommer
Denn tanzen muss sie.
Dem tollen Rad verflochten
Gliedert sie Chaos,
Schwendet Quellen,
Stampft zuckende Krater.
Im Drang
Des großen Taktes
Tanzt sie Gestirne.
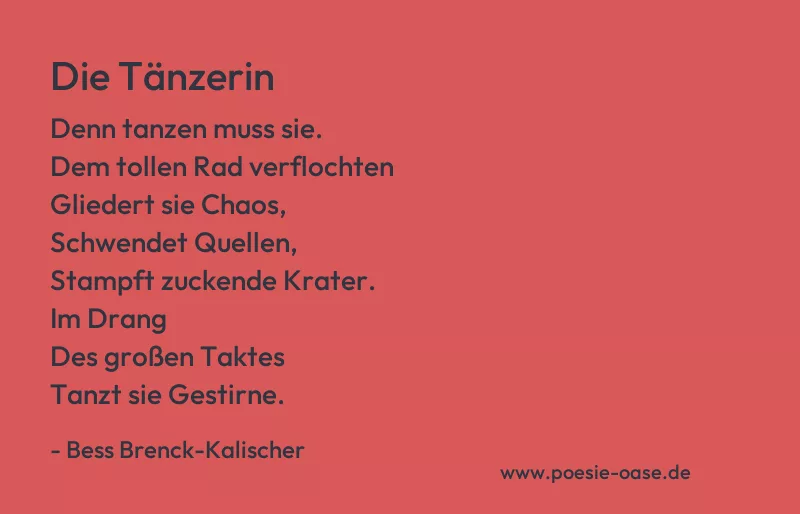
Das Gedicht „Die Tänzerin“ von Bess Brenck-Kalischer beschreibt eine Frau, die in einem ekstatischen, kosmischen Tanz aufgeht. Ihre Bewegung ist nicht bloß körperlicher Ausdruck, sondern wird zur schöpferischen, fast göttlichen Kraft. Die Tänzerin ist keine bloße Darstellerin – sie ist eine Gestalterin des Chaos, eine Urkraft, die Ordnung und Zerstörung zugleich hervorbringt.
Die Formulierungen „Denn tanzen muss sie“ und „dem tollen Rad verflochten“ deuten auf eine innere Unausweichlichkeit hin – der Tanz ist Zwang, Bestimmung und Lebensausdruck zugleich. Das Bild des „tollen Rades“ erinnert an das Rad des Schicksals oder an eine ekstatische Bewegung, die keine Pause kennt. In dieser Bewegung strukturiert die Tänzerin das Chaos, bringt Energie zum Ausdruck („zuckende Krater“) und erschöpft Ressourcen („Schwendet Quellen“).
Der Tanz ist nicht sanft oder anmutig, sondern eruptiv, gewaltig und schöpferisch. Die Tänzerin stampft, gliedert, drängt – sie wirkt wie ein mythisches Wesen, das Naturgewalten beeinflusst. Im „Drang des großen Taktes“ schließlich erweitert sich ihre Macht ins Universale: Sie tanzt „Gestirne“ und wird so zu einer kosmischen Kraft, die das Weltall selbst beeinflusst.
Mit wenigen, expressiven Bildern erschafft das Gedicht eine kraftvolle Metapher für schöpferische Energie, weibliche Urgewalt und das Eingebundensein des Individuums in größere, rhythmische Zusammenhänge. Die Tänzerin steht dabei für eine existentielle Bewegung zwischen Zerstörung und Schöpfung – ihr Tanz ist das Leben selbst.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.