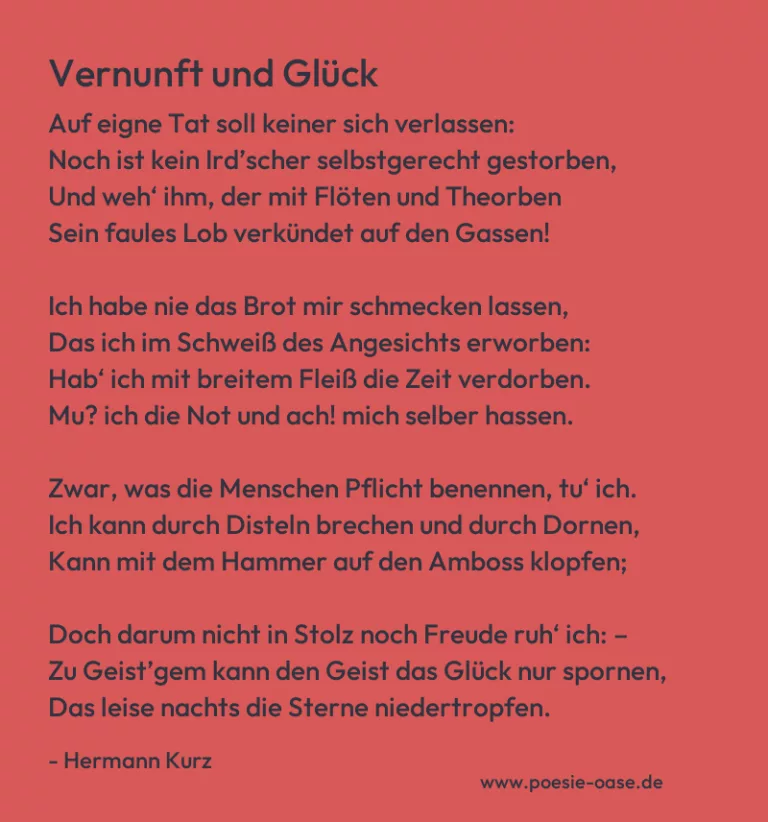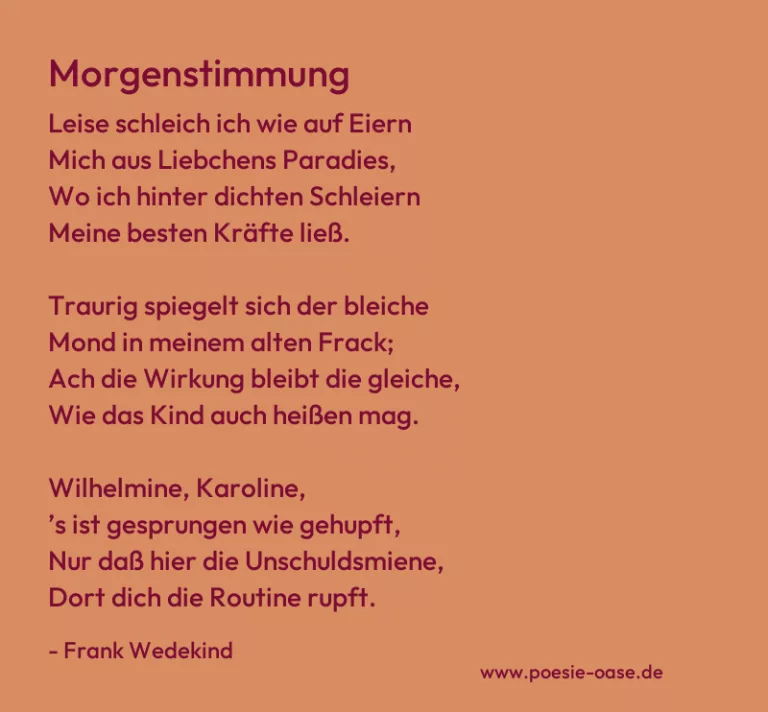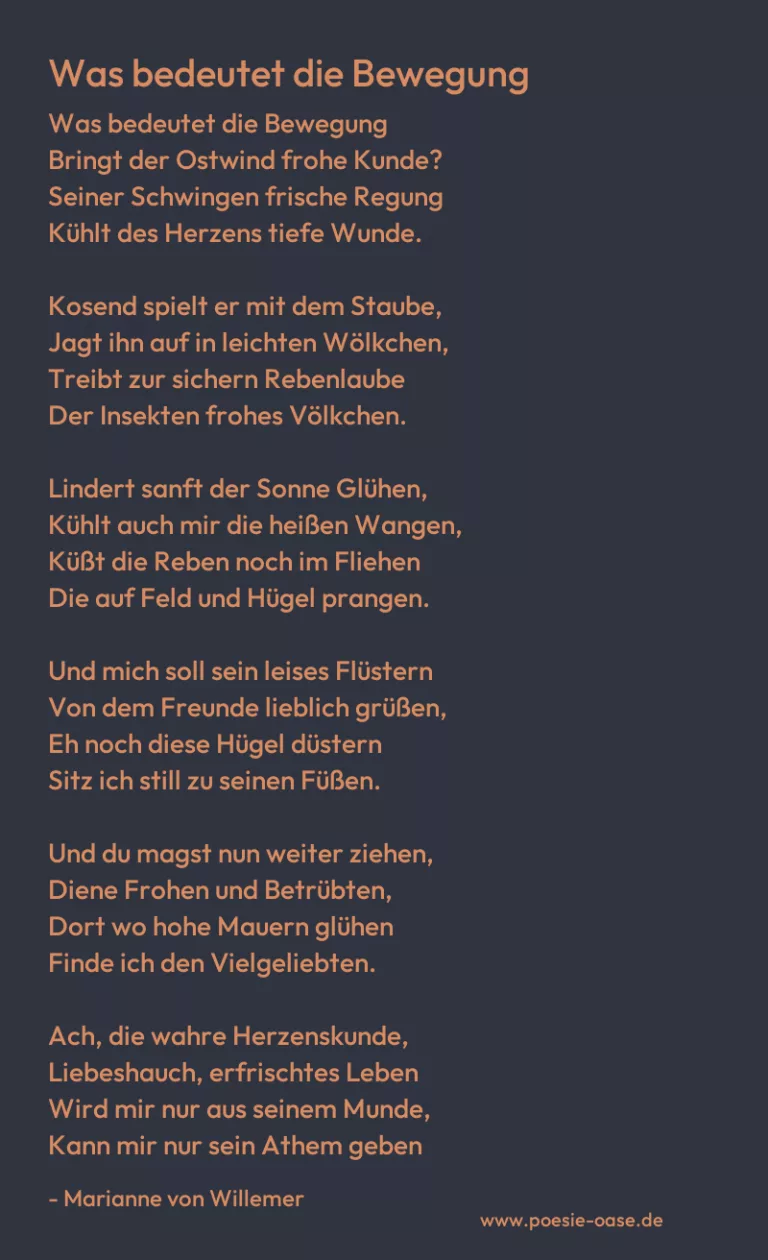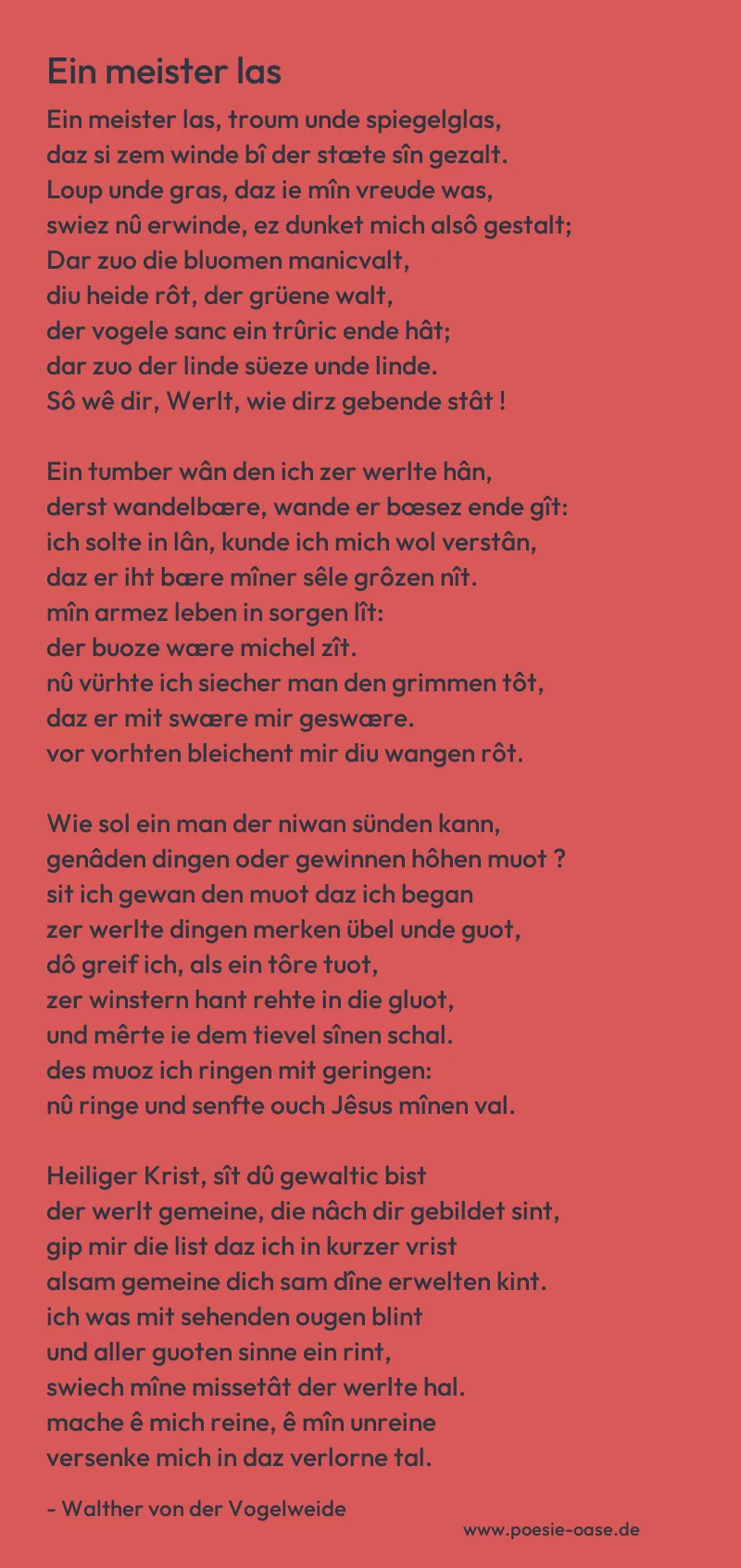Ein meister las
Ein meister las, troum unde spiegelglas,
daz si zem winde bî der stæte sîn gezalt.
Loup unde gras, daz ie mîn vreude was,
swiez nû erwinde, ez dunket mich alsô gestalt;
Dar zuo die bluomen manicvalt,
diu heide rôt, der grüene walt,
der vogele sanc ein trûric ende hât;
dar zuo der linde süeze unde linde.
Sô wê dir, Werlt, wie dirz gebende stât !
Ein tumber wân den ich zer werlte hân,
derst wandelbære, wande er bœsez ende gît:
ich solte in lân, kunde ich mich wol verstân,
daz er iht bære mîner sêle grôzen nît.
mîn armez leben in sorgen lît:
der buoze wære michel zît.
nû vürhte ich siecher man den grimmen tôt,
daz er mit swære mir geswære.
vor vorhten bleichent mir diu wangen rôt.
Wie sol ein man der niwan sünden kann,
genâden dingen oder gewinnen hôhen muot ?
sit ich gewan den muot daz ich began
zer werlte dingen merken übel unde guot,
dô greif ich, als ein tôre tuot,
zer winstern hant rehte in die gluot,
und mêrte ie dem tievel sînen schal.
des muoz ich ringen mit geringen:
nû ringe und senfte ouch Jêsus mînen val.
Heiliger Krist, sît dû gewaltic bist
der werlt gemeine, die nâch dir gebildet sint,
gip mir die list daz ich in kurzer vrist
alsam gemeine dich sam dîne erwelten kint.
ich was mit sehenden ougen blint
und aller guoten sinne ein rint,
swiech mîne missetât der werlte hal.
mache ê mich reine, ê mîn unreine
versenke mich in daz verlorne tal.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
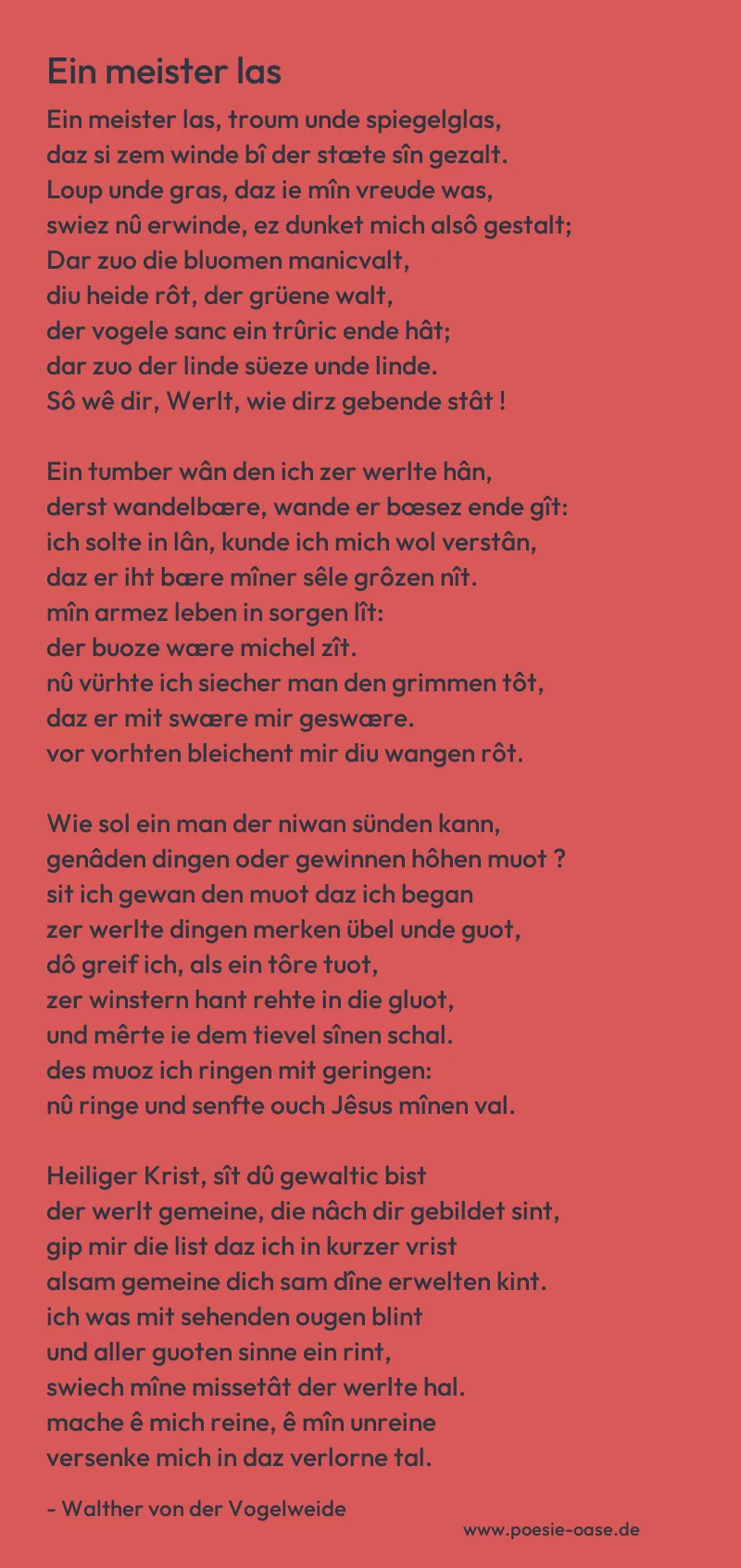
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ein meister las“ von Walther von der Vogelweide ist ein tief religiöses und zugleich von Weltschmerz durchdrungenes Bekenntnisgedicht. Es zeigt den geistigen Wandel eines lyrischen Ichs, das sich von der Schönheit und Verlockung der Welt zunächst faszinieren lässt, dann aber die Vergänglichkeit und Irreführung weltlicher Freuden erkennt und sich letztlich der göttlichen Gnade zuwendet. In dieser poetischen Reflexion verdichten sich mittelalterliche Themen wie Vanitas, Buße und das Streben nach Erlösung in ausdrucksstarker Sprache.
Der erste Teil beschreibt mit beeindruckender Bildkraft die Schönheit der Natur: „Loup unde gras“, „bluomen manicvalt“, „der vogele sanc“ – alles, was einst Freude war, erscheint nun bedeutungslos. Die einst geliebten Sinneseindrücke haben „ein trûric ende“. Die Welt, früher Quelle der Freude, wird nun als trügerisch und vergänglich erkannt. Die Klage über die Welt gipfelt im Stoßseufzer: „Sô wê dir, Werlt, wie dirz gebende stât!“ – eine klassische Vanitas-Formel, die das irdische Dasein als trügerisch und leer entlarvt.
Im zweiten Abschnitt wendet sich das Ich zunehmend selbstkritisch nach innen. Es erkennt, dass der „tumber wân“ – der törichte Glaube an die Welt – nur ins Verderben führt. Die Furcht vor dem Tod und der daraus folgenden Strafe drückt sich in körperlicher Reaktion aus: „vor vorhten bleichent mir diu wangen rôt“. Hier vermischen sich existenzielle Angst und Reue über ein Leben, das vom Sündhaften geprägt war.
Die dritte Strophe geht noch weiter: Die eigene Schuld wird mit drastischen Bildern beschrieben – der Griff „in die gluot“, das bewusste Sündigen trotz besseren Wissens. Die Reue ist tief, der Glaube aber noch nicht verloren: Der Dichter bittet Jesus, ihm beim Ringen mit dem Bösen beizustehen. Hier wird das Ich zum „ringenden“ Menschen, wie man es auch aus der biblischen Tradition kennt – schwach, aber nicht ohne Hoffnung.
In der letzten Strophe richtet sich das lyrische Ich direkt an Christus. Die Bitte um „list“ (Weisheit) und um Gnade steht im Zentrum. Das Ich erkennt sich als geistig blind, als „rint“ (Rind) – also als dummes Wesen, das der göttlichen Führung bedarf. Die letzte Zeile bringt das Flehen um Reinigung und Erlösung zum Ausdruck: ehe er in die „verlorne tal“ – die Hölle – stürzt, möge Gott ihn rein machen. Die Reue ist aufrichtig, die Hoffnung auf göttliche Vergebung trotz aller Schuld bleibt bestehen.
„Ein meister las“ ist ein bewegendes Beispiel für die mittelalterliche Geistlichkeit, in der Naturerfahrung, Weltkritik, Selbsterkenntnis und Erlösungssehnsucht kunstvoll miteinander verwoben sind. Walther gelingt es, persönliche Empfindung und religiöse Lehre in dichterischer Form zu vereinen – mit einer Sprache, die zwischen Schönheit und existenzieller Not schwankt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.