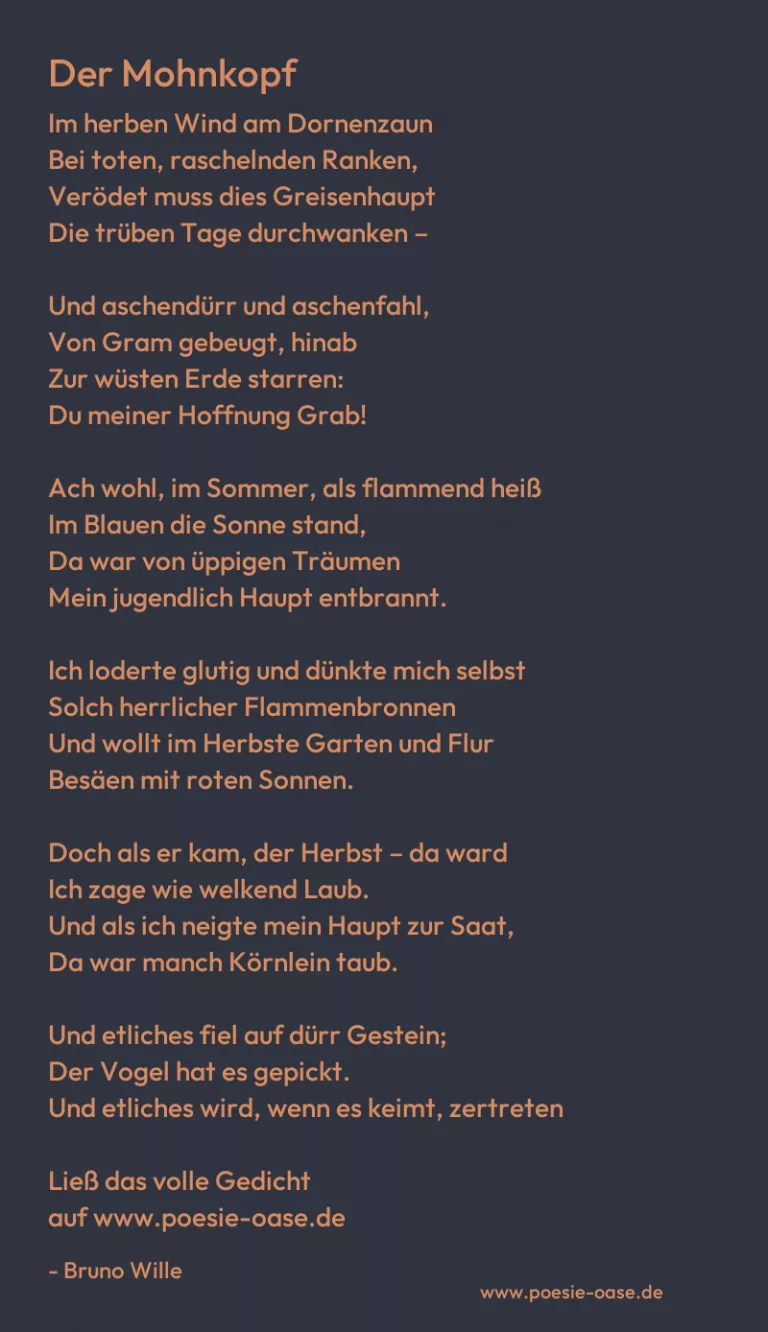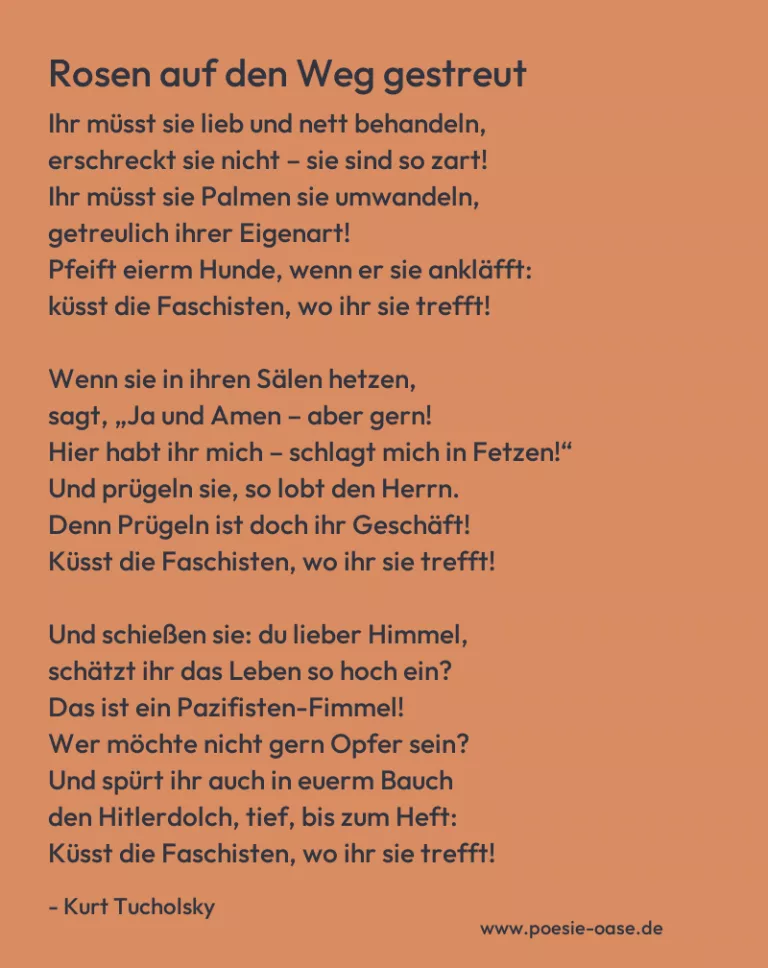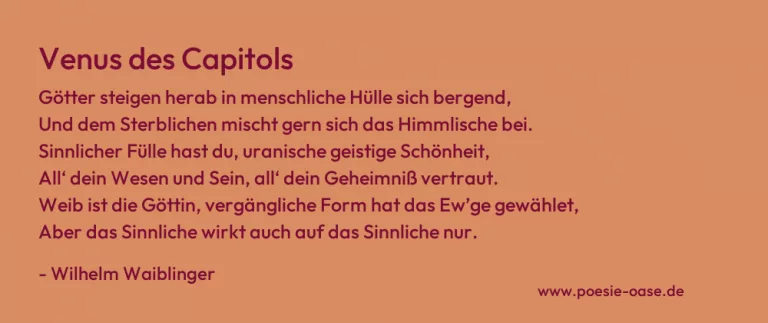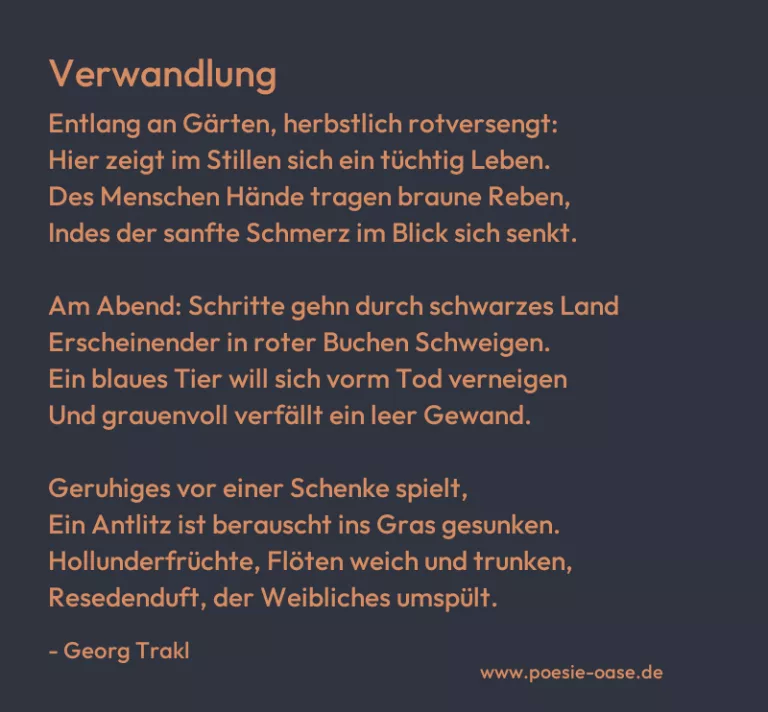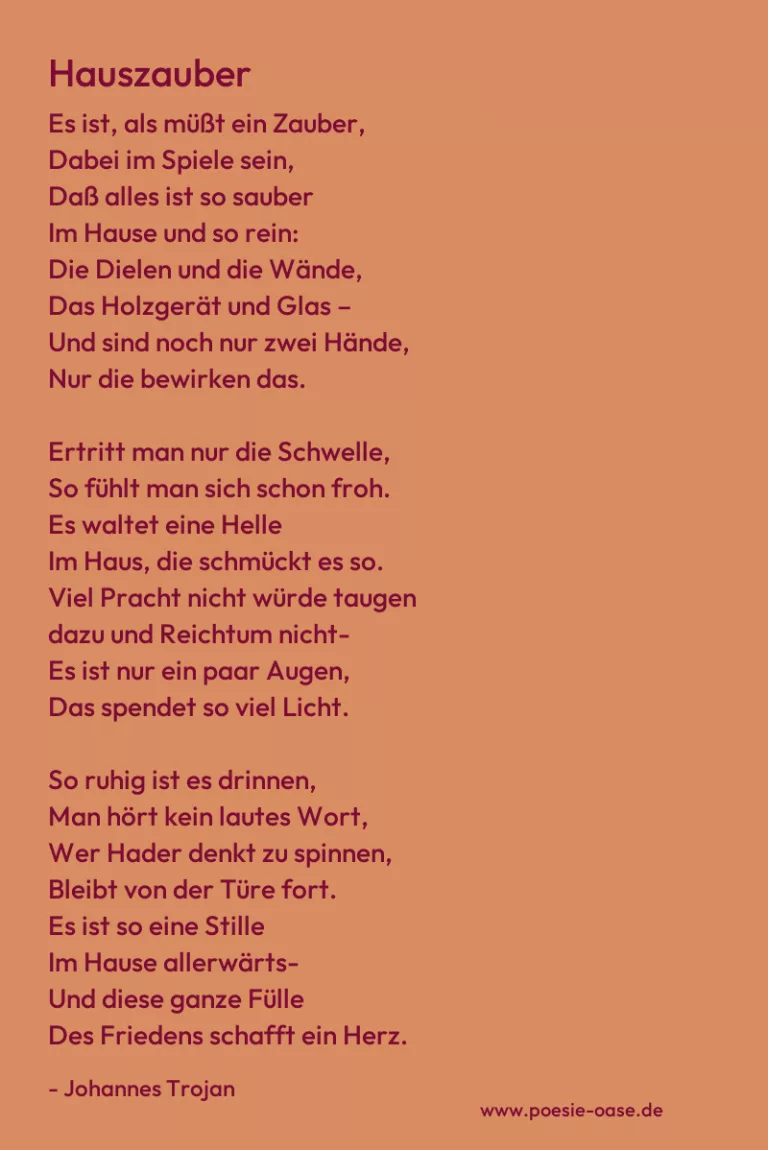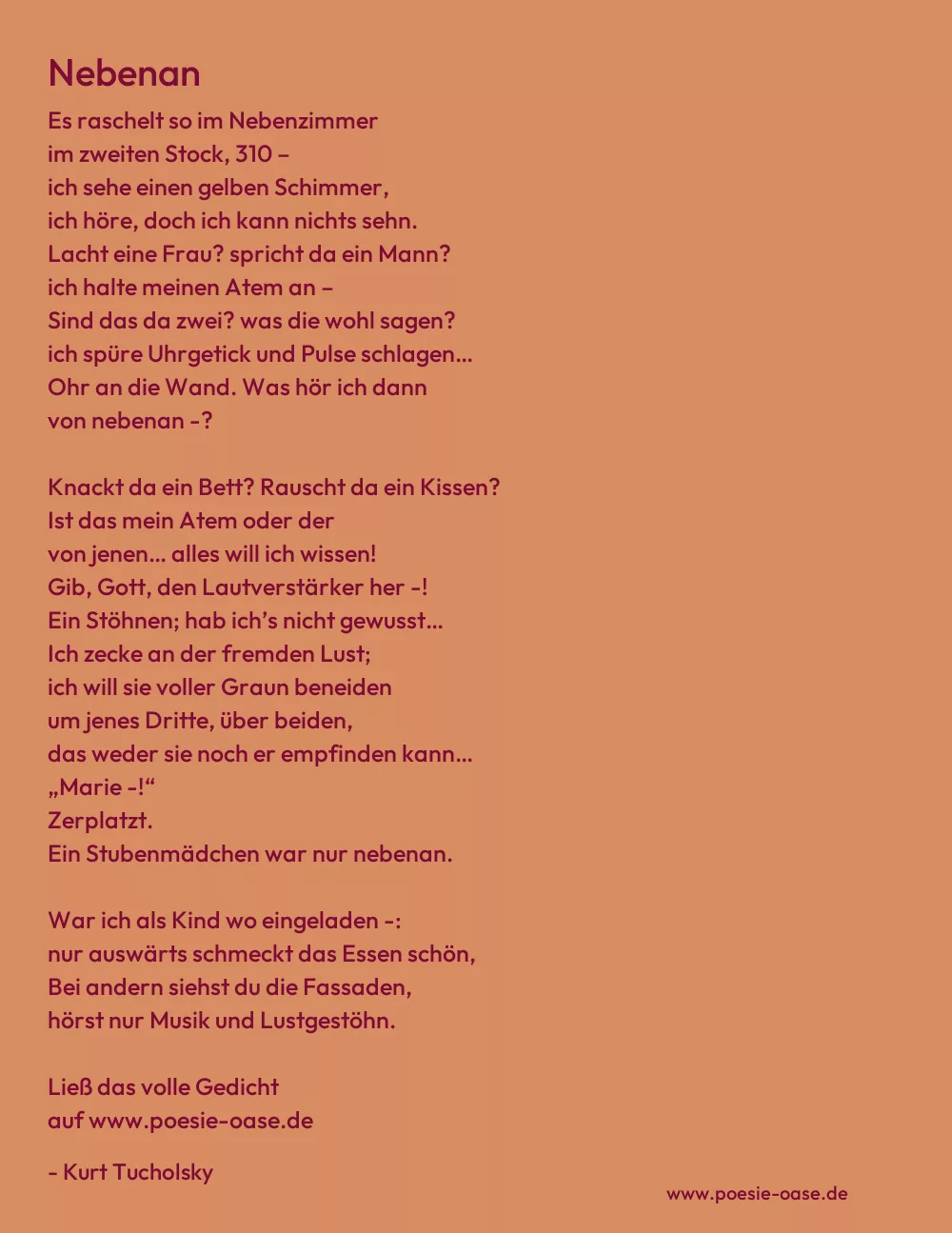Es raschelt so im Nebenzimmer
im zweiten Stock, 310 –
ich sehe einen gelben Schimmer,
ich höre, doch ich kann nichts sehn.
Lacht eine Frau? spricht da ein Mann?
ich halte meinen Atem an –
Sind das da zwei? was die wohl sagen?
ich spüre Uhrgetick und Pulse schlagen…
Ohr an die Wand. Was hör ich dann
von nebenan -?
Knackt da ein Bett? Rauscht da ein Kissen?
Ist das mein Atem oder der
von jenen… alles will ich wissen!
Gib, Gott, den Lautverstärker her -!
Ein Stöhnen; hab ich’s nicht gewusst…
Ich zecke an der fremden Lust;
ich will sie voller Graun beneiden
um jenes Dritte, über beiden,
das weder sie noch er empfinden kann…
„Marie -!“
Zerplatzt.
Ein Stubenmädchen war nur nebenan.
War ich als Kind wo eingeladen -:
nur auswärts schmeckt das Essen schön,
Bei andern siehst du die Fassaden,
hörst nur Musik und Lustgestöhn.
Ich auch! ich auch! es greift die Hand
nach einem nicht vorhandenen Land:
Ja, da -! strahlt warmer Lampenschimmer.
Ja, da ist Heimat und das Glück.
In jeder Straße lässt du immer
ein kleines Stückchen Herz zurück.
Darfst nie der eigenen Schwäche fluchen;
musst immer nach einem Dolchstoß suchen.
Ja, da könnt ich in Ruhe schreiben!
Ja, hier -! hier möcht‘ ich immer bleiben,
in dieser Landschaft, wo wir stehn,
und ich möchte nie mehr nach Hause gehn.
Schön ist nur, was niemals dein.
Es ist heiter, zu reisen, und schrecklich, zu sein.
Ewiger, ewiger Wandersmann
um das kleine Zimmer nebenan.