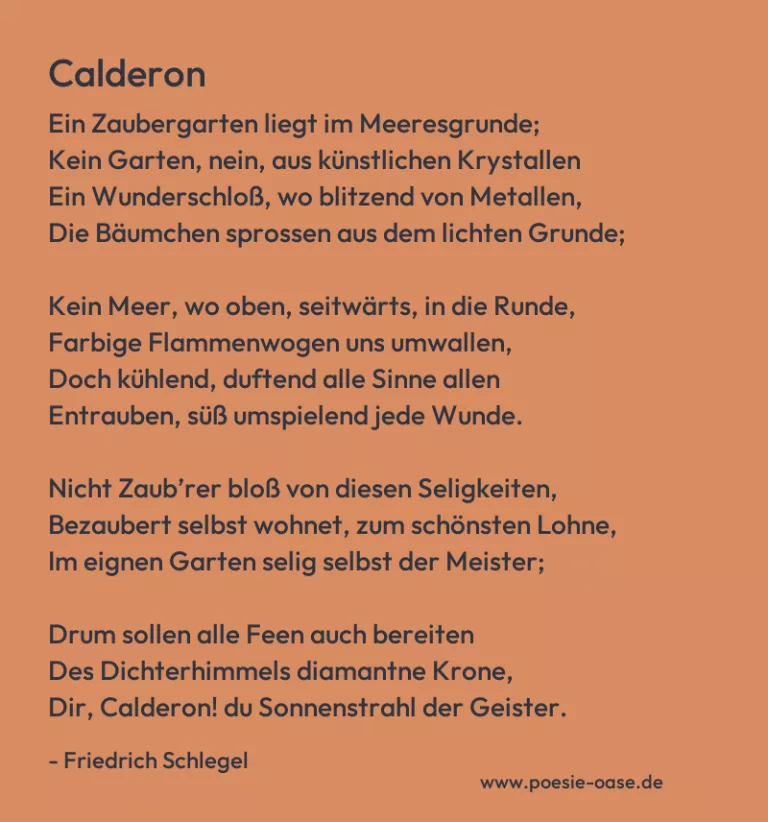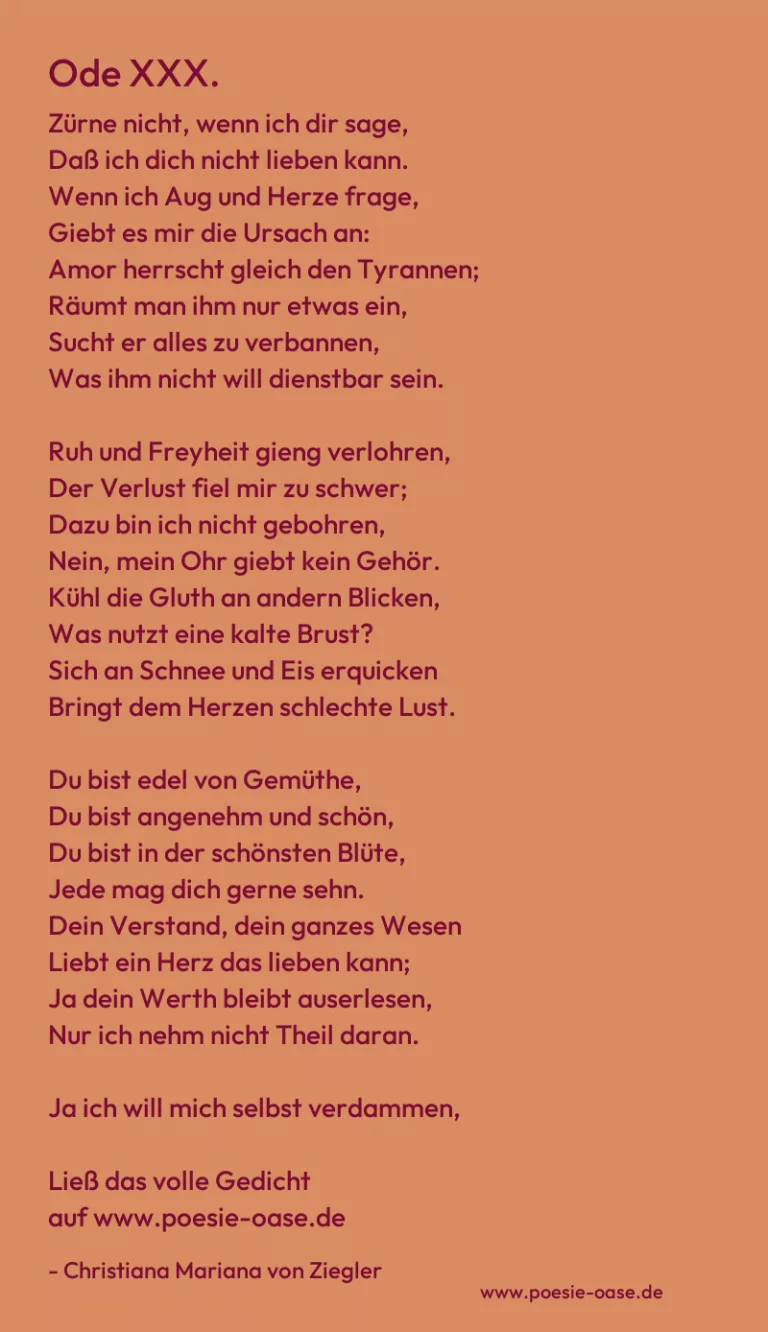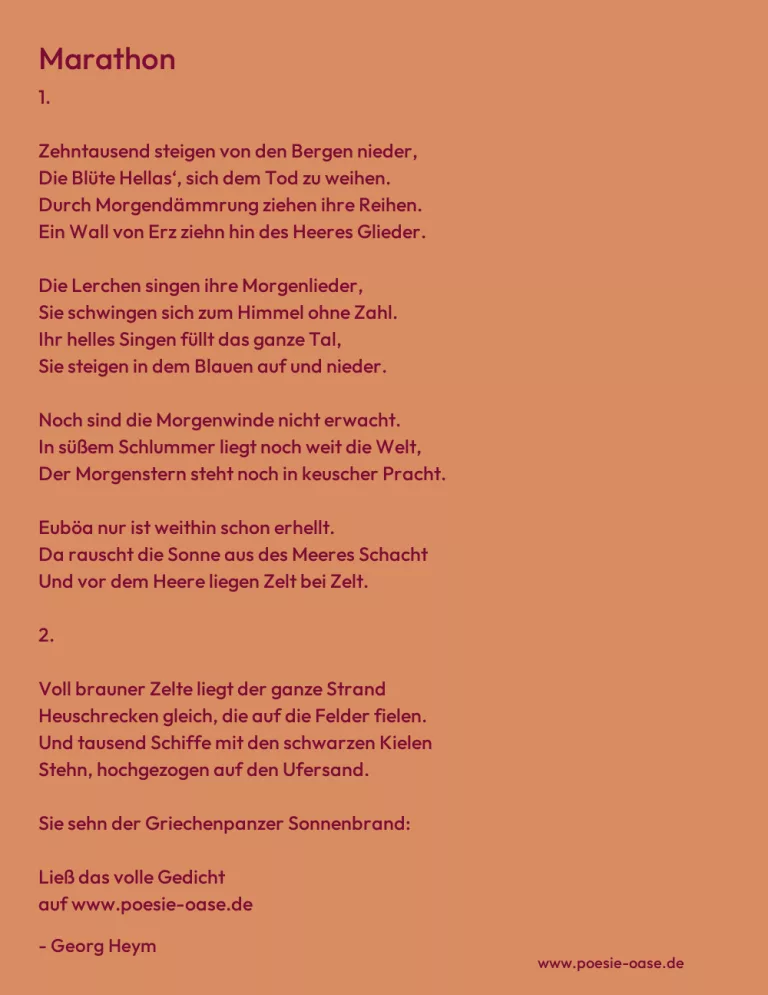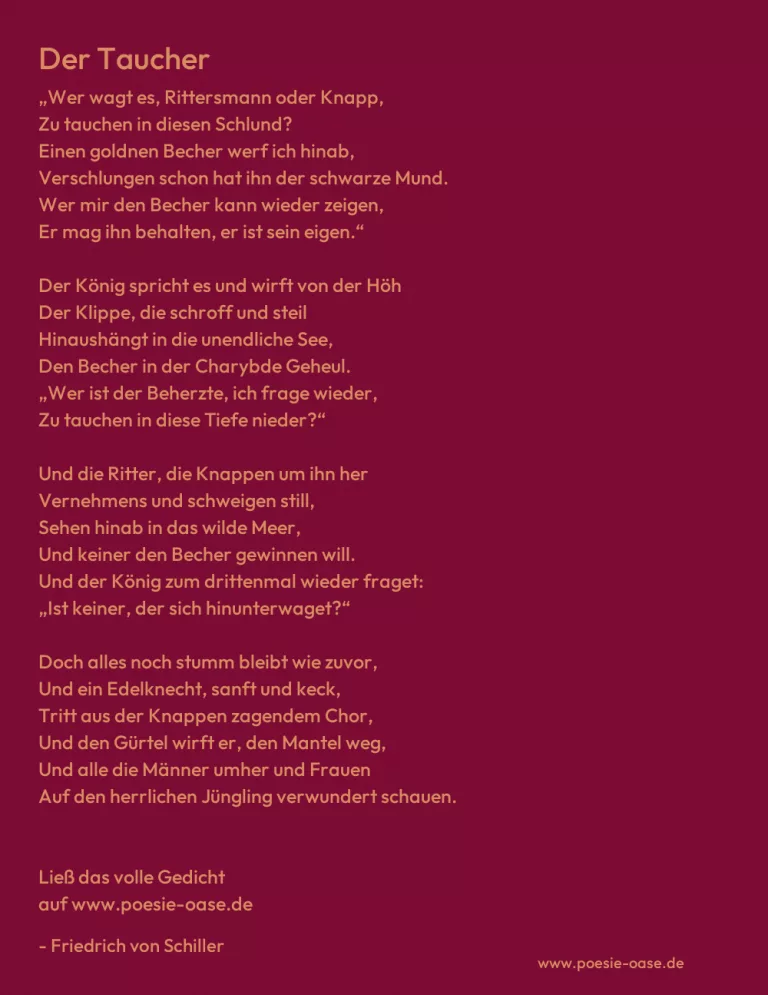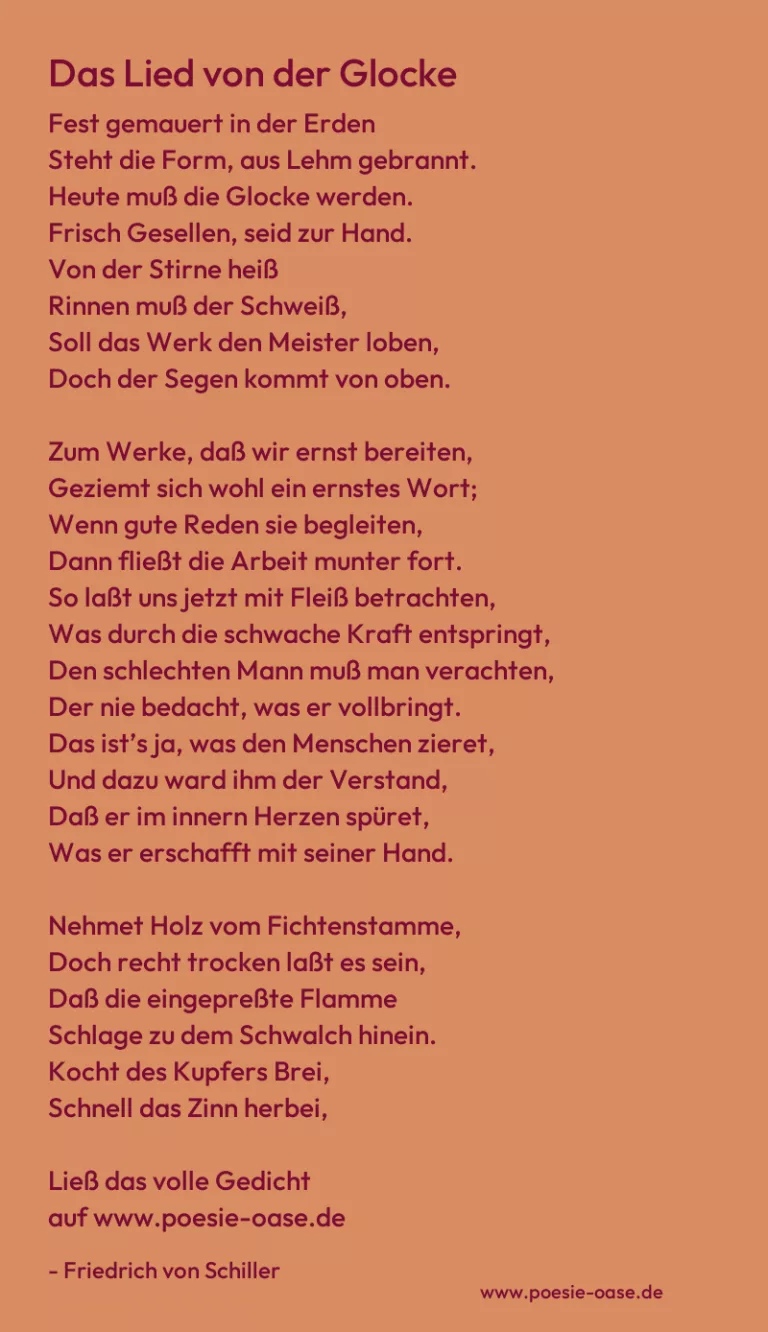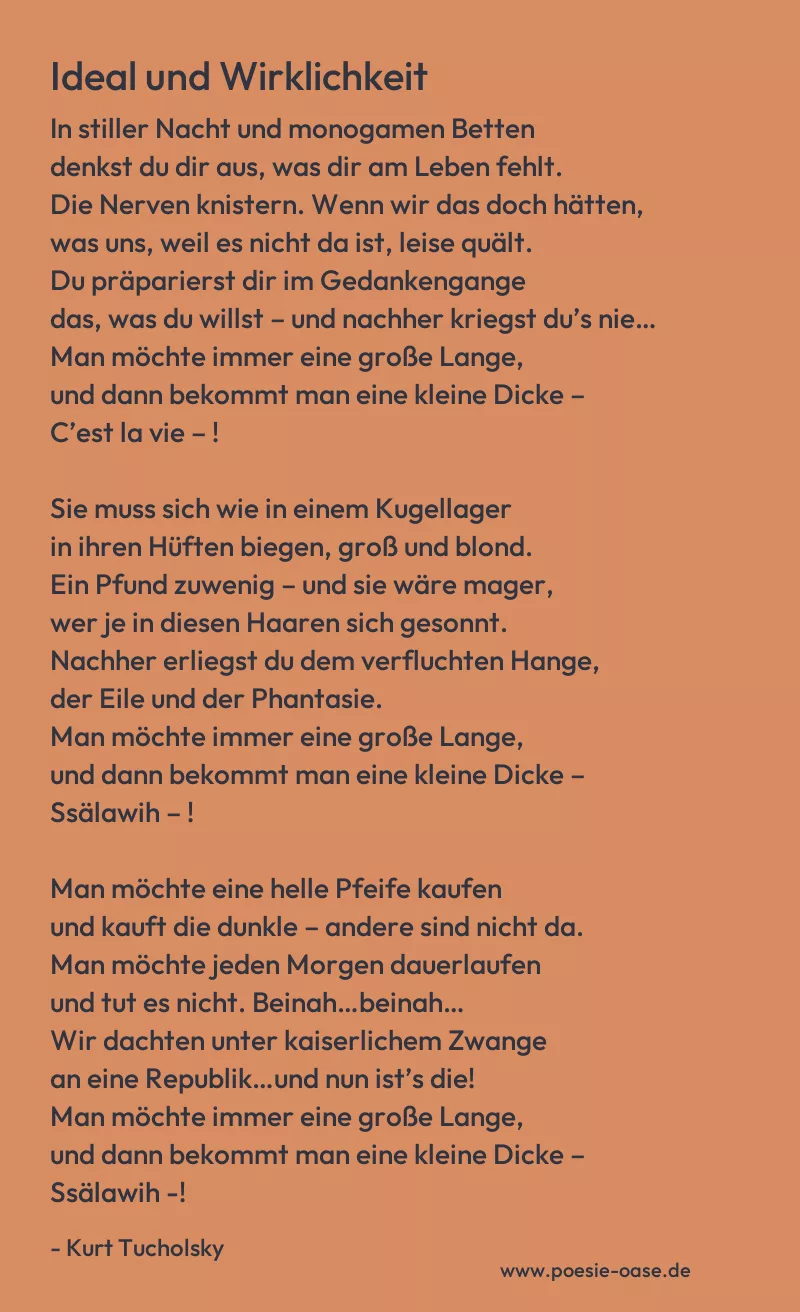Ideal und Wirklichkeit
In stiller Nacht und monogamen Betten
denkst du dir aus, was dir am Leben fehlt.
Die Nerven knistern. Wenn wir das doch hätten,
was uns, weil es nicht da ist, leise quält.
Du präparierst dir im Gedankengange
das, was du willst – und nachher kriegst du’s nie…
Man möchte immer eine große Lange,
und dann bekommt man eine kleine Dicke –
C’est la vie – !
Sie muss sich wie in einem Kugellager
in ihren Hüften biegen, groß und blond.
Ein Pfund zuwenig – und sie wäre mager,
wer je in diesen Haaren sich gesonnt.
Nachher erliegst du dem verfluchten Hange,
der Eile und der Phantasie.
Man möchte immer eine große Lange,
und dann bekommt man eine kleine Dicke –
Ssälawih – !
Man möchte eine helle Pfeife kaufen
und kauft die dunkle – andere sind nicht da.
Man möchte jeden Morgen dauerlaufen
und tut es nicht. Beinah…beinah…
Wir dachten unter kaiserlichem Zwange
an eine Republik…und nun ist’s die!
Man möchte immer eine große Lange,
und dann bekommt man eine kleine Dicke –
Ssälawih -!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
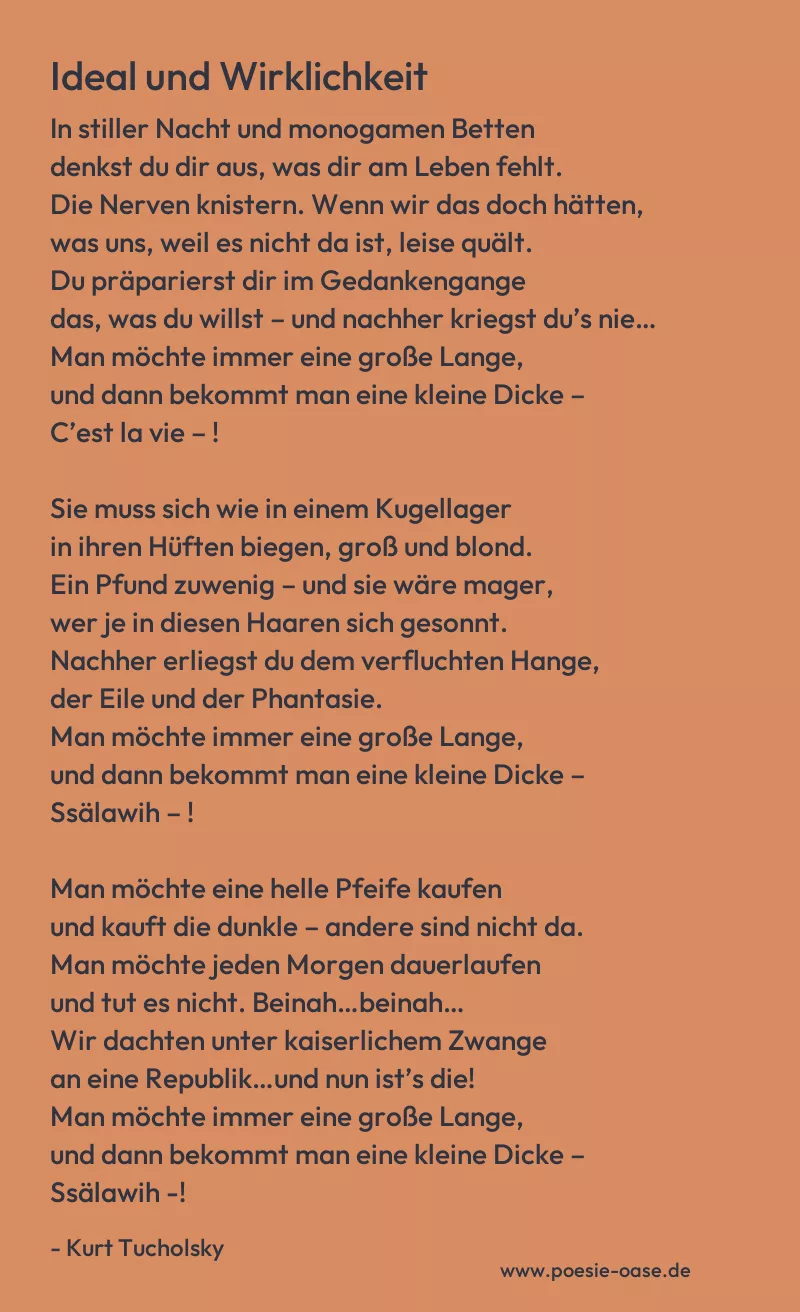
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ideal und Wirklichkeit“ von Kurt Tucholsky ist eine humorvolle, aber auch tiefgründige Reflexion über die Diskrepanz zwischen unseren idealisierten Vorstellungen und der Realität. Es beginnt mit dem Bild einer stillen Nacht, in der der Sprecher in den „monogamen Betten“ über das nachdenkt, was ihm im Leben fehlt. Die „Nerven knistern“, was eine gewisse Unruhe und Enttäuschung über die unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte signalisiert. Tucholsky beschreibt, wie wir in Gedanken das perfekte Leben, die ideale Partnerin oder die gewünschten Lebensumstände erschaffen, nur um festzustellen, dass diese Wünsche in der Realität niemals ganz erfüllt werden.
In den folgenden Strophen wird das immer wiederkehrende Motiv der unerfüllten Erwartungen vertieft. Der Wunsch nach der perfekten Frau, die in allen Aspekten den eigenen Vorstellungen entspricht – „groß und blond“, mit genau der richtigen Figur – wird schnell als unerreichbar entlarvt. Stattdessen bekommt man „eine kleine Dicke“, was auf die Ironie hinweist, dass unsere idealisierten Bilder oft von der tatsächlichen Realität abweichen. Tucholsky verwendet dabei die wiederkehrende Phrase „C’est la vie“, um die Resignation und Akzeptanz des Lebens in seiner Unvollkommenheit auszudrücken. Es wird klar, dass das Leben nicht nach unseren Wünschen verläuft, aber wir müssen uns mit der Realität arrangieren.
Der Dichter macht mit dieser humorvollen Herangehensweise auf die universelle menschliche Erfahrung aufmerksam, dass das Streben nach Perfektion und Idealen oft zu Enttäuschungen führt. Die Realität ist nicht nur weniger aufregend als die Phantasie, sie widerspricht oft sogar unseren Vorstellungen. Das Bild des Kaufs der „dunklen Pfeife“, obwohl man die „helle“ wollte, steht symbolisch für das Missverhältnis zwischen Wunsch und Realität. Diese Diskrepanz zieht sich durch das ganze Leben und wird durch den Wechsel von persönlichen Erfahrungen zu gesellschaftlichen und politischen Enttäuschungen – wie dem Verlangen nach einer Republik unter „kaiserlichem Zwange“ – noch weiter verstärkt.
Das Gedicht endet mit einer weiteren Variation der Phrase „Man möchte immer eine große Lange, und dann bekommt man eine kleine Dicke“, was die zentrale Botschaft des Gedichts noch einmal verstärkt: Die menschliche Neigung, immer nach dem „größeren“ oder „perfekteren“ zu streben, endet oft mit etwas Unerwartetem, das uns weniger zufriedenstellt. Doch Tucholsky relativiert diese Enttäuschung mit einem stoischen „Ssälawih“, was eine Mischung aus Frustration und Gelassenheit ausdrückt. Das Gedicht ist somit eine humorvolle, aber auch ernüchternde Betrachtung der ewigen Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit und der Notwendigkeit, diese Unvollkommenheit zu akzeptieren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.