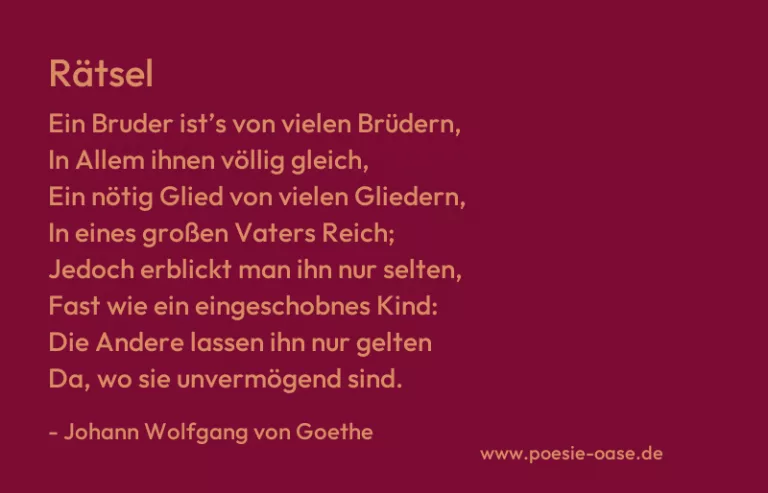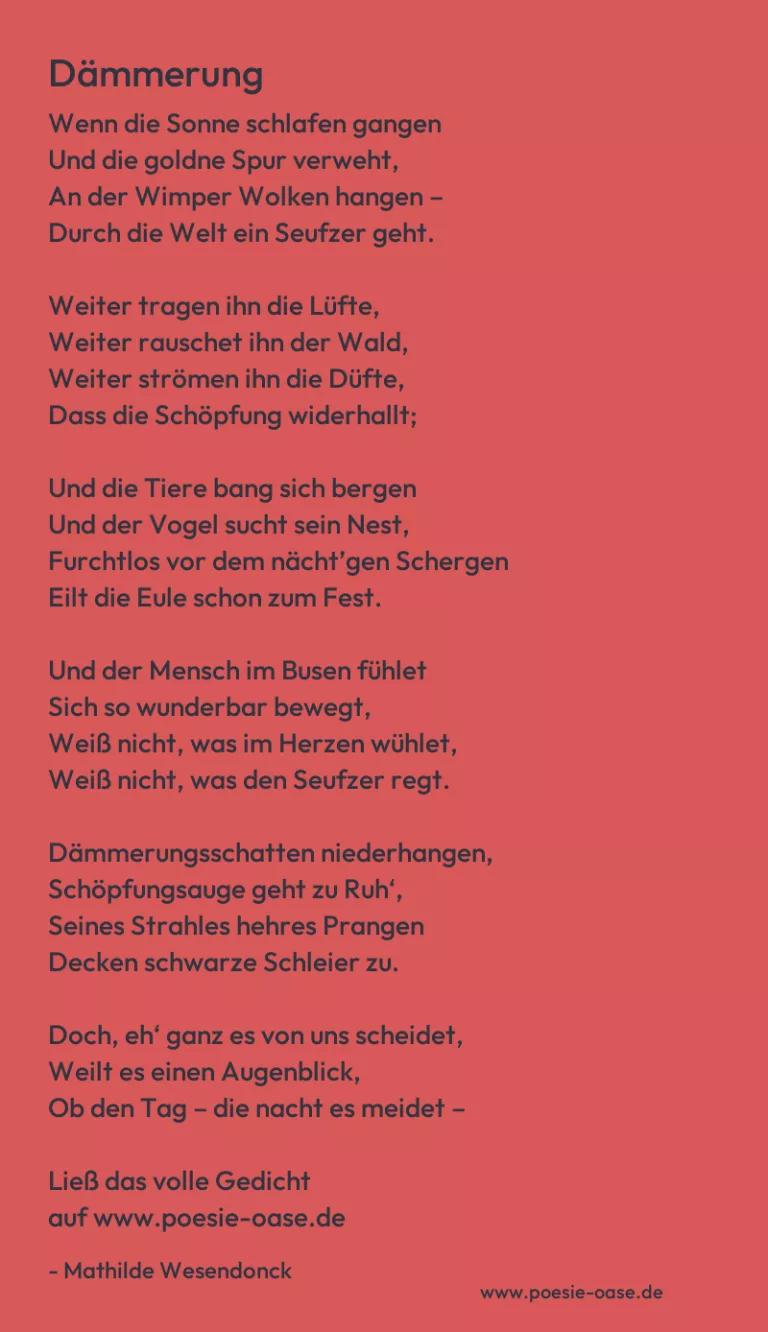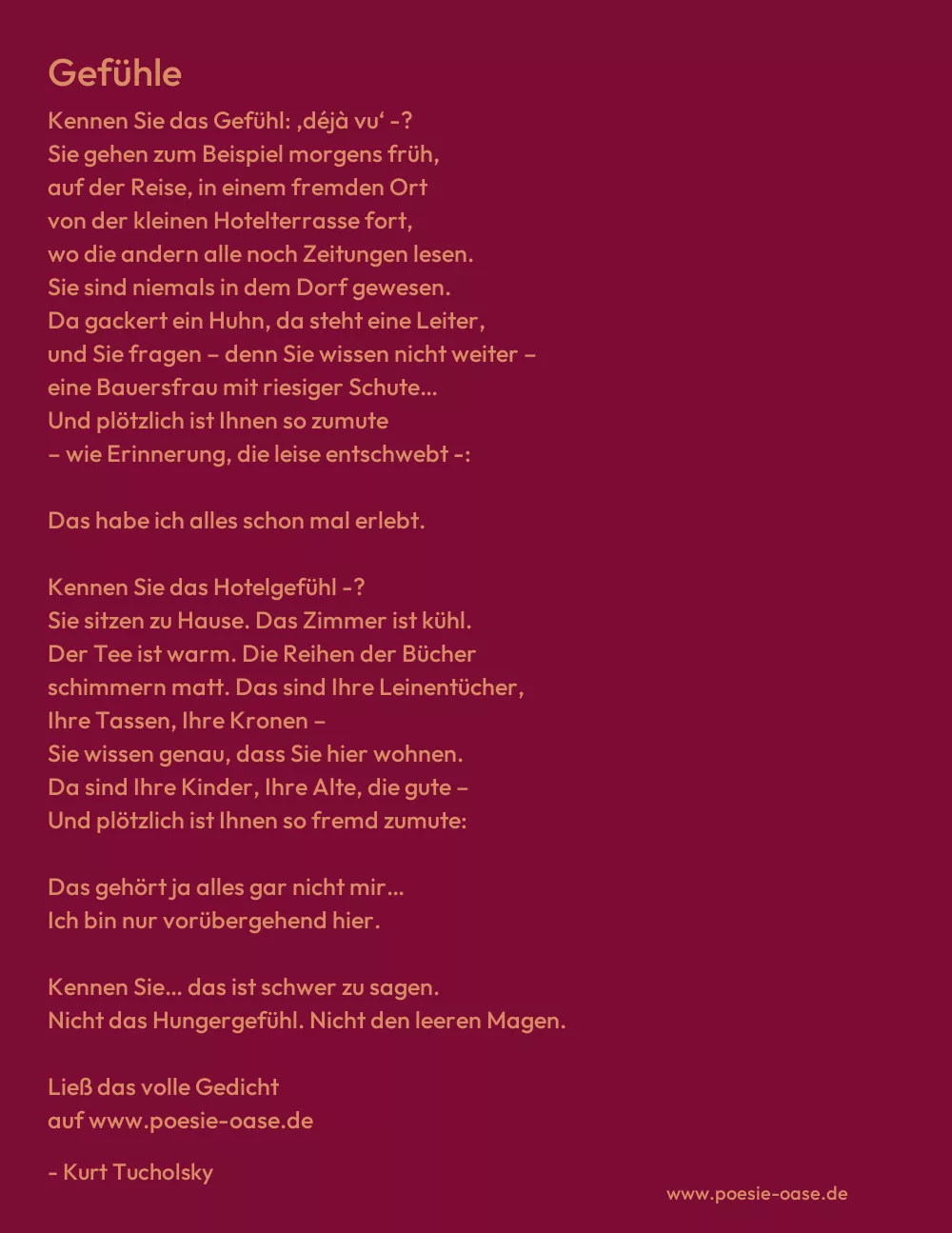Emotionen & Gefühle, Feiern, Feiertage, Freiheit & Sehnsucht, Gegenwart, Gemeinfrei, Götter, Heimat & Identität, Länder, Legenden, Wissenschaft & Technik
Gefühle
Kennen Sie das Gefühl: ‚déjà vu‘ -?
Sie gehen zum Beispiel morgens früh,
auf der Reise, in einem fremden Ort
von der kleinen Hotelterrasse fort,
wo die andern alle noch Zeitungen lesen.
Sie sind niemals in dem Dorf gewesen.
Da gackert ein Huhn, da steht eine Leiter,
und Sie fragen – denn Sie wissen nicht weiter –
eine Bauersfrau mit riesiger Schute…
Und plötzlich ist Ihnen so zumute
– wie Erinnerung, die leise entschwebt -:
Das habe ich alles schon mal erlebt.
Kennen Sie das Hotelgefühl -?
Sie sitzen zu Hause. Das Zimmer ist kühl.
Der Tee ist warm. Die Reihen der Bücher
schimmern matt. Das sind Ihre Leinentücher,
Ihre Tassen, Ihre Kronen –
Sie wissen genau, dass Sie hier wohnen.
Da sind Ihre Kinder, Ihre Alte, die gute –
Und plötzlich ist Ihnen so fremd zumute:
Das gehört ja alles gar nicht mir…
Ich bin nur vorübergehend hier.
Kennen Sie… das ist schwer zu sagen.
Nicht das Hungergefühl. Nicht den leeren Magen.
Sie haben ja eben erst Frühstück gegessen.
Sie dürfen arbeiten, für die Interessen
des andern, um sich Brot zu kaufen
und wieder ins Büro zu laufen.
Hunger nicht.
Aber ein tiefes Hungern
nach allem, was schön ist: nicht immer so lungern –
auch einmal ausschlafen – reisen können –
sich auch einmal Überflüssiges gönnen.
Nicht immer nur Tag-für-Tag-Arbeiter,
ein bisschen mehr, ein bisschen weiter…
Sein Auskommen haben, jahraus, jahrein…?
Es ist alles eine Nummer zu klein.
Hunger nach Farben, nach der Welt, die so weit –
Kurz: das Gefühl der Popligkeit.
Eine alte, ewig böse Geschichte.
Aber darüber macht man keine Gedichte.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
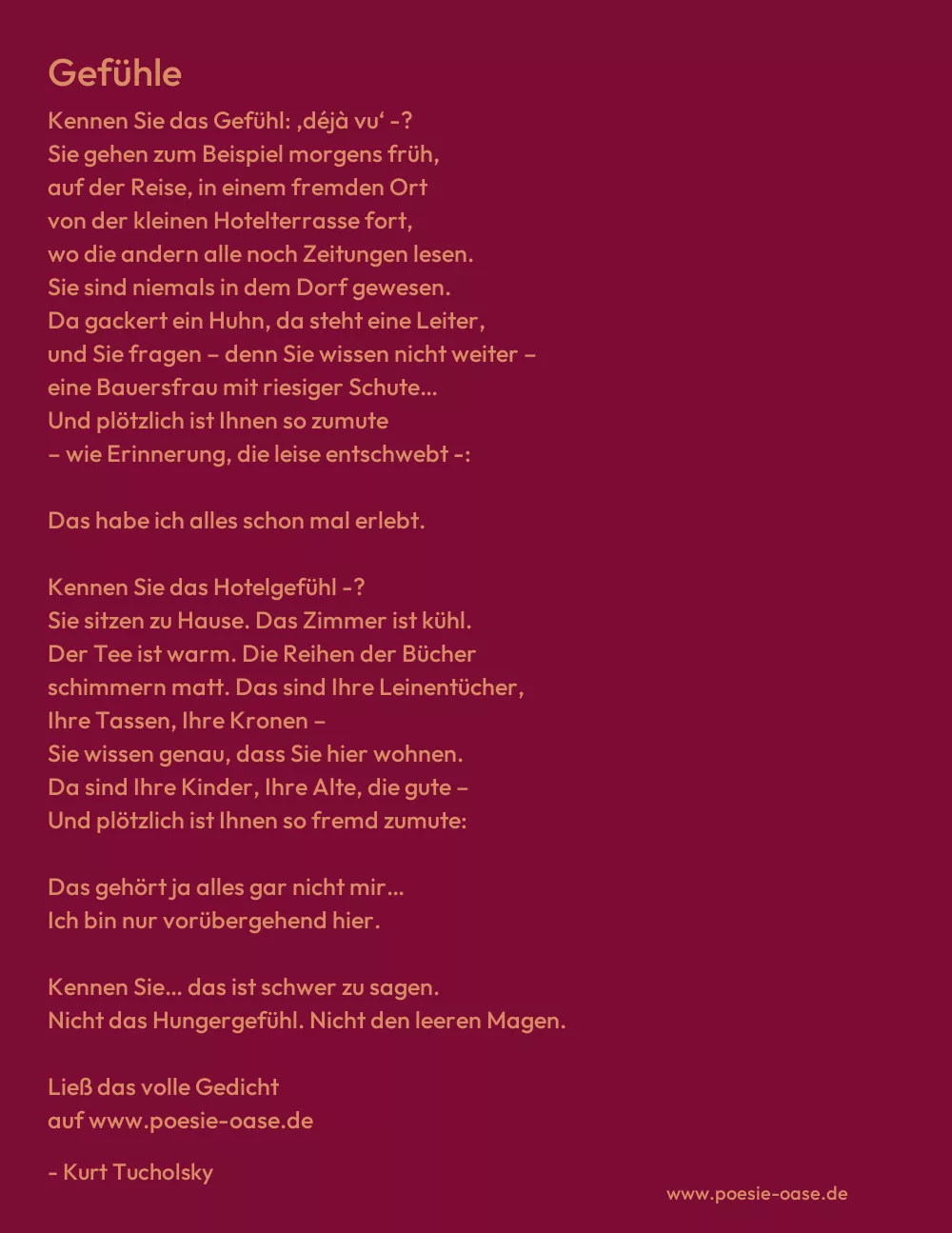
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Gefühle“ von Kurt Tucholsky ist eine nachdenkliche, leise Anklage gegen die innere Leere und das Gefühl der Entfremdung im bürgerlichen Alltag. In drei lose verbundenen Szenen beschreibt Tucholsky unterschiedliche emotionale Zustände – das Déjà-vu, die Fremdheit im eigenen Zuhause und ein namenloses Verlangen nach einem „Mehr“ im Leben. Dabei bedient er sich eines ruhigen, prosanahen Tons, der beinahe beiläufig wirkt, aber eine tiefe existenzielle Unzufriedenheit offenbart.
Die erste Szene beschreibt das bekannte Gefühl des Déjà-vu – eine seltsame, nicht erklärbare Empfindung der Wiederholung an einem Ort, der objektiv fremd ist. Es ist ein Moment, in dem die Zeit zu fließen scheint, Erinnerung und Gegenwart verschwimmen. Doch statt Trost oder Bedeutung birgt dieser Moment eher eine leise Irritation, eine Unsicherheit über die eigene Verortung in der Welt.
In der zweiten Szene wird dieses Motiv der Entfremdung vertieft: Das Zuhause – Inbegriff von Sicherheit und Vertrautheit – erscheint plötzlich wie ein Hotelzimmer, wie ein Ort, an dem man nur „vorübergehend“ ist. Die eigene Existenz wirkt provisorisch, das Leben wie eine Rolle, die man zwar spielt, aber nicht besitzt. Diese Fremdheit im Vertrauten ist ein zentrales Thema der Moderne, das Tucholsky hier in besonders zugänglicher, klarer Sprache schildert.
Der dritte Abschnitt bringt die unausgesprochene Sehnsucht auf den Punkt: ein „Hunger“, der sich nicht auf das Materielle bezieht, sondern auf Lebensqualität, Sinn, Schönheit und Freiheit. Es ist ein Wunsch nach Farben, Weite, Genuss – eine Rebellion gegen das enge Korsett der Arbeits- und Konsumgesellschaft. Das Leben, so scheint es, ist „eine Nummer zu klein“, und dieser Zustand wird als schmerzhaft empfunden – aber ohne Pathos, eher als stilles Bedauern.
Die Schlusszeile – „Aber darüber macht man keine Gedichte“ – ist doppelt ironisch. Einerseits verweist sie auf gesellschaftliche Konventionen, die solche Gefühle als unwichtig oder peinlich abtun. Andererseits ist das Gedicht selbst der Beweis dafür, dass man gerade darüber schreiben muss. Tucholsky gibt damit jenen „kleinen“, alltäglichen Gefühlen Raum, die sonst oft übersehen werden – und macht damit ihre Tiefe und Bedeutung sichtbar.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.