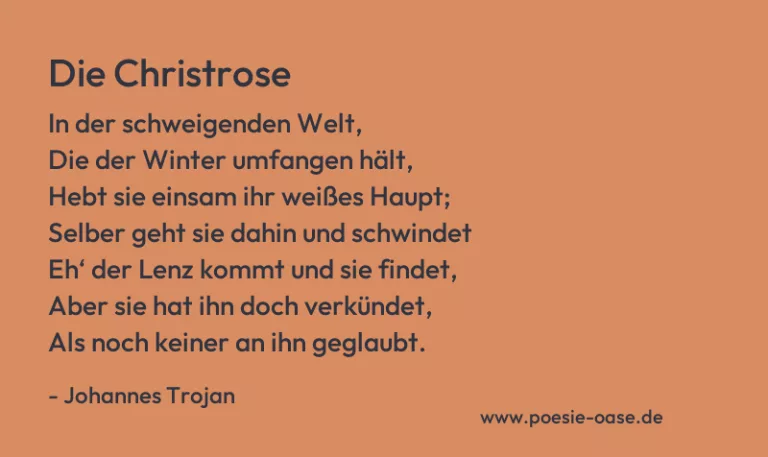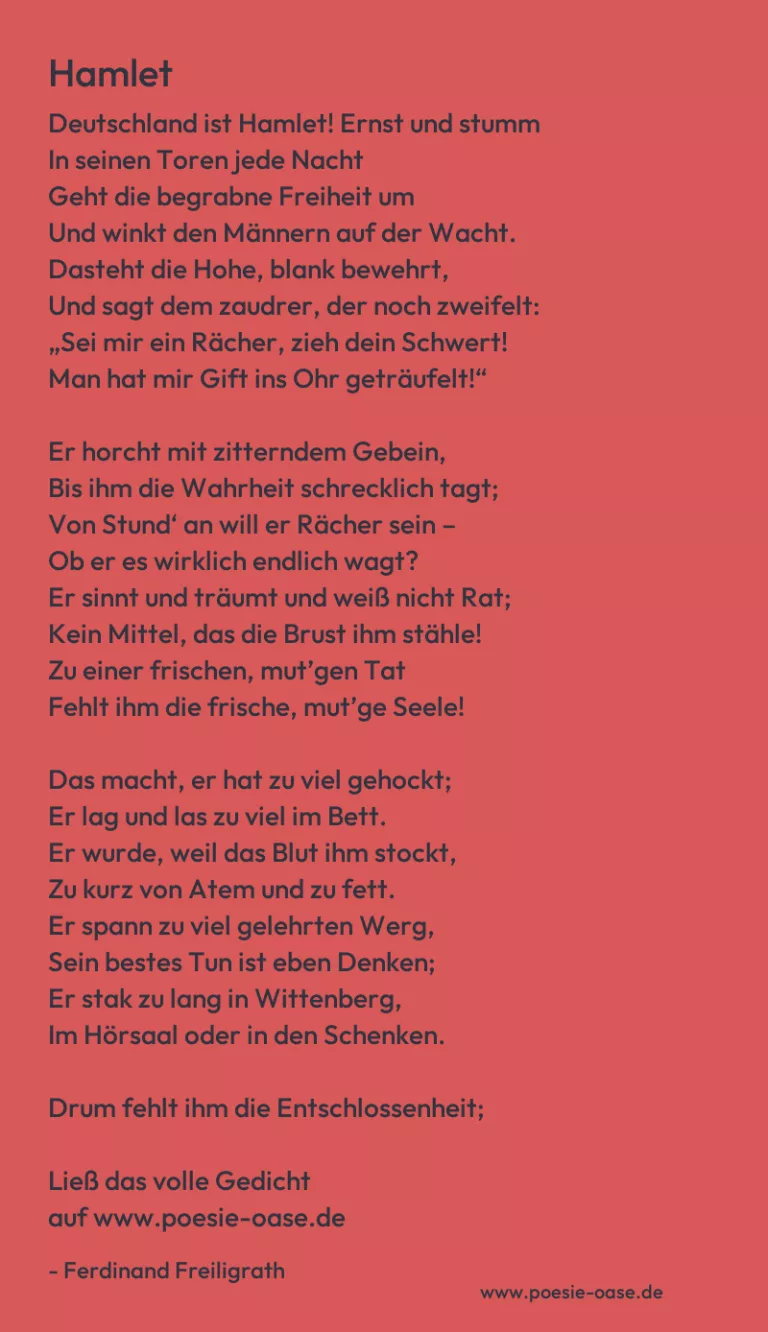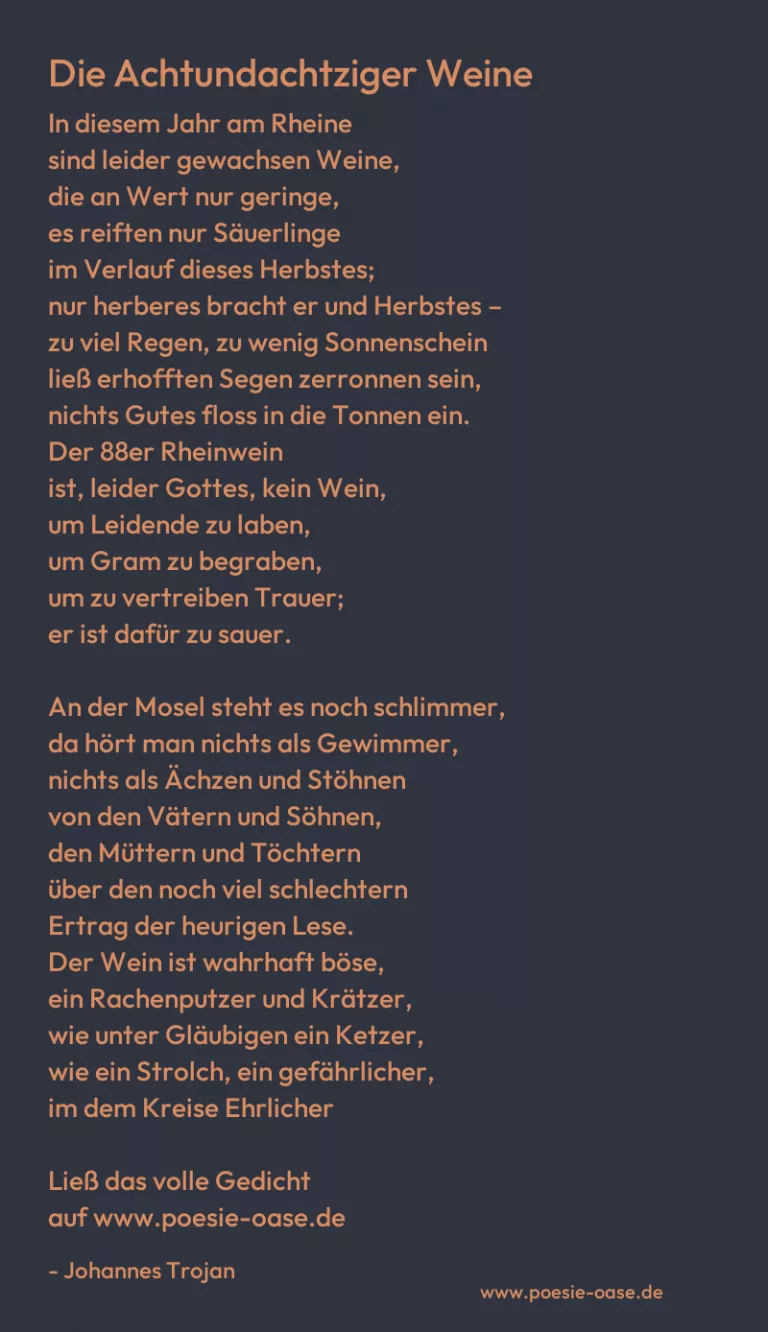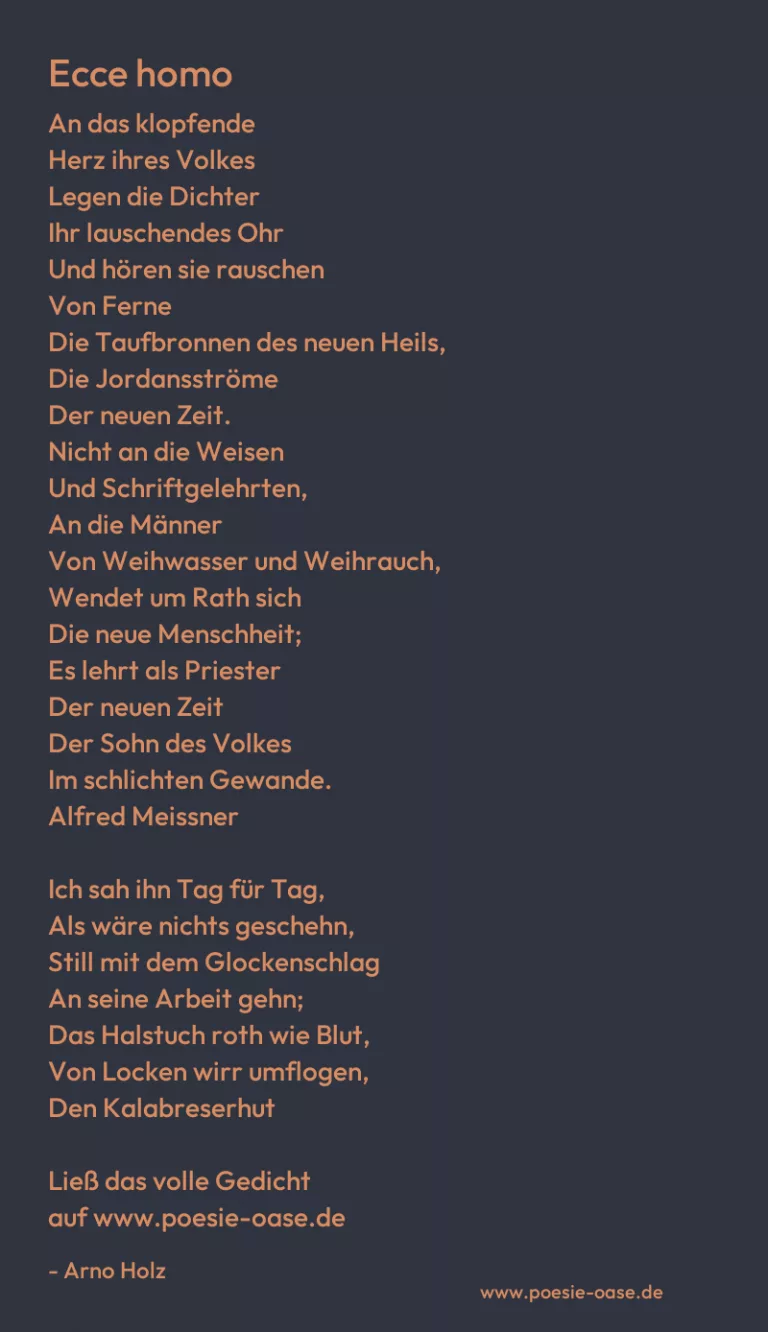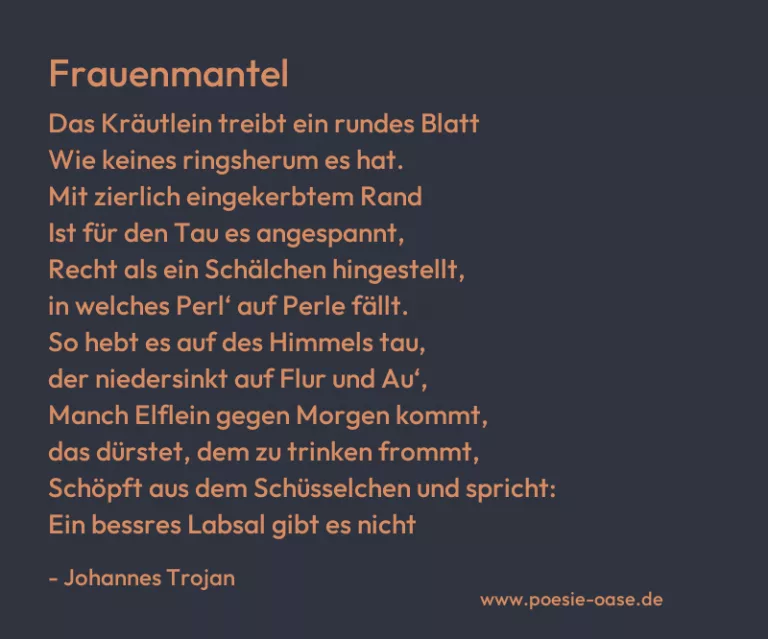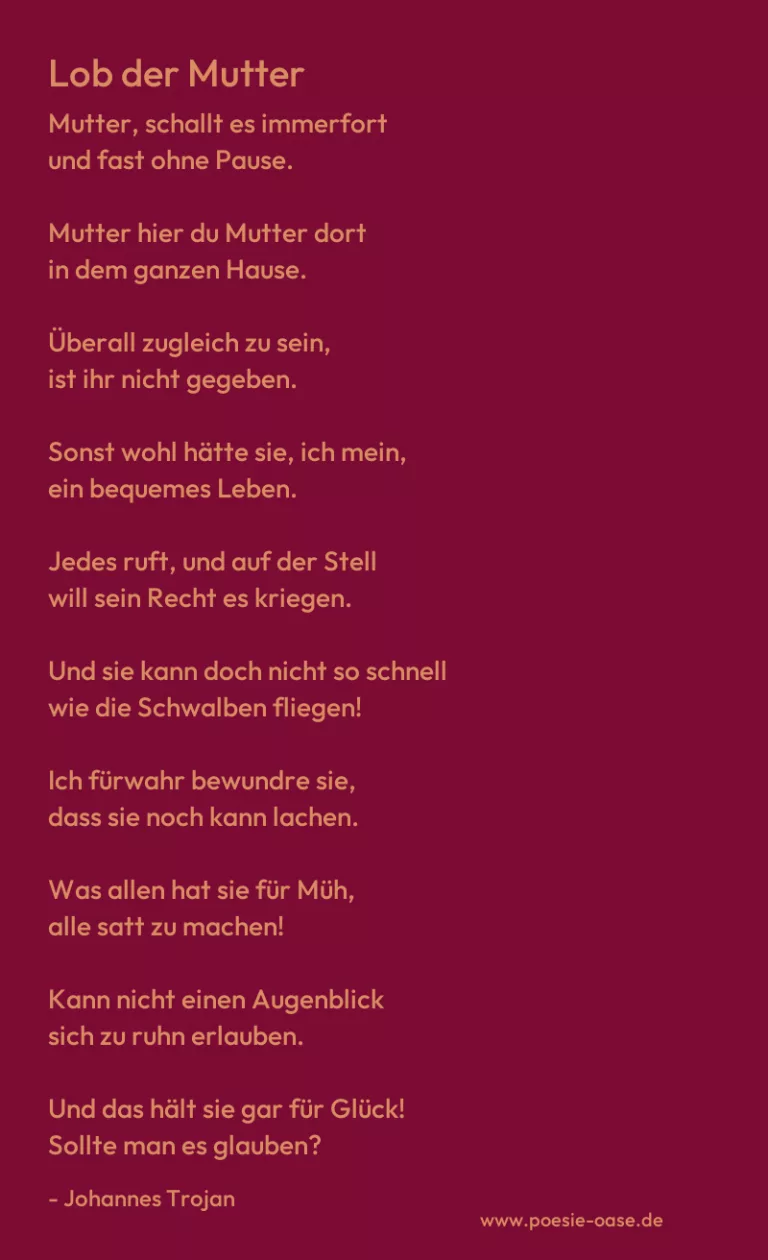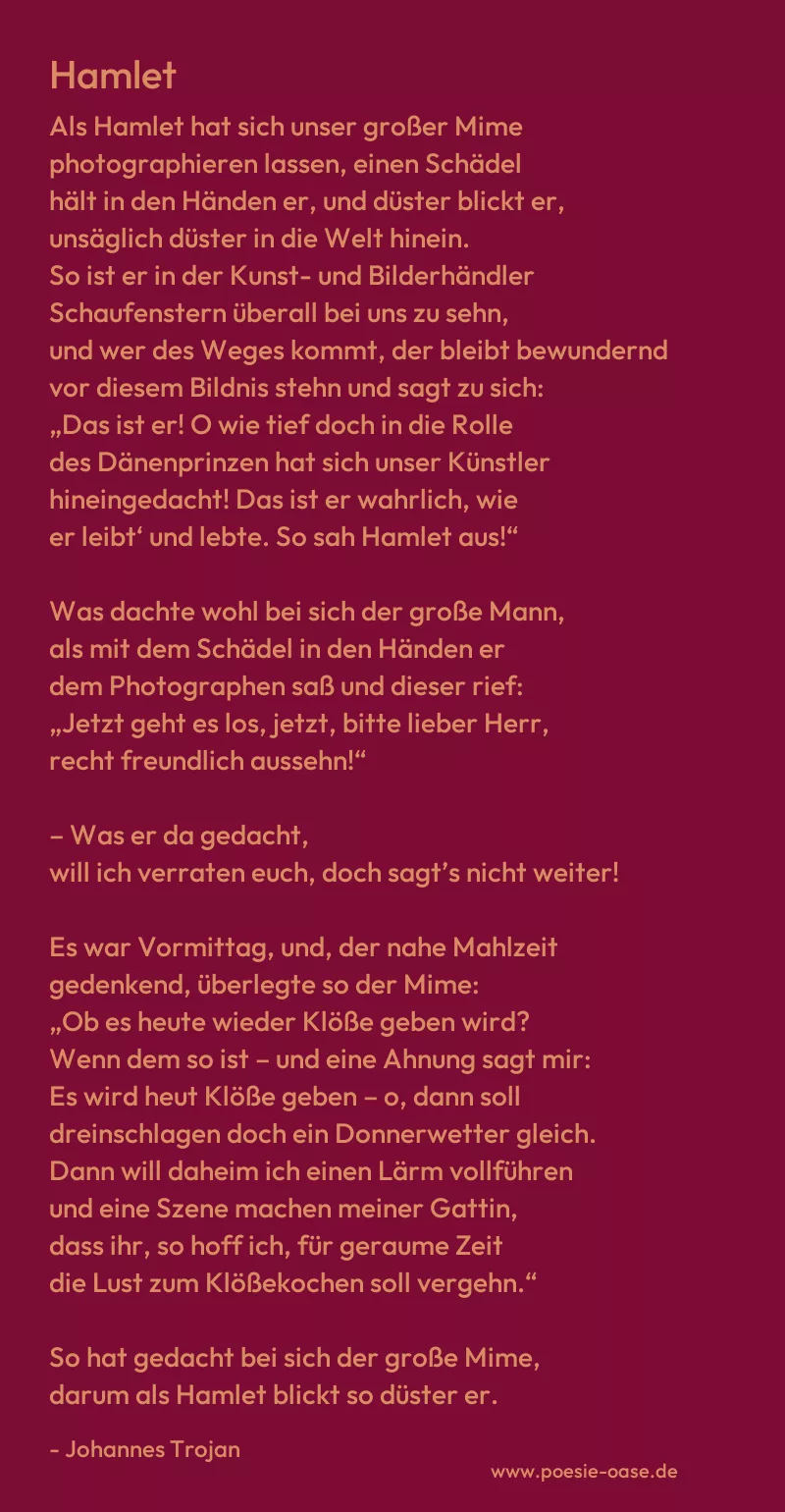Hamlet
Als Hamlet hat sich unser großer Mime
photographieren lassen, einen Schädel
hält in den Händen er, und düster blickt er,
unsäglich düster in die Welt hinein.
So ist er in der Kunst- und Bilderhändler
Schaufenstern überall bei uns zu sehn,
und wer des Weges kommt, der bleibt bewundernd
vor diesem Bildnis stehn und sagt zu sich:
„Das ist er! O wie tief doch in die Rolle
des Dänenprinzen hat sich unser Künstler
hineingedacht! Das ist er wahrlich, wie
er leibt‘ und lebte. So sah Hamlet aus!“
Was dachte wohl bei sich der große Mann,
als mit dem Schädel in den Händen er
dem Photographen saß und dieser rief:
„Jetzt geht es los, jetzt, bitte lieber Herr,
recht freundlich aussehn!“
– Was er da gedacht,
will ich verraten euch, doch sagt’s nicht weiter!
Es war Vormittag, und, der nahe Mahlzeit
gedenkend, überlegte so der Mime:
„Ob es heute wieder Klöße geben wird?
Wenn dem so ist – und eine Ahnung sagt mir:
Es wird heut Klöße geben – o, dann soll
dreinschlagen doch ein Donnerwetter gleich.
Dann will daheim ich einen Lärm vollführen
und eine Szene machen meiner Gattin,
dass ihr, so hoff ich, für geraume Zeit
die Lust zum Klößekochen soll vergehn.“
So hat gedacht bei sich der große Mime,
darum als Hamlet blickt so düster er.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
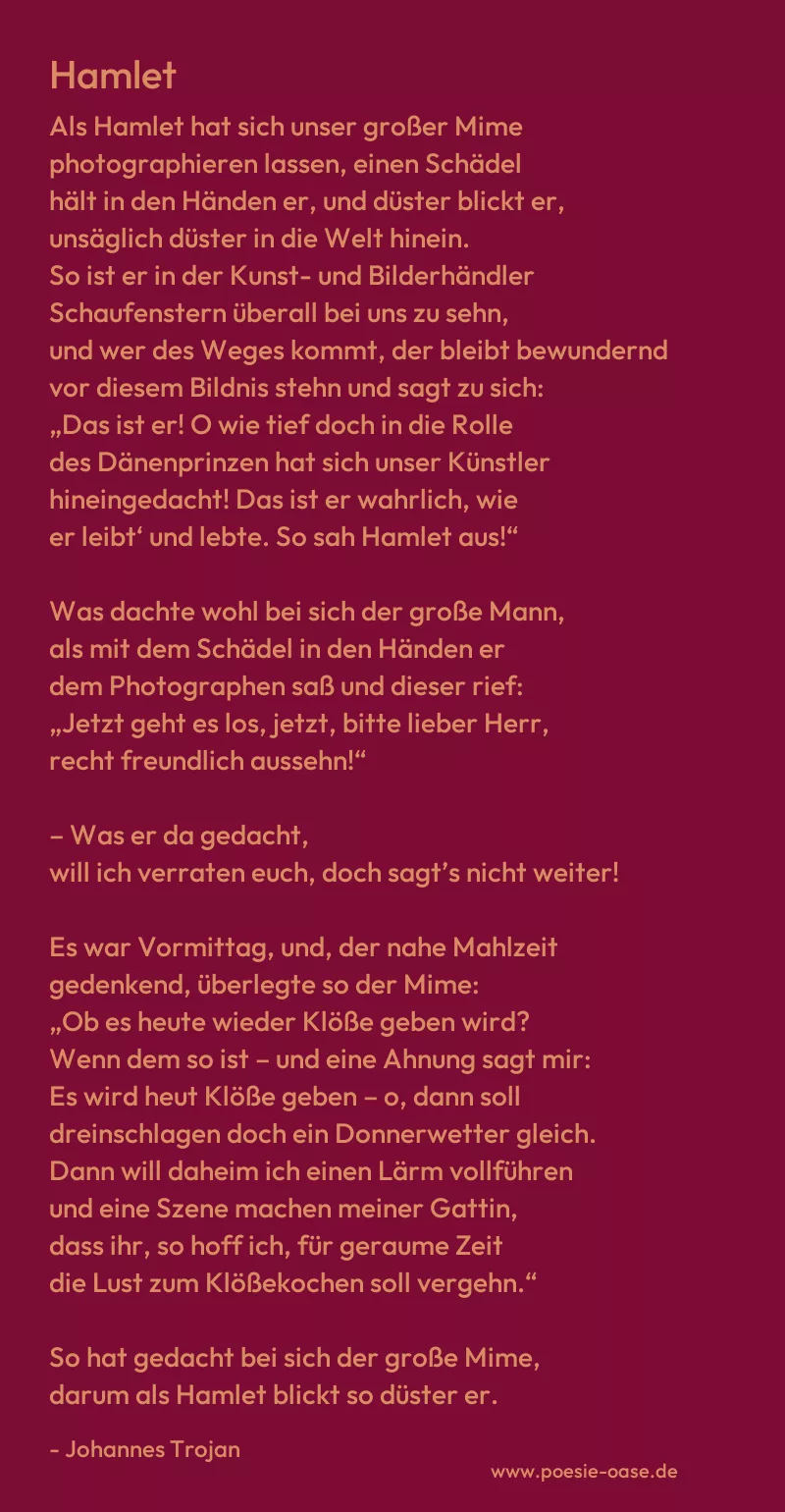
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Hamlet“ von Johannes Trojan nimmt auf humorvolle Weise das berühmte Theaterstück von Shakespeare auf und setzt sich mit der Darstellung von Hamlet durch einen Schauspieler auseinander. Es zeigt den Gegensatz zwischen der intensiven, dramatischen Rolle des Dänenprinzen und der banalen, alltäglichen Realität des Schauspielers, der die Rolle verkörpert. Der Schauspieler hält einen Schädel in der Hand, ein ikonisches Bild aus Shakespeares „Hamlet“, und blickt „unsäglich düster“ in die Welt, was ihn in den Augen der Zuschauer zu einer perfekten Darstellung des melancholischen Prinzen macht.
Trojan verweist darauf, wie die Zuschauer das Bild des Schauspielers im Schaufenster bewundern und glauben, dass dies die wahre Darstellung von Hamlet ist. Sie sehen in dem Bild den tiefen Ernst und die Tragik des Charakters und sind überzeugt, dass der Schauspieler „so sah Hamlet aus“. Doch der Blick hinter die Kulissen, den Trojan gewährt, entlarvt die Kluft zwischen Kunst und Leben: Der Schauspieler denkt bei der Aufnahme an alltägliche Dinge, wie etwa das bevorstehende Mittagessen und die Frage, ob es Klöße geben wird. Diese banalen Gedanken stehen in starkem Gegensatz zu der düsteren Atmosphäre, die die Rolle des Hamlet normalerweise verlangt.
Trojan nutzt diese humorvolle Wendung, um auf die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung eines Schauspielers und seiner tatsächlichen, privaten Existenz hinzuweisen. Der Schauspieler in der Rolle Hamlets denkt nicht an die großen Fragen des Lebens, sondern an alltägliche Belange wie das Mittagessen und an die „Szene“, die er zu Hause machen möchte. Die Vorstellung, dass Hamlet in Wirklichkeit von solchen trivialen Gedanken abgelenkt ist, sorgt für eine Ironie, die den ernsten, oft als tiefgründig wahrgenommenen Charakter des Hamlet aufhebt und die Trivialität des Schauspielerberufs in den Vordergrund rückt.
Indem Trojan das Bild des „großen Mimen“ mit einem alltäglichen, fast absurden Gedanken verknüpft, wird die Grenze zwischen der fiktionalen Welt von Hamlet und der Realität des Schauspielers auf humorvolle Weise verschwommen. Das Gedicht zeigt auf eine ironische Art, dass der Schauspieler, der Hamlet spielt, in Wirklichkeit ein Mensch mit den gleichen kleinen Sorgen und Gedanken wie jeder andere ist. Diese humorvolle Entzauberung der großen Rolle macht das Gedicht zu einer Reflexion über die Kluft zwischen Kunst und Leben.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.