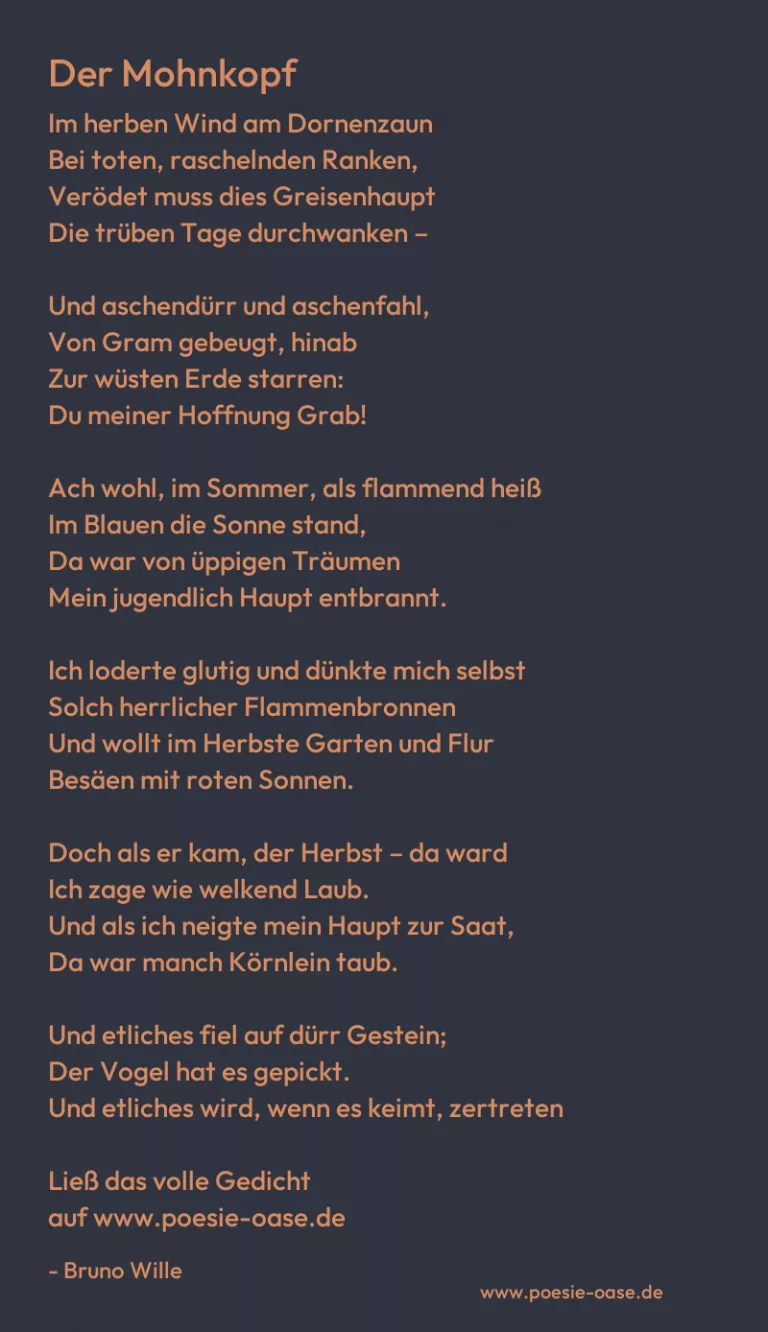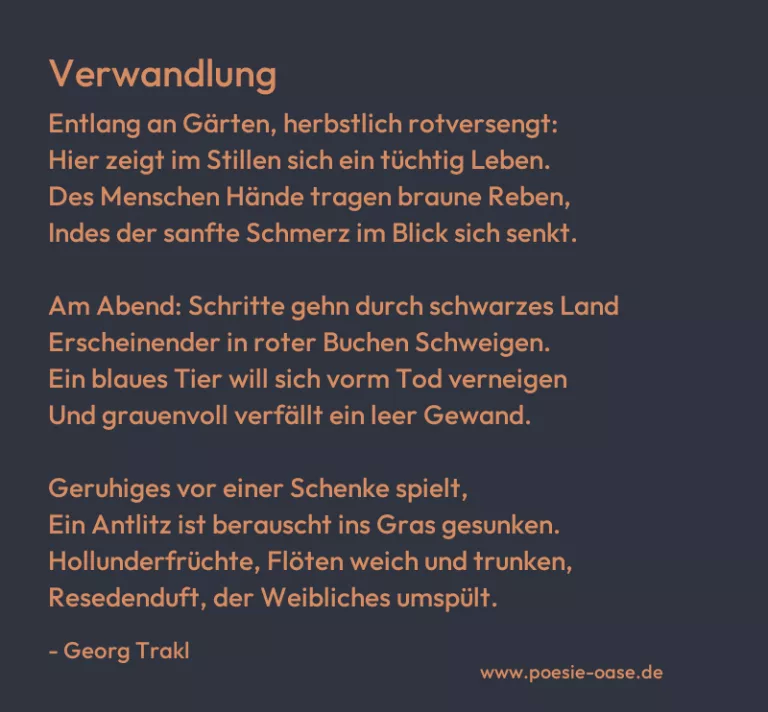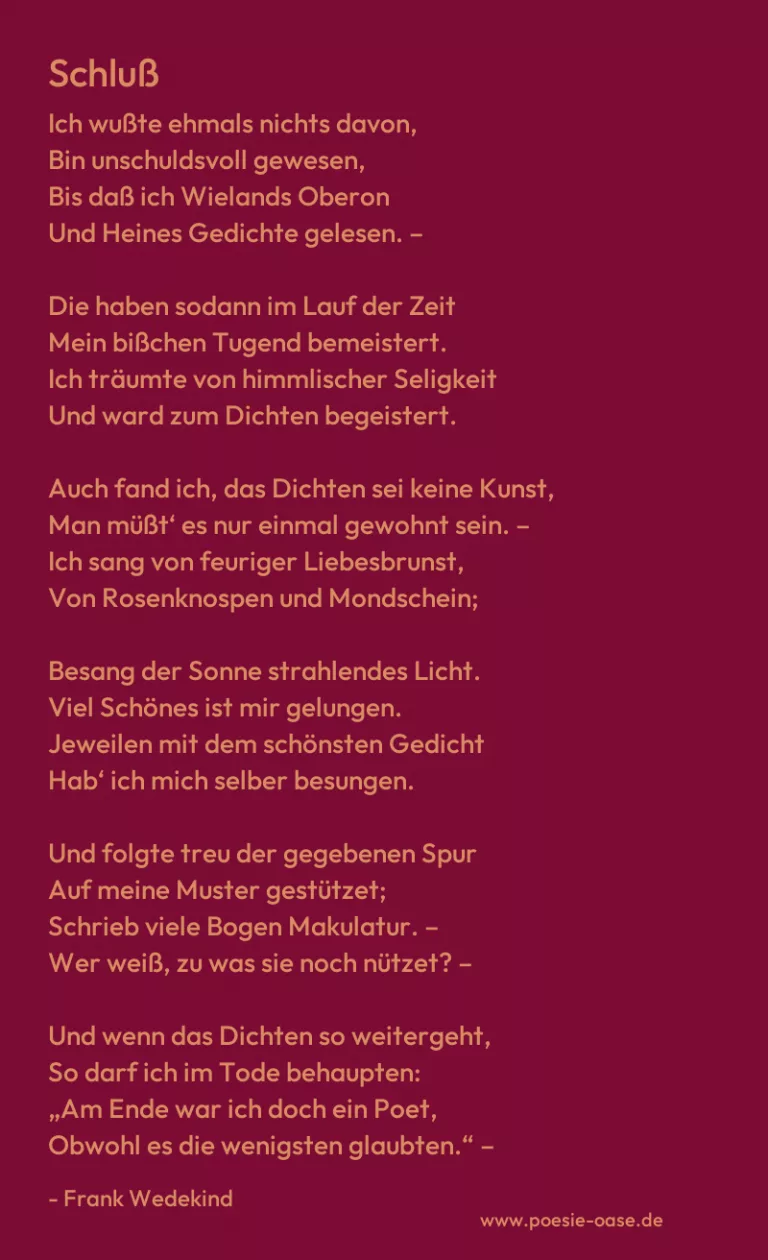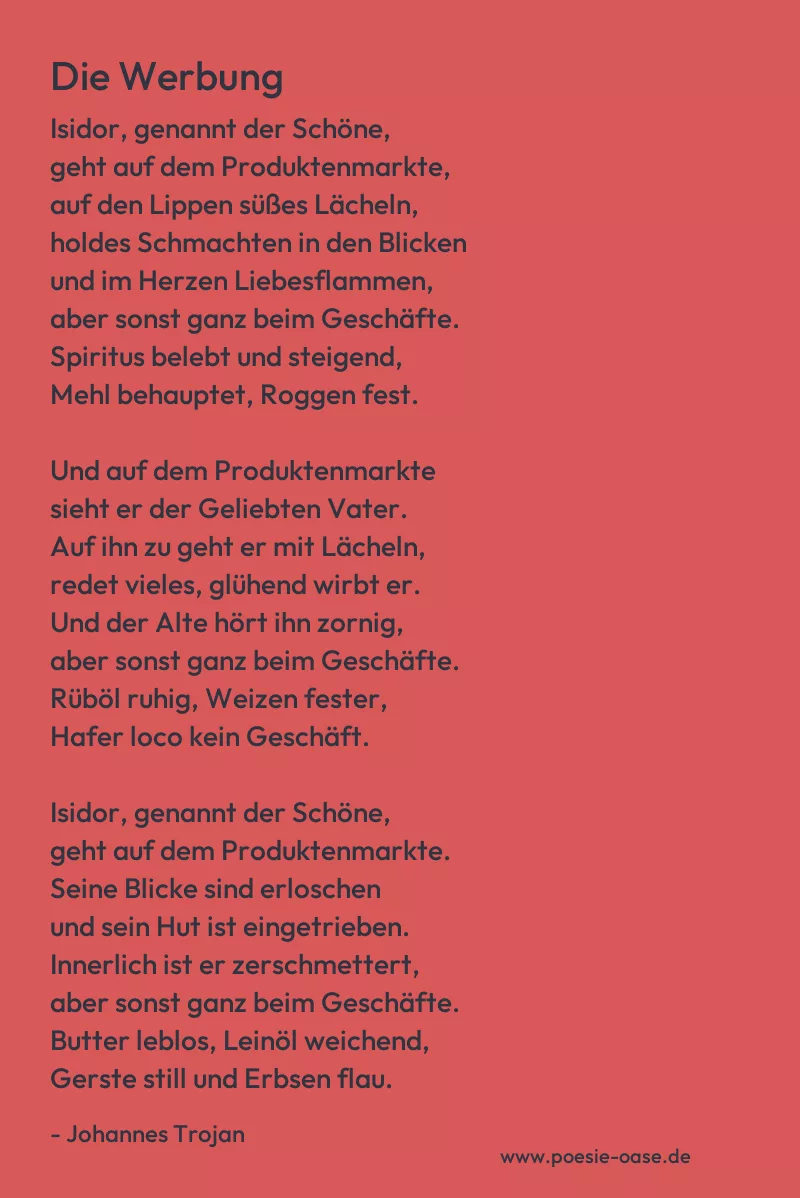Die Werbung
Isidor, genannt der Schöne,
geht auf dem Produktenmarkte,
auf den Lippen süßes Lächeln,
holdes Schmachten in den Blicken
und im Herzen Liebesflammen,
aber sonst ganz beim Geschäfte.
Spiritus belebt und steigend,
Mehl behauptet, Roggen fest.
Und auf dem Produktenmarkte
sieht er der Geliebten Vater.
Auf ihn zu geht er mit Lächeln,
redet vieles, glühend wirbt er.
Und der Alte hört ihn zornig,
aber sonst ganz beim Geschäfte.
Rüböl ruhig, Weizen fester,
Hafer loco kein Geschäft.
Isidor, genannt der Schöne,
geht auf dem Produktenmarkte.
Seine Blicke sind erloschen
und sein Hut ist eingetrieben.
Innerlich ist er zerschmettert,
aber sonst ganz beim Geschäfte.
Butter leblos, Leinöl weichend,
Gerste still und Erbsen flau.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
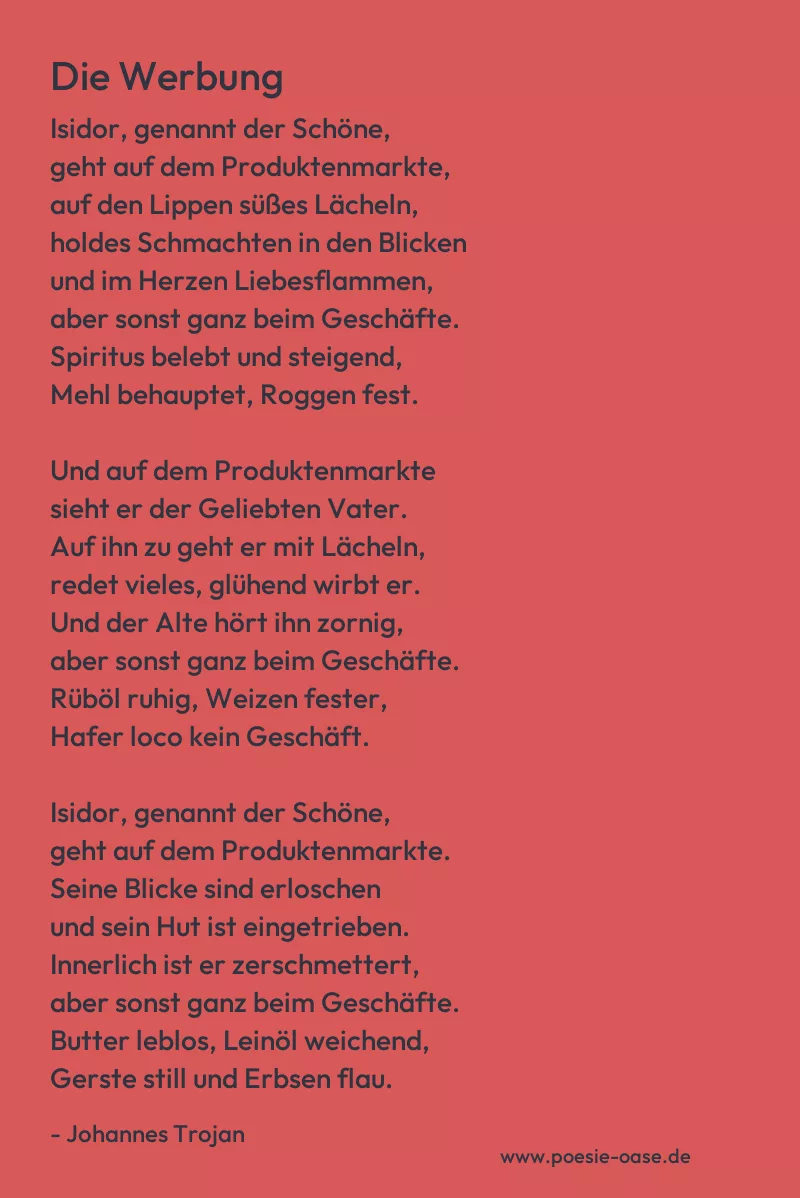
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Werbung“ von Johannes Trojan behandelt auf ironische Weise die Spannung zwischen persönlicher Leidenschaft und beruflicher Pflicht, wobei es die Figur des Isidor, „genannt der Schöne“, als ein Symbol für den inneren Konflikt zwischen Gefühl und Verstand darstellt. Zu Beginn wird Isidor als ein charmanter und leidenschaftlicher Mann beschrieben, der „auf dem Produktenmarkte“ unterwegs ist. Mit seinem „süßen Lächeln“ und dem „holden Schmachten in den Blicken“ scheint er voller Lebensfreude und Liebe zu sein. Doch trotz dieser äußeren Erscheinung ist sein Herz „ganz beim Geschäfte“. Hier wird bereits der Widerspruch zwischen seiner äußeren Anziehungskraft und seiner beruflichen Verpflichtung angedeutet.
In der zweiten Strophe begegnet Isidor dem „Vater der Geliebten“ auf dem Markt. Er geht auf ihn zu, lächelt ihn an und redet „vieles“, wobei er „glühend wirbt“. Diese Werbung – die charmante und leidenschaftliche Darstellung seiner Produkte – wird jedoch von dem alten Mann „zornig“ gehört. Dennoch bleibt der Vater „ganz beim Geschäfte“, was darauf hinweist, dass er sich nicht von den emotionalen Appellen des jungen Mannes ablenken lässt. Die unterschiedlichen Produktbezeichnungen wie „Rüböl ruhig“ oder „Hafer loco kein Geschäft“ symbolisieren die nüchterne Welt des Handels und den Mangel an Begeisterung oder Interesse an Isidors leidenschaftlicher Werbung. Der Kontrast zwischen Isidors lebendigen Gefühlen und der sachlichen Einstellung des Vaters wird hier besonders deutlich.
Die letzte Strophe verdeutlicht den emotionalen Verfall von Isidor. Seine „Blicke sind erloschen“ und „sein Hut ist eingetrieben“, was auf eine Erschöpfung und innere Zerstörung hinweist. Der Mann, der zu Beginn des Gedichts von Leidenschaft und Lebensfreude erfüllt war, erscheint nun gebrochen und leer. Trotz seiner inneren Zerrissenheit bleibt er äußerlich „ganz beim Geschäfte“, was die ironische Wendung des Gedichts verstärkt. Die Produktbezeichnungen wie „Butter leblos“ oder „Gerste still“ spiegeln nicht nur den körperlichen Verfall von Isidor, sondern auch den Verlust an Leben und Begeisterung wider. Auch hier bleibt das Geschäft die einzige Konstante – sowohl für Isidor als auch für den Markt, der sich nicht von den menschlichen Emotionen beeinflussen lässt.
Trojan zeigt in diesem Gedicht, wie äußere Erscheinung und innere Emotionen miteinander in Konflikt geraten können, insbesondere in einer Welt, in der der kommerzielle Erfolg über die persönlichen Werte gestellt wird. Isidors zunehmende Entfremdung von seinen eigenen Gefühlen und seine Verschmelzung mit dem Geschäftsalltag sind eine scharfe Kritik an der Entfremdung des Individuums in einer kapitalistischen Gesellschaft. Die Verbindung von Geschäft und persönlichen Gefühlen wird in diesem Gedicht humorvoll und doch tiefgründig behandelt, indem Trojan den Verfall einer Figur zeigt, die von der Geschäftswelt zunehmend entmenschlicht wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.