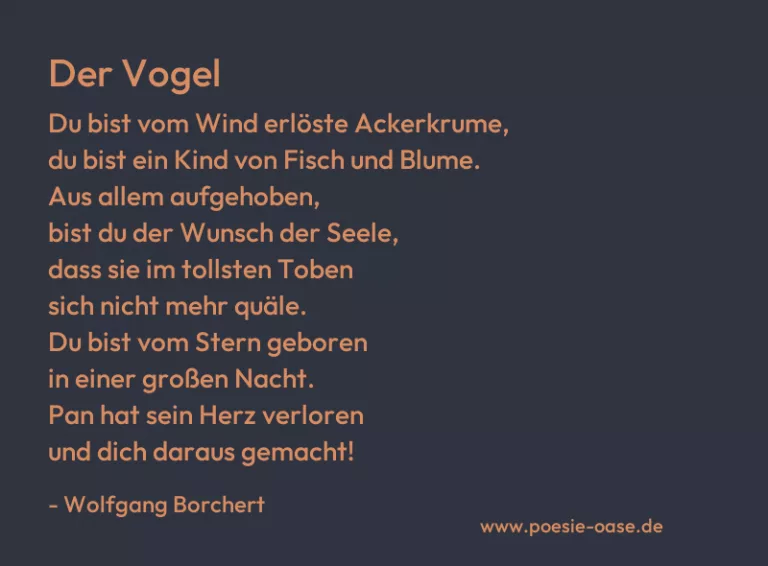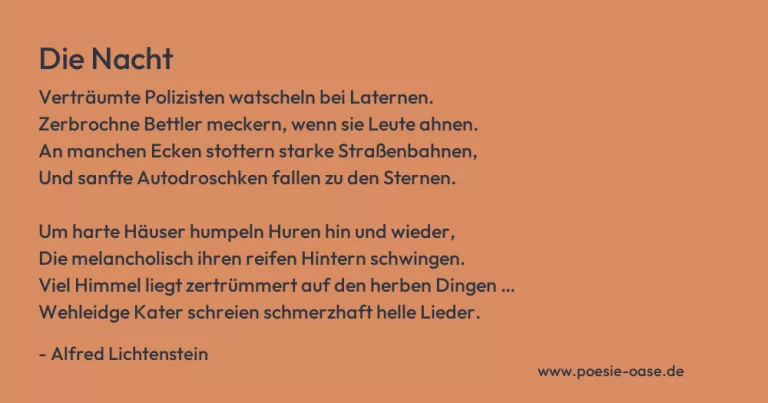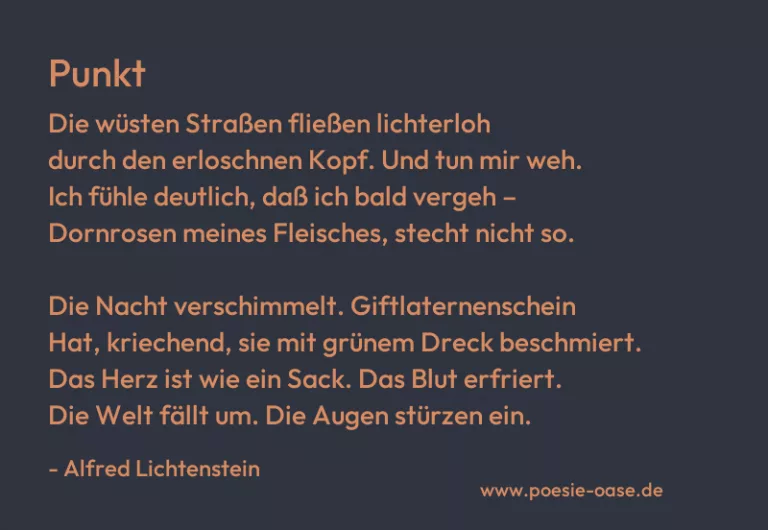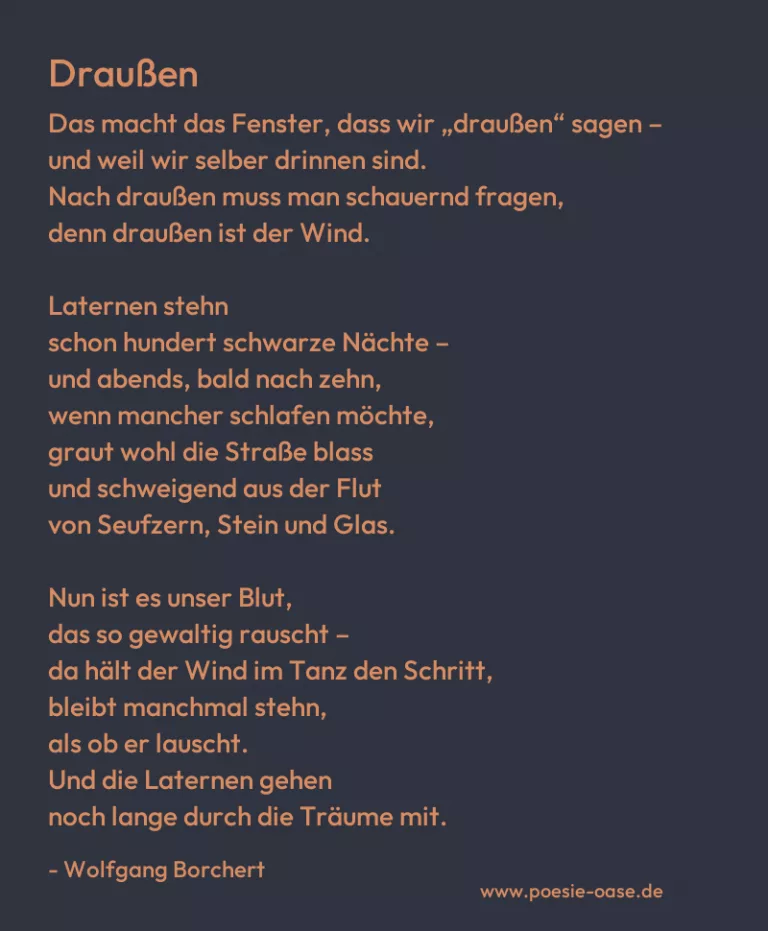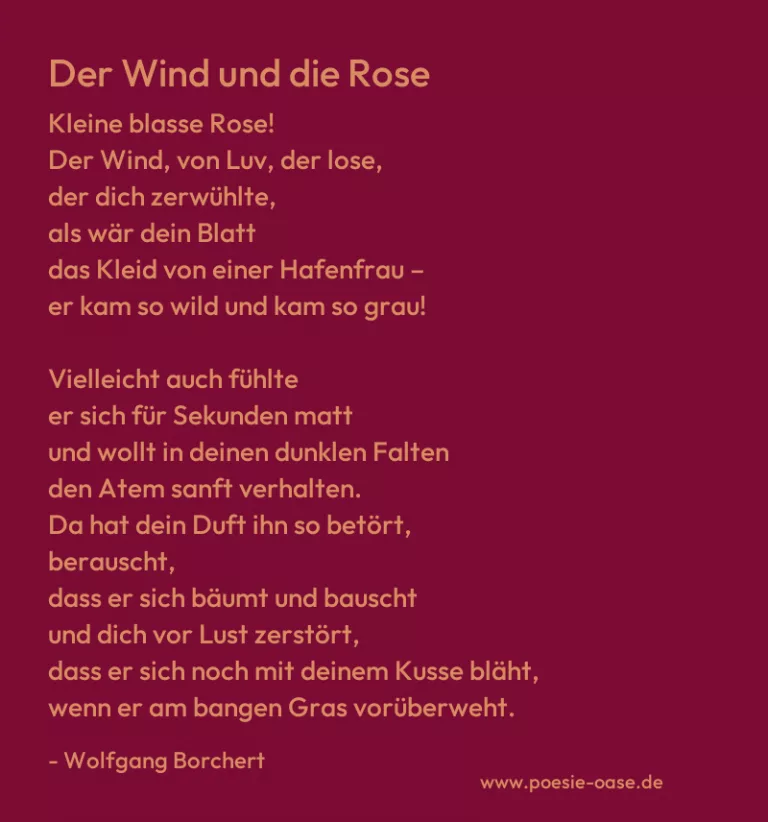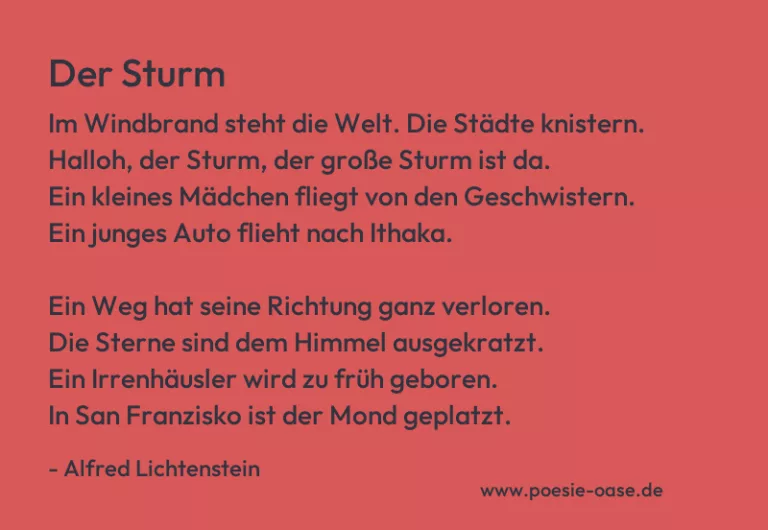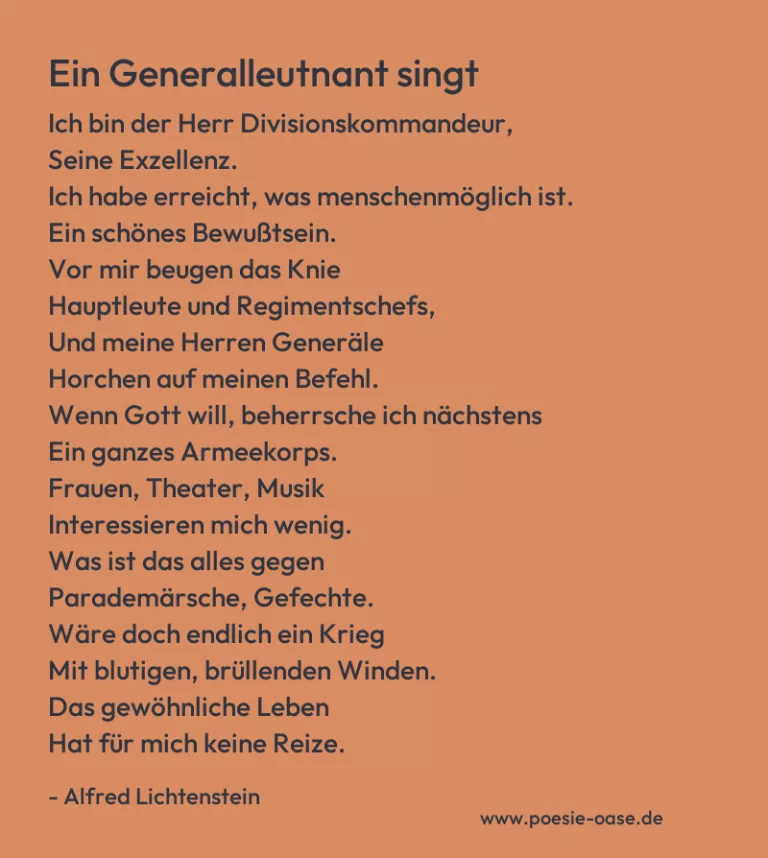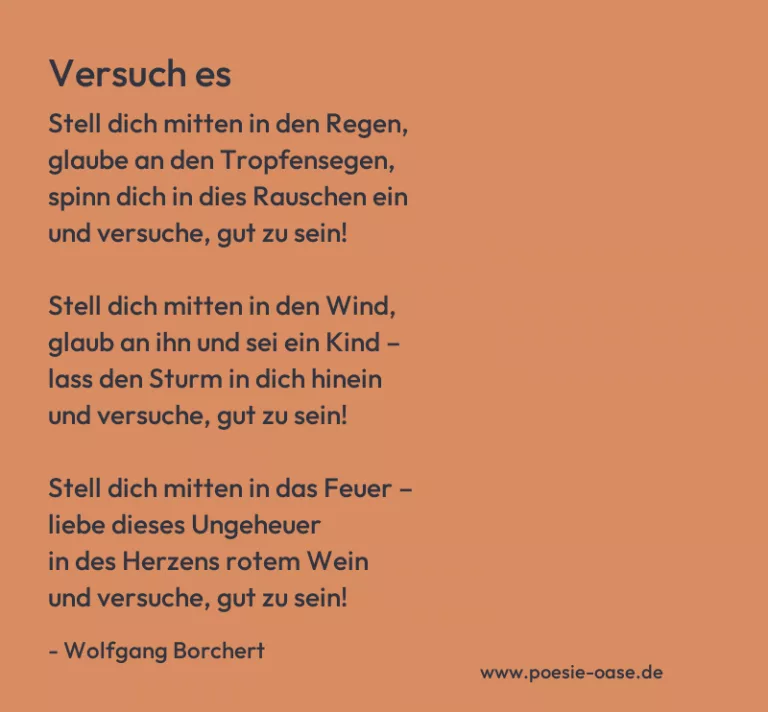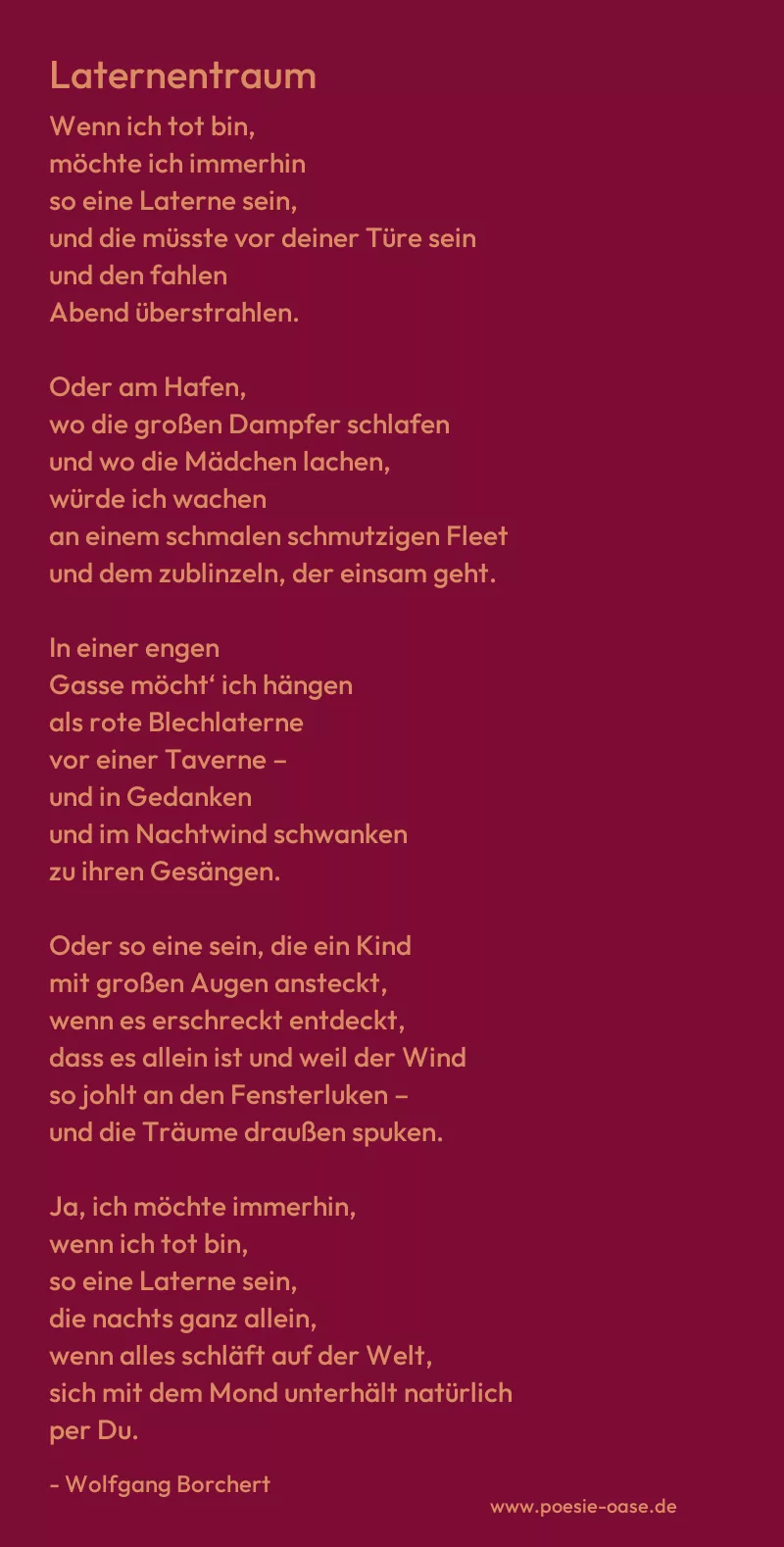Laternentraum
Wenn ich tot bin,
möchte ich immerhin
so eine Laterne sein,
und die müsste vor deiner Türe sein
und den fahlen
Abend überstrahlen.
Oder am Hafen,
wo die großen Dampfer schlafen
und wo die Mädchen lachen,
würde ich wachen
an einem schmalen schmutzigen Fleet
und dem zublinzeln, der einsam geht.
In einer engen
Gasse möcht‘ ich hängen
als rote Blechlaterne
vor einer Taverne –
und in Gedanken
und im Nachtwind schwanken
zu ihren Gesängen.
Oder so eine sein, die ein Kind
mit großen Augen ansteckt,
wenn es erschreckt entdeckt,
dass es allein ist und weil der Wind
so johlt an den Fensterluken –
und die Träume draußen spuken.
Ja, ich möchte immerhin,
wenn ich tot bin,
so eine Laterne sein,
die nachts ganz allein,
wenn alles schläft auf der Welt,
sich mit dem Mond unterhält natürlich
per Du.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
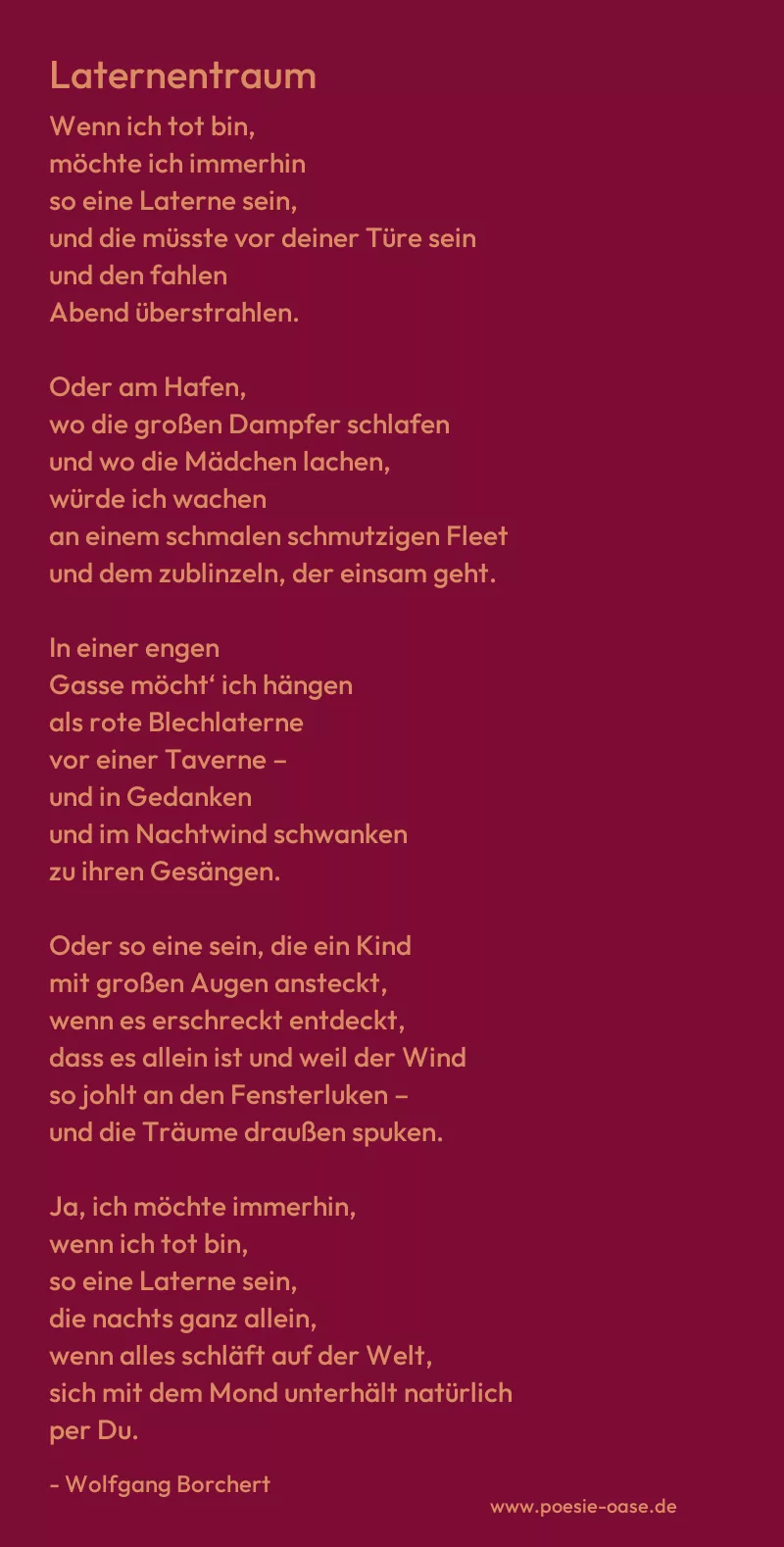
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Laternentraum“ von Wolfgang Borchert entwirft ein poetisches Bild vom Weiterleben nach dem Tod – nicht als Mensch, sondern in der bescheidenen, aber symbolisch aufgeladenen Gestalt einer Laterne. Der Wunsch des lyrischen Ichs, nach dem Tod als Lichtquelle weiterzuexistieren, verweist auf ein Bedürfnis nach Trost, Wärme und Nähe, das auch über das eigene Leben hinaus Wirkung entfalten möchte.
Die Laterne wird dabei in verschiedenen Szenarien imaginiert: vor der Tür einer geliebten Person, am Hafen, in einer engen Gasse oder als Trostspender für ein Kind. Diese Orte stehen symbolisch für Einsamkeit, Melancholie, aber auch für zwischenmenschliche Nähe und Sehnsucht. Die Laterne ist nicht nur Licht in der Dunkelheit, sondern ein stiller Begleiter, Beobachter und Tröster – ein Bild für eine stille Form von Fürsorge über den Tod hinaus.
Sprachlich lebt das Gedicht von einfachen, aber bildreichen Versen. Der wiederholte Konjunktiv („möchte ich sein“) unterstreicht den Wunschcharakter der Aussagen, während die konkreten Szenerien eine träumerische, fast kindliche Vorstellungswelt erschaffen. Das Motiv des Lichts kontrastiert mit der Dunkelheit, die im Tod, in der Nacht oder im Alleinsein erscheint, und hebt zugleich das tröstende Potenzial des lyrischen Ichs hervor.
Im letzten Abschnitt tritt eine sanfte Versöhnlichkeit mit dem Tod hervor: Die Vorstellung, sich mit dem Mond „per Du“ zu unterhalten, verleiht dem Gedicht eine zarte, beinahe humorvolle Note. Der Tod wird nicht als Ende, sondern als Übergang in eine andere, stille Form der Existenz verstanden – als Lichtquelle in der Dunkelheit, die weiterhin Teil der Welt bleibt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.