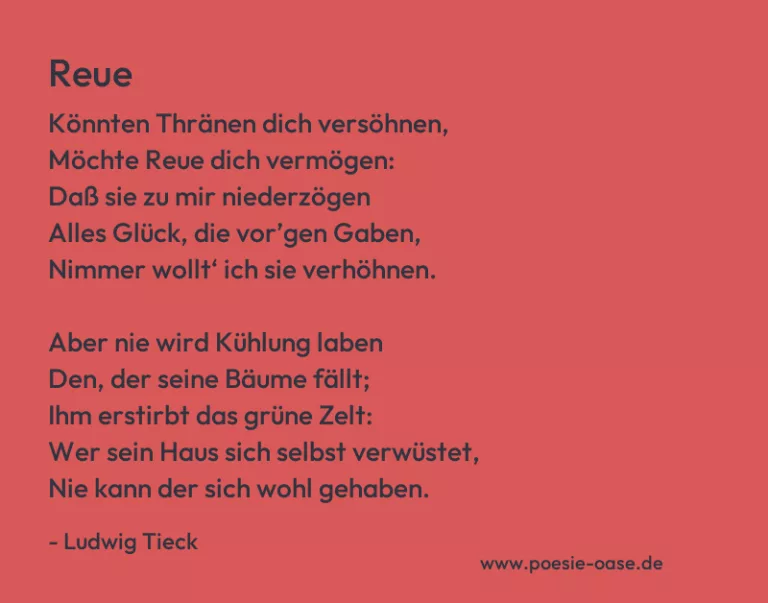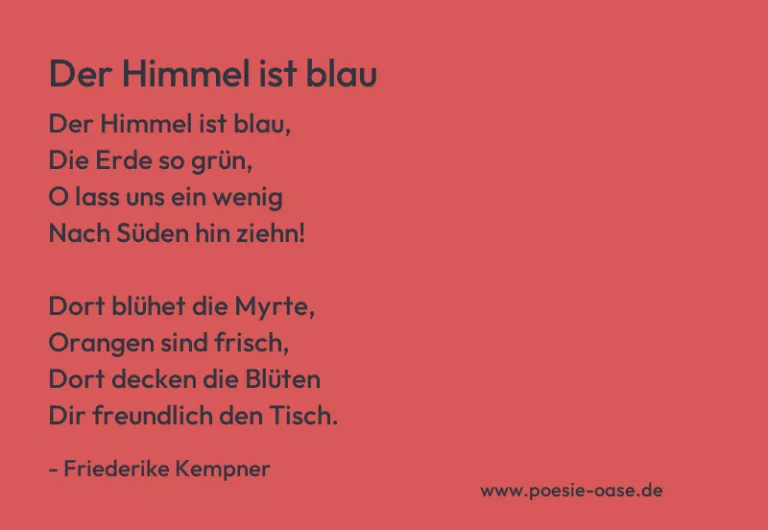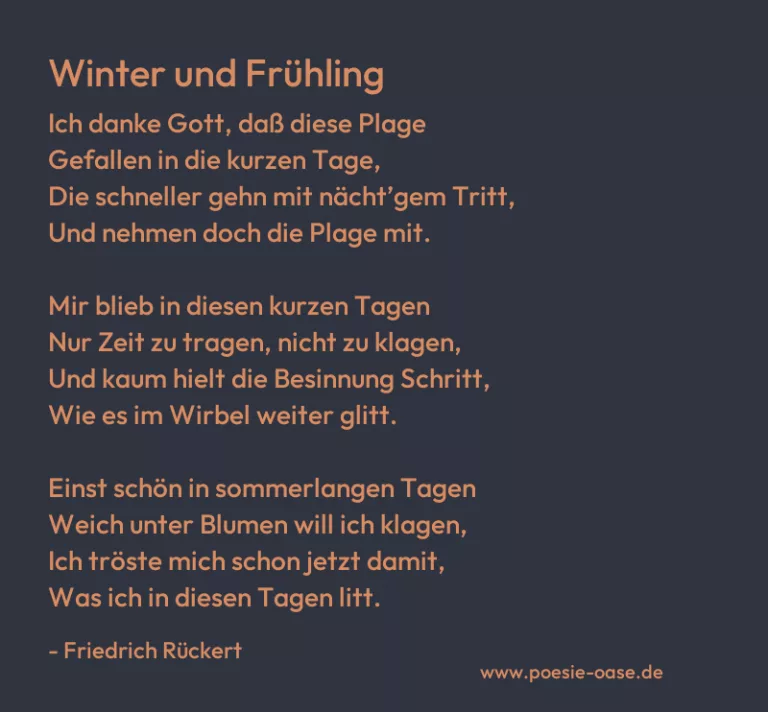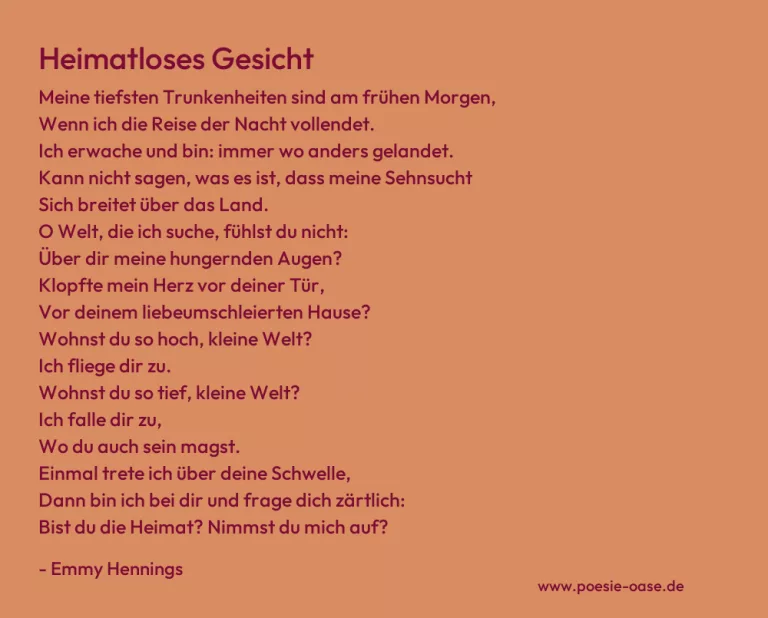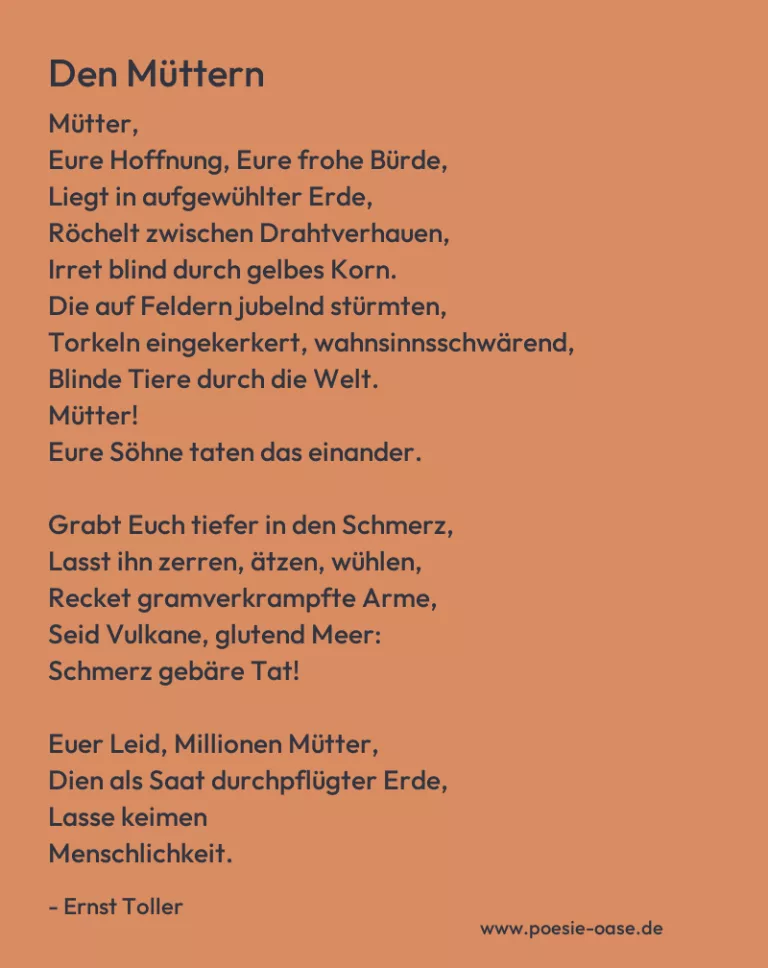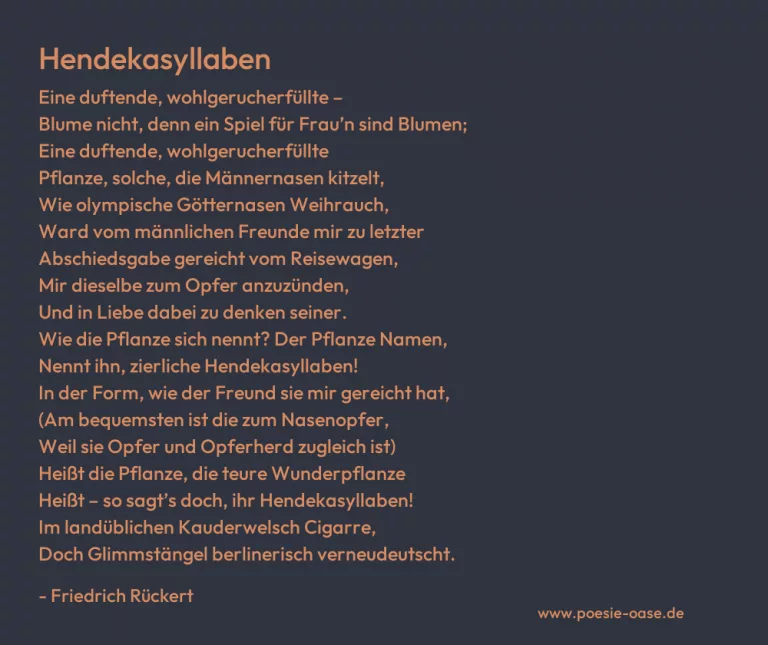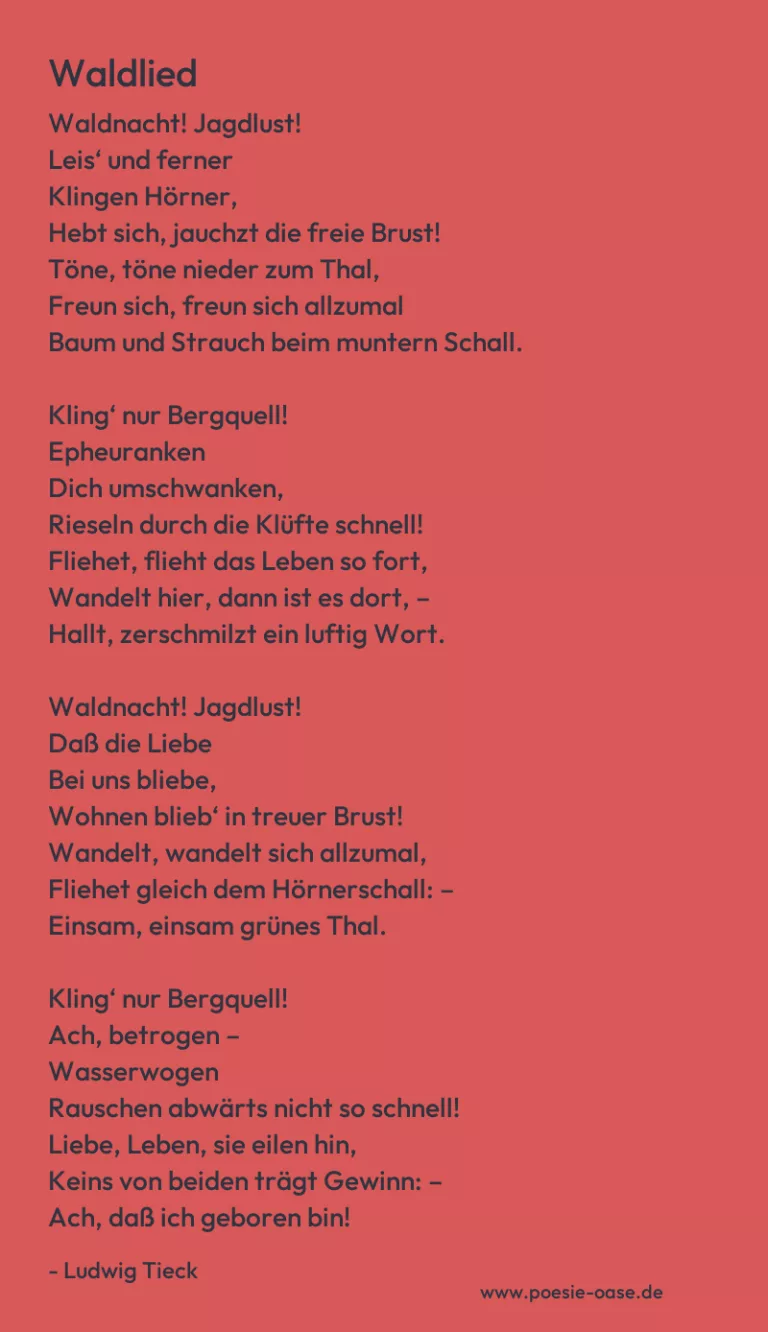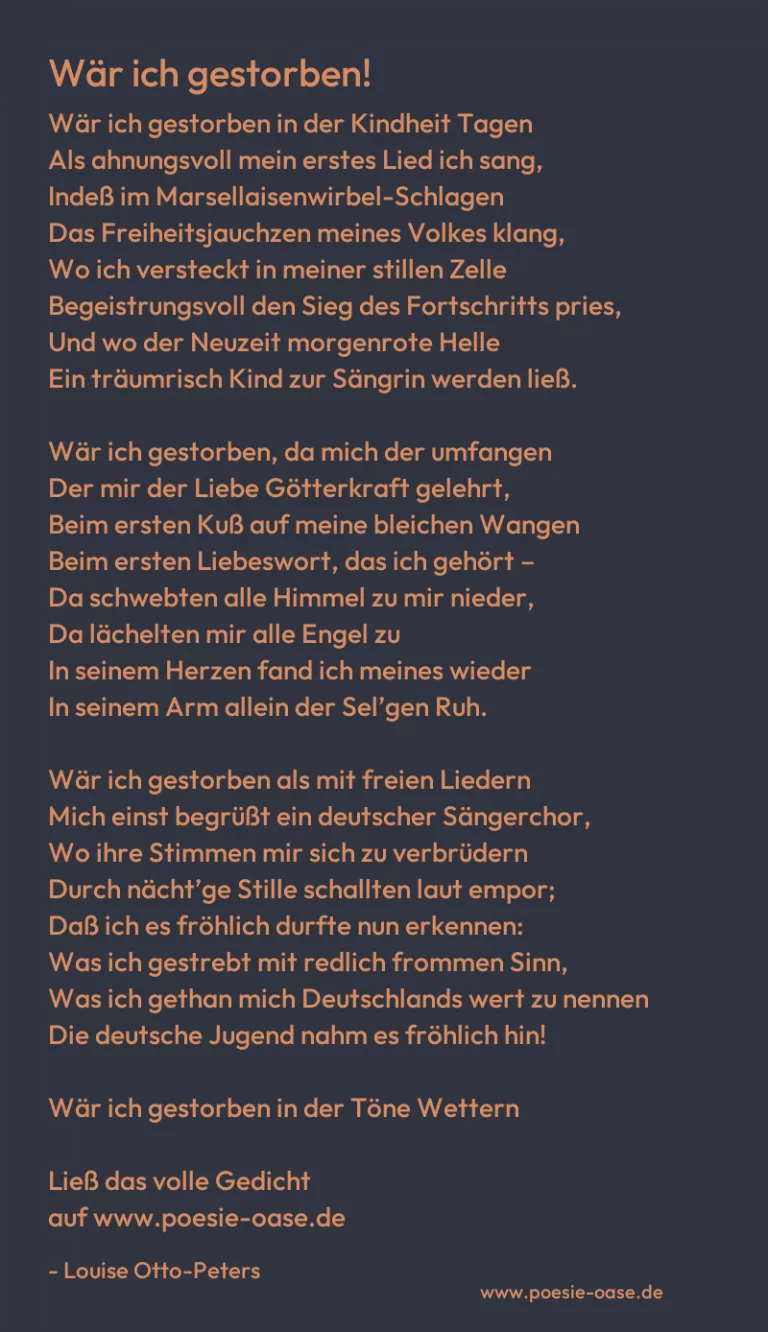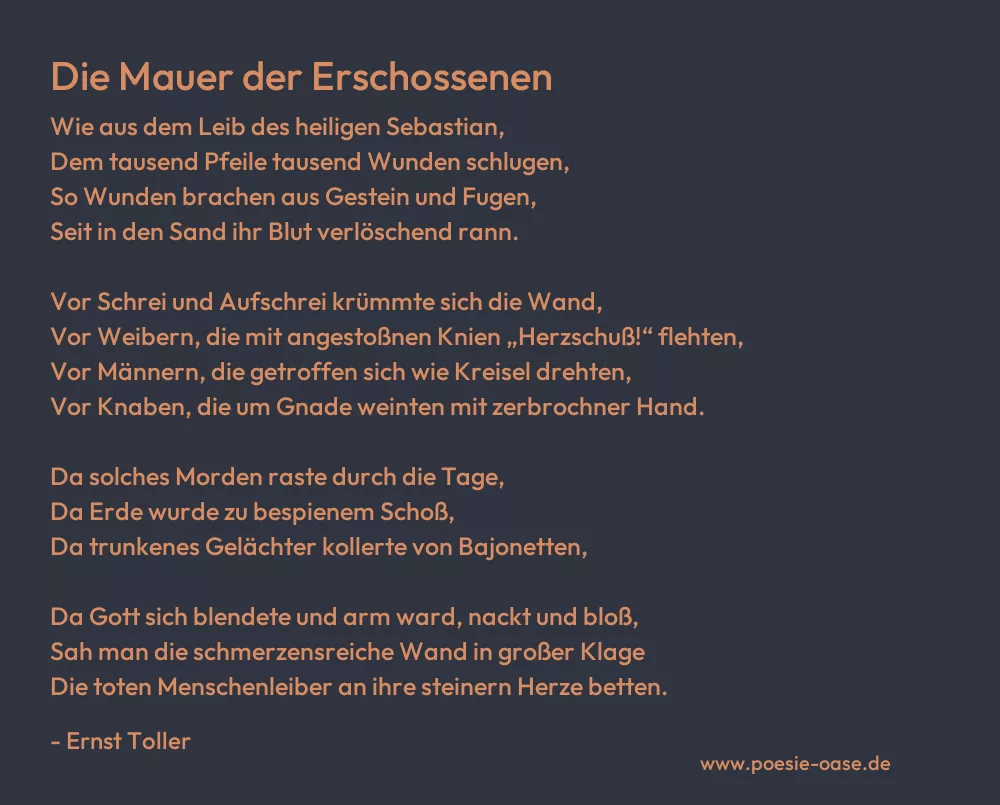Die Mauer der Erschossenen
Wie aus dem Leib des heiligen Sebastian,
Dem tausend Pfeile tausend Wunden schlugen,
So Wunden brachen aus Gestein und Fugen,
Seit in den Sand ihr Blut verlöschend rann.
Vor Schrei und Aufschrei krümmte sich die Wand,
Vor Weibern, die mit angestoßnen Knien „Herzschuß!“ flehten,
Vor Männern, die getroffen sich wie Kreisel drehten,
Vor Knaben, die um Gnade weinten mit zerbrochner Hand.
Da solches Morden raste durch die Tage,
Da Erde wurde zu bespienem Schoß,
Da trunkenes Gelächter kollerte von Bajonetten,
Da Gott sich blendete und arm ward, nackt und bloß,
Sah man die schmerzensreiche Wand in großer Klage
Die toten Menschenleiber an ihre steinern Herze betten.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
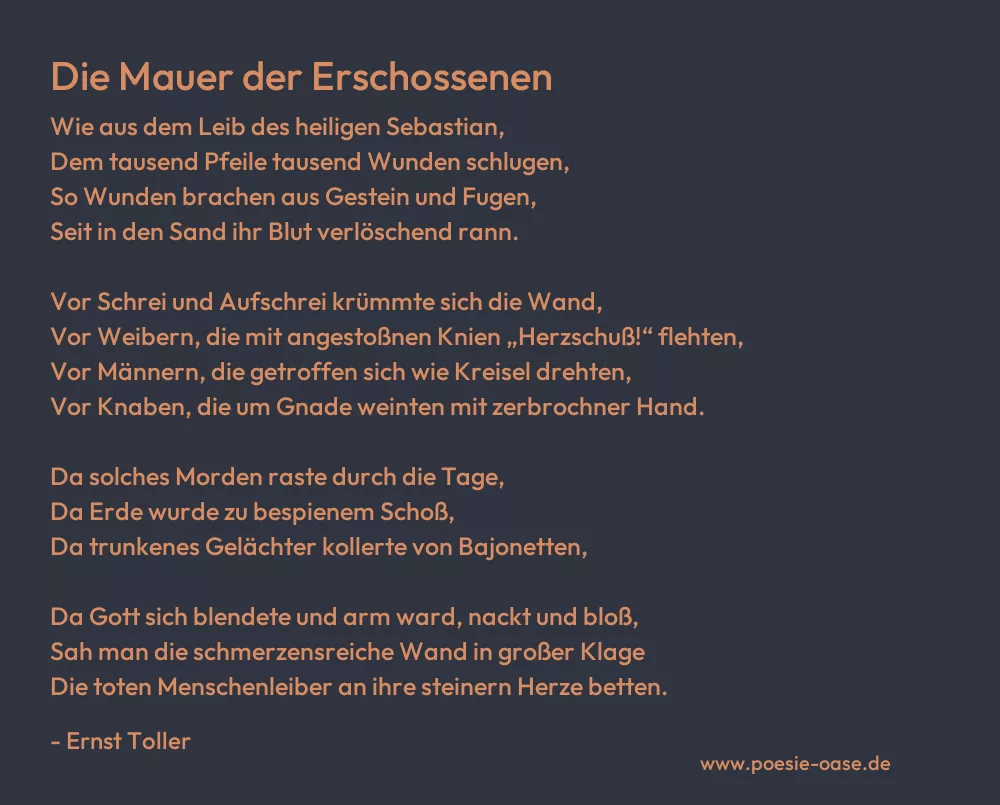
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Mauer der Erschossenen“ von Ernst Toller ist eine eindrucksvolle und erschütternde Darstellung von Gewalt und Tod im Krieg. Es beginnt mit einer symbolischen Anspielung auf den heiligen Sebastian, der in der christlichen Tradition durch Pfeile getötet wurde, wobei seine Wunden und der Schmerz in Verbindung mit der „Mauer der Erschossenen“ gesetzt werden. Die „tausend Wunden“ im „Leib des heiligen Sebastian“ stellen die tausendfachen Opfer des Krieges dar, die die Mauer des Todes durchbrechen, aus „Gestein und Fugen“. Diese Metapher verdeutlicht die unaufhaltsame Zerstörungskraft des Krieges, der nicht nur Menschenleben fordert, sondern auch das Fundament der Welt selbst erschüttert.
In der zweiten Strophe beschreibt Toller die grausamen Szenen der Exekutionen und das Leid der Opfer. Die „Männer“, „Weiber“ und „Knaben“ sind allesamt von Gewalt und Schmerz betroffen – die Frauen flehen „Herzschuß!“, die Männer drehen sich „wie Kreisel“ vor Schmerz, und die Jungen weinen um Gnade. Das Bild der „zerbrochenen Hand“ und die verzweifelten Schreie der Opfer zeigen die Unmenschlichkeit des Krieges, bei dem selbst das Leben der Unschuldigen nicht mehr respektiert wird. Der Ausdruck „Vor Schrei und Aufschrei krümmte sich die Wand“ verweist darauf, dass die Mauern selbst die Schreie der Verzweiflung „spüren“ – als ob sie Zeugen des menschlichen Leids werden, das sich in dieser mörderischen Szene entfaltet.
In der dritten Strophe wird die Dimension des Krieges als eine Zeit des Wahnsinns und des Verfalls weiter vertieft. Die Erde wird zu einem „bespienem Schoß“, was auf den Verlust aller Heiligkeit und Reinheit hinweist, und das „trunkene Gelächter“ der Soldaten, das von den Bajonetten kollert, verdeutlicht die Entmenschlichung und die Grausamkeit der Kriegsmaschinerie. In diesem Moment, in dem die Menschen sowohl in ihrem Schmerz als auch in ihrer Grausamkeit von Gott und der Menschlichkeit getrennt sind, wird Gott selbst als „blendend“ und „arm, nackt und bloß“ dargestellt. Diese Darstellung von Gott als entblößt und schwach unterstreicht das Gefühl der Verlassenheit und der spirituellen Entleerung, das mit dem Krieg verbunden ist.
In der letzten Zeile des Gedichts, in der die „Mauer der Erschossenen“ die „toten Menschenleiber an ihre steinern Herze betten“, wird die Mauer selbst zu einem Symbol der Erinnerung und des Schmerzes. Die toten Körper finden in den steinernen Mauern ihren letzten „Schlafplatz“, was eine kraftvolle und düstere Metapher für das Ende von Leben und Hoffnung ist. Die „steinern“ Herz der Mauer, das in der Lage ist, die toten Körper zu „betten“, ist zugleich ein Symbol für die Kälte und Unbeweglichkeit der Welt, die den Tod von Menschen zu einer beinahe alltäglichen Tragödie macht.
Toller nutzt in diesem Gedicht starke, schockierende Bilder, um den Horror des Krieges und das Ausmaß des menschlichen Leidens zu schildern. Es ist eine eindringliche Anklage gegen die Entmenschlichung, die der Krieg mit sich bringt, und eine Reflexion über den Verlust von Gott, Menschlichkeit und Hoffnung in einem von Gewalt erschütterten Zeitalter.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.