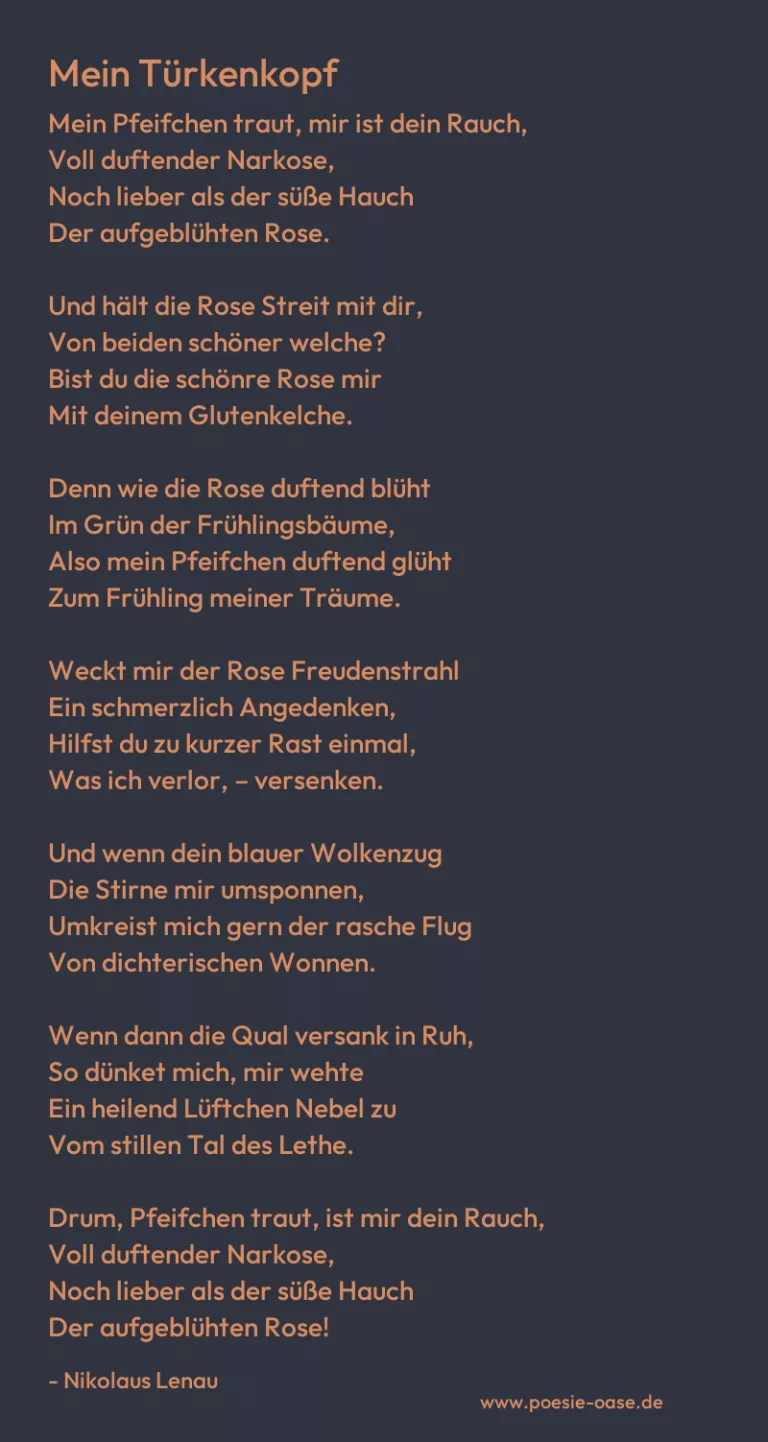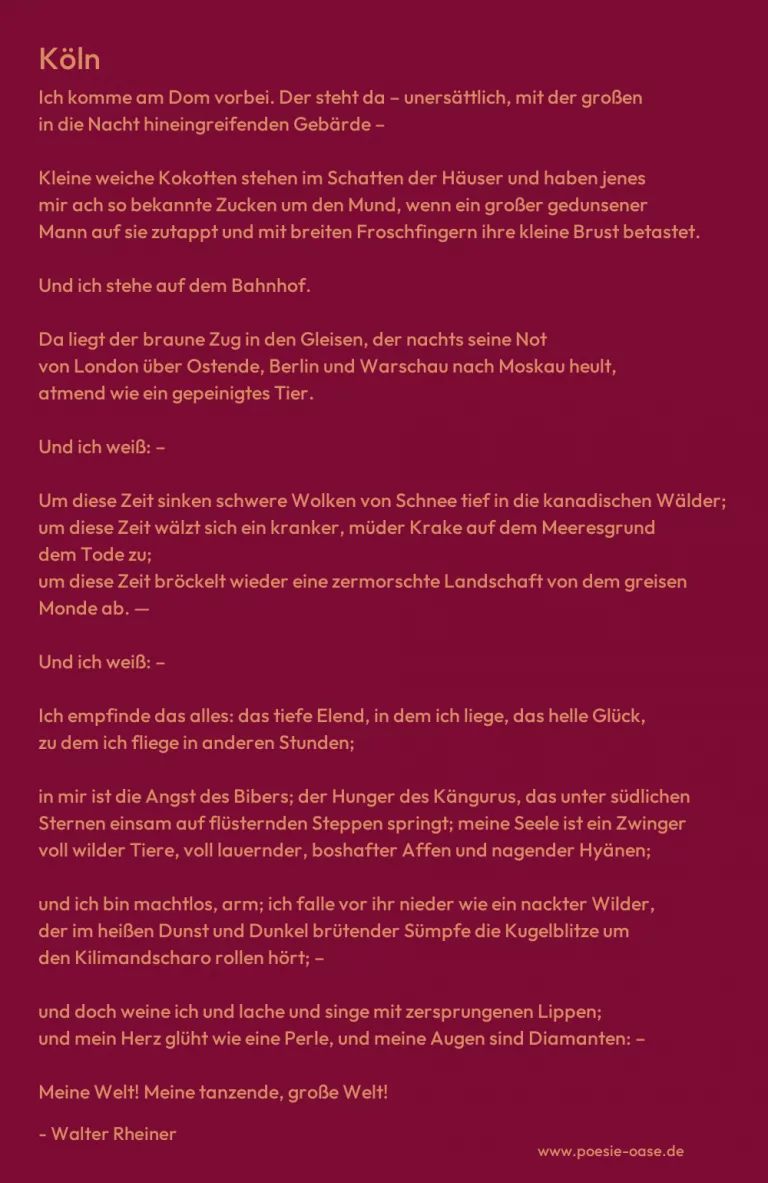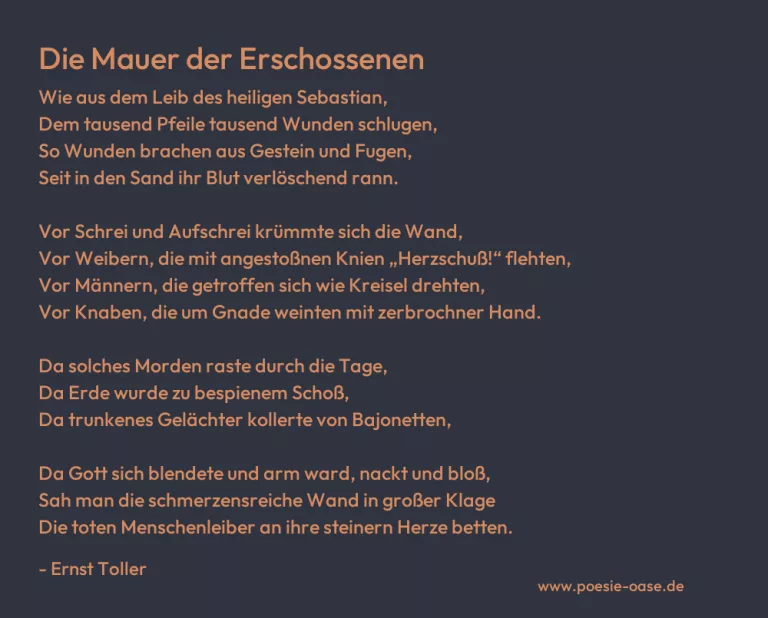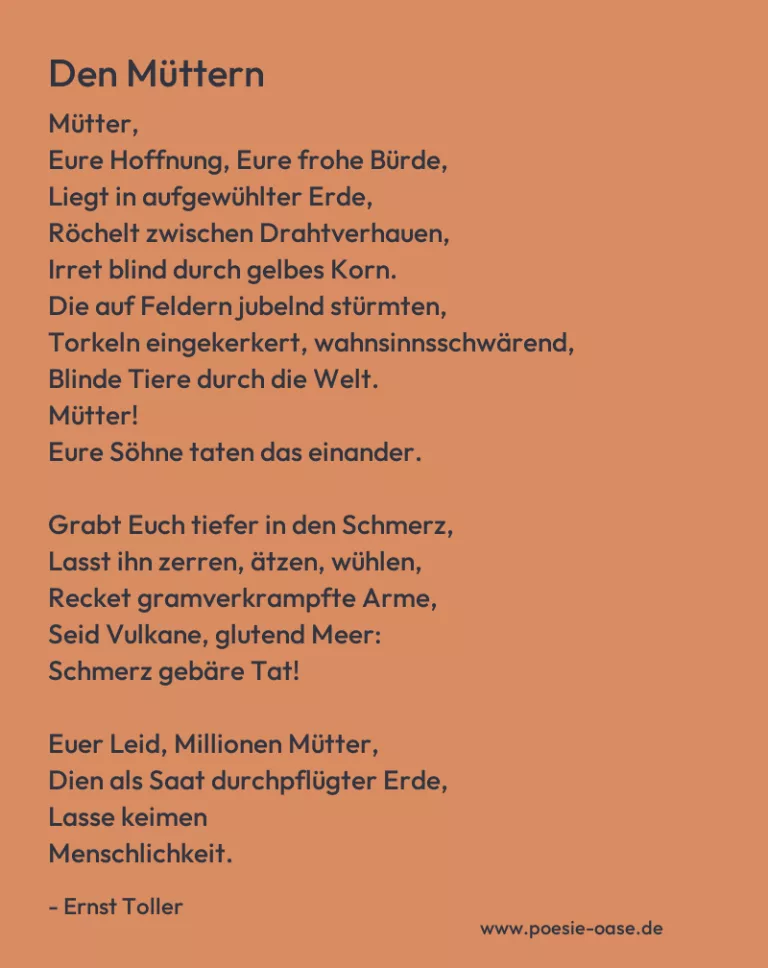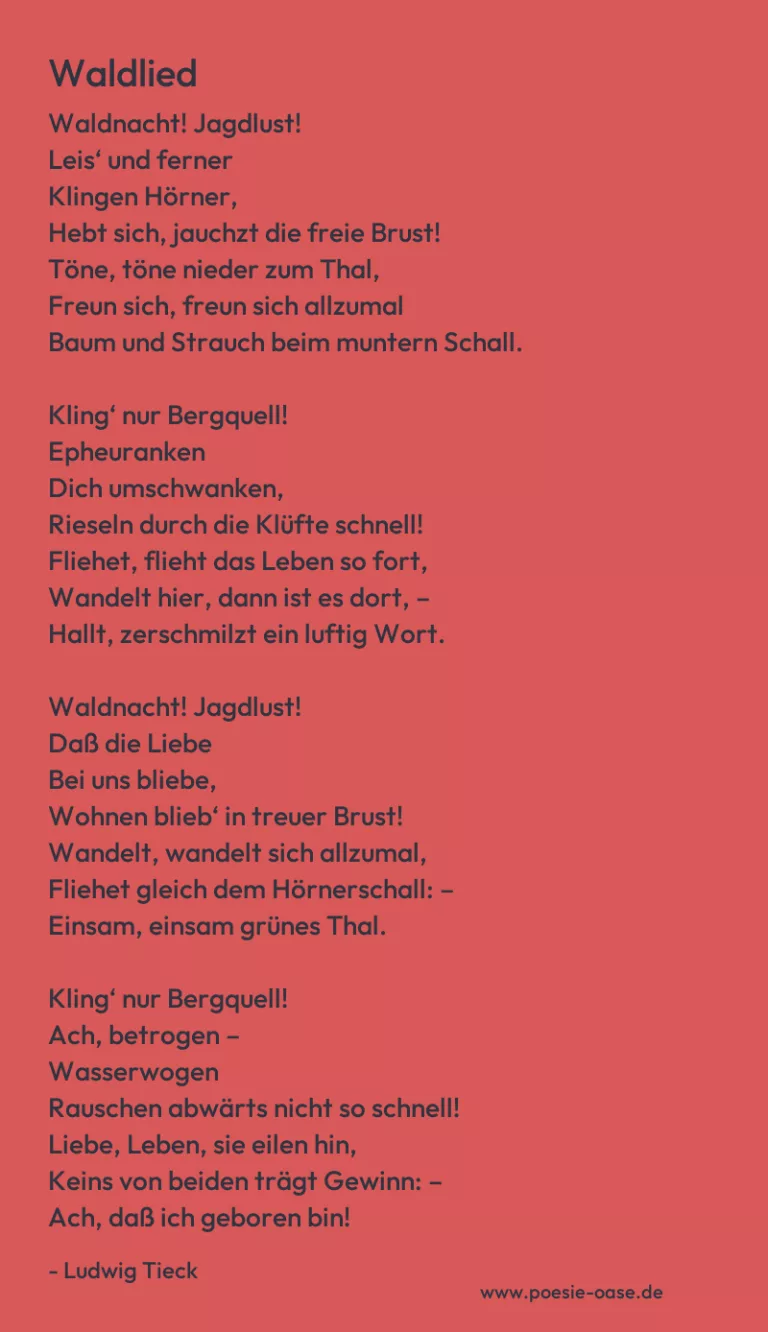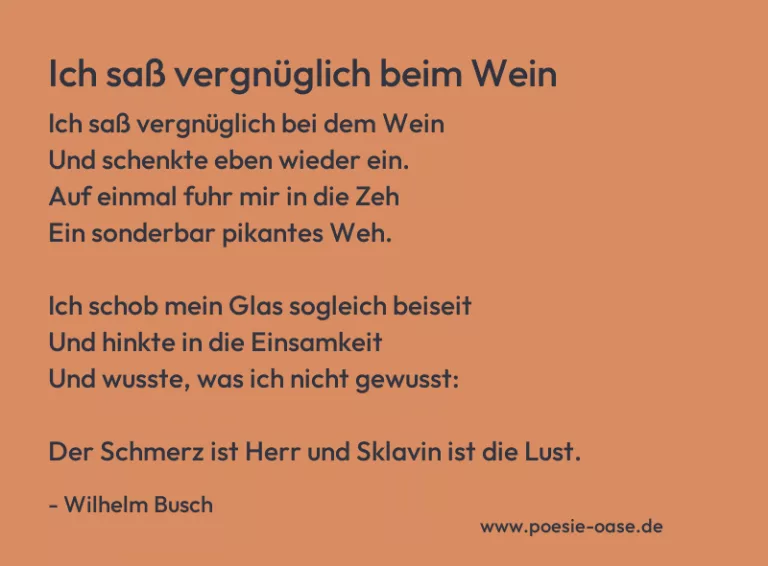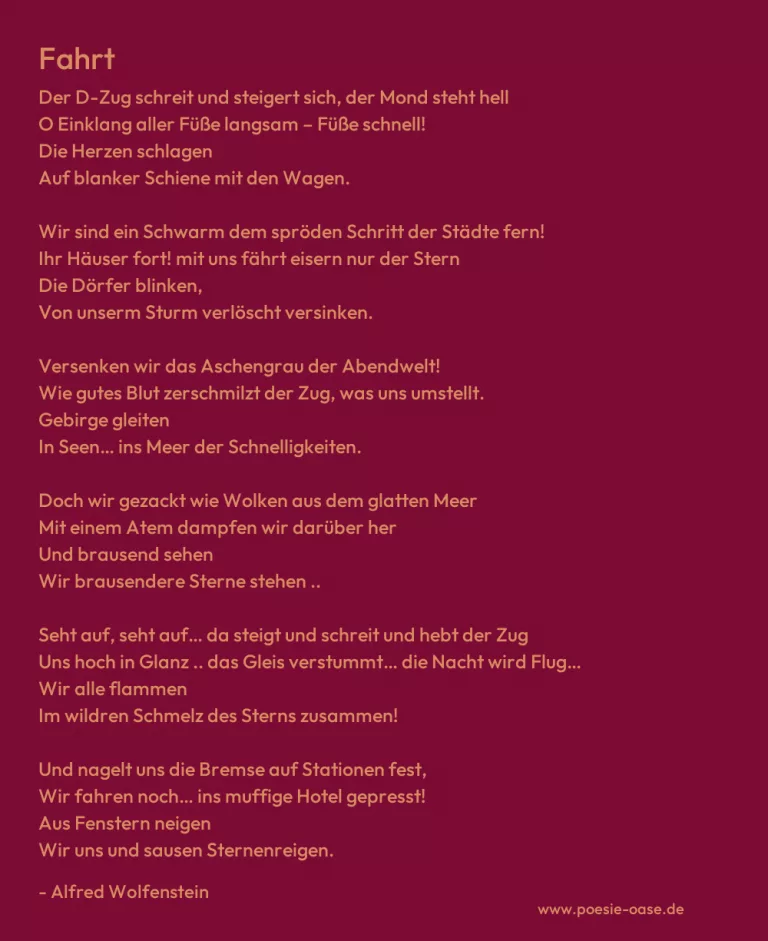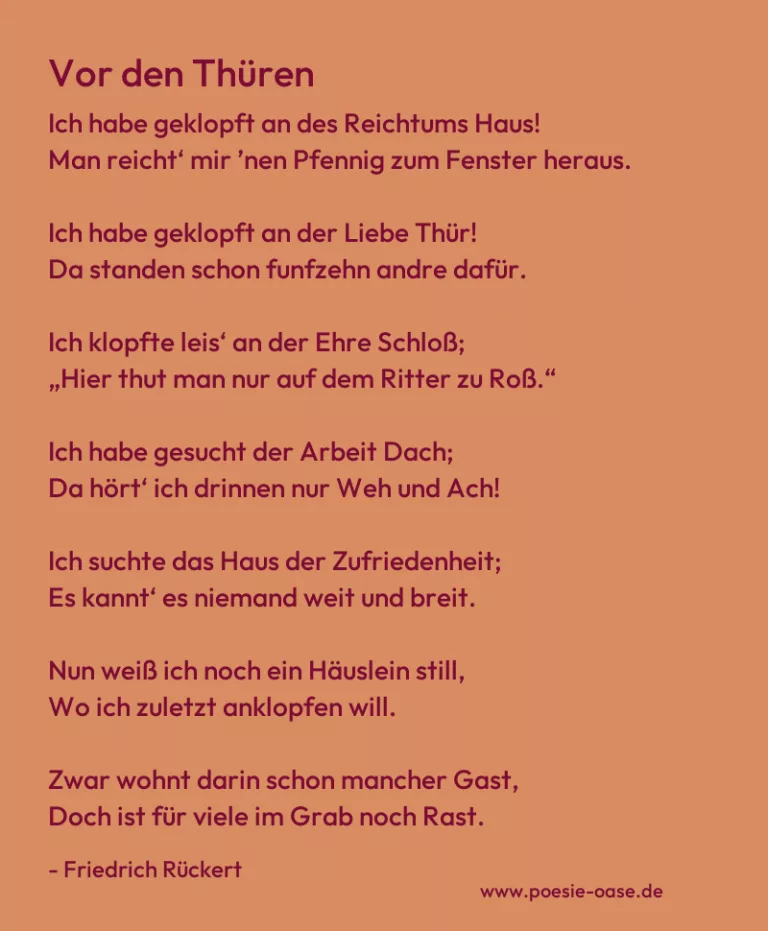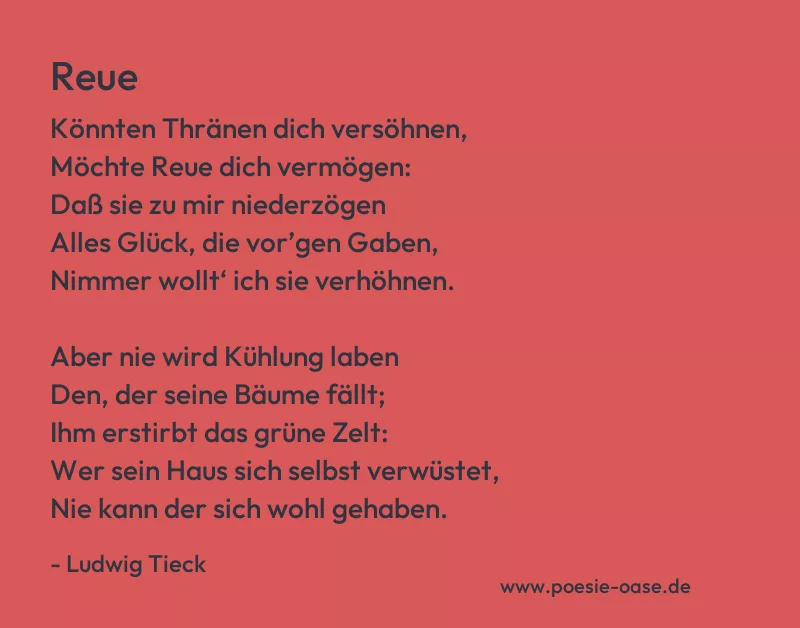Reue
Könnten Thränen dich versöhnen,
Möchte Reue dich vermögen:
Daß sie zu mir niederzögen
Alles Glück, die vor’gen Gaben,
Nimmer wollt‘ ich sie verhöhnen.
Aber nie wird Kühlung laben
Den, der seine Bäume fällt;
Ihm erstirbt das grüne Zelt:
Wer sein Haus sich selbst verwüstet,
Nie kann der sich wohl gehaben.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
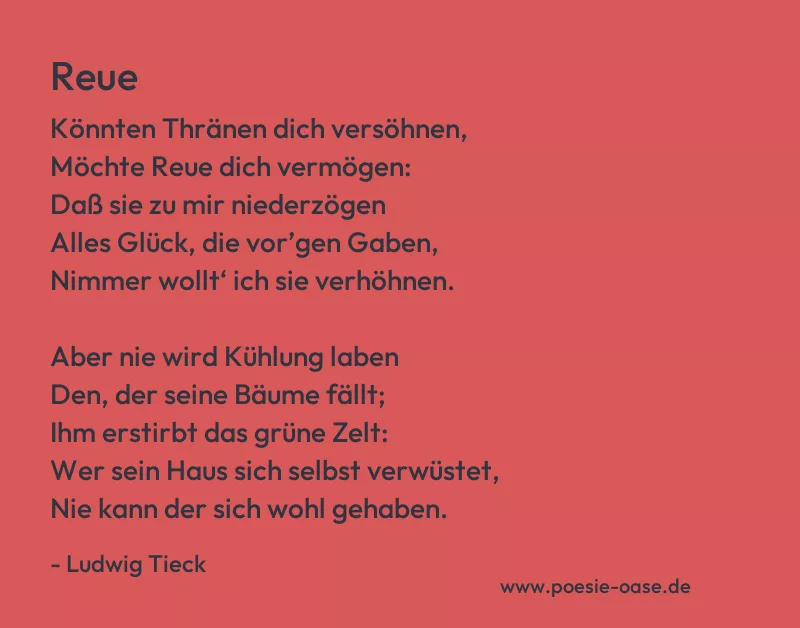
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht Reue von Ludwig Tieck ist eine kurze, eindringliche Reflexion über Schuld, unwiderrufliche Verluste und die bittere Erkenntnis, dass manche Fehler nicht rückgängig zu machen sind. In knappen Versen verbindet es emotionale Reue mit einer moralisch-existentiellen Einsicht.
Zu Beginn bringt das lyrische Ich seine Reue zum Ausdruck: Tränen und Einsicht sollen als Zeichen der Buße gelten. Wären sie in der Lage, die einst verlorenen „Gaben“ – also das frühere Glück – zurückzuholen, so würde der Sprecher alles tun, um den begangenen Fehler wiedergutzumachen. Hier wird die Reue nicht nur als Gefühl, sondern als Handlungskraft vorgestellt – eine verzweifelte Hoffnung auf Wiedergutmachung.
Doch bereits im zweiten Versabschnitt erfolgt die ernüchternde Wendung: Manche Taten lassen sich nicht rückgängig machen. Die Bilder „der seine Bäume fällt“ und „das grüne Zelt“ verdeutlichen diesen Gedanken auf eindrucksvolle Weise. Wer das zerstört, was ihn einst geschützt und genährt hat, steht schließlich nackt und ohne Zuflucht da. Diese Metaphorik verweist auf Selbstzerstörung – das lyrische Ich erkennt, dass es selbst verantwortlich ist für seinen Verlust.
Tieck verwendet einfache, klare Sprache, die durch die bildhaften Vergleiche eine große emotionale Dichte erreicht. Das „verwüstete Haus“ am Ende wird zum Sinnbild für die innere Leere und Zerrissenheit, die sich nicht mehr heilen lässt. Damit formuliert das Gedicht eine existentielle Wahrheit: Reue mag aufrichtig sein, doch sie ändert nichts an der Realität zerstörter Verhältnisse. Die Einsicht kommt zu spät – das Gedicht steht ganz im Zeichen des unwiederbringlichen Verlustes.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.