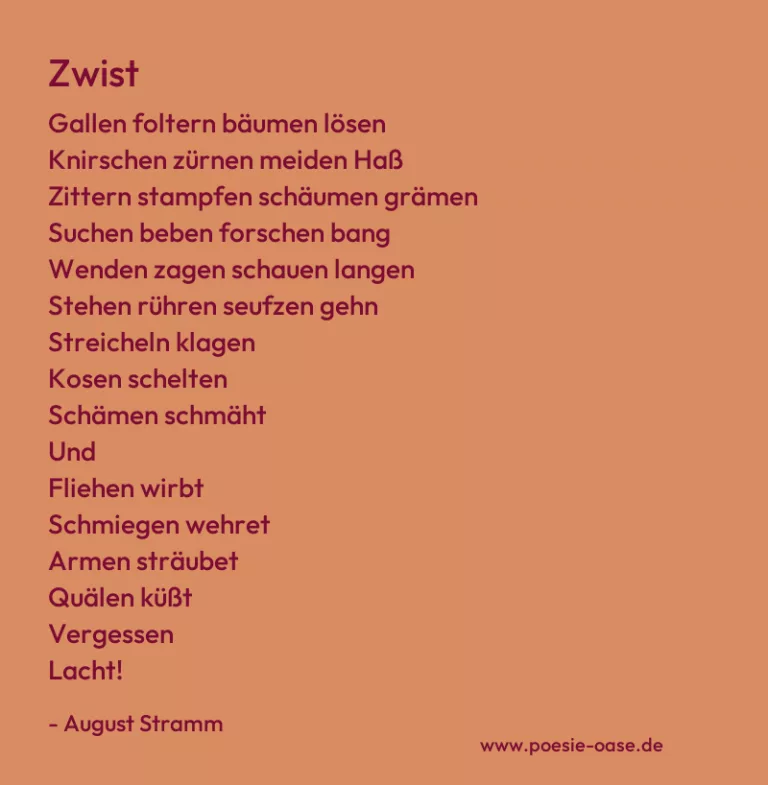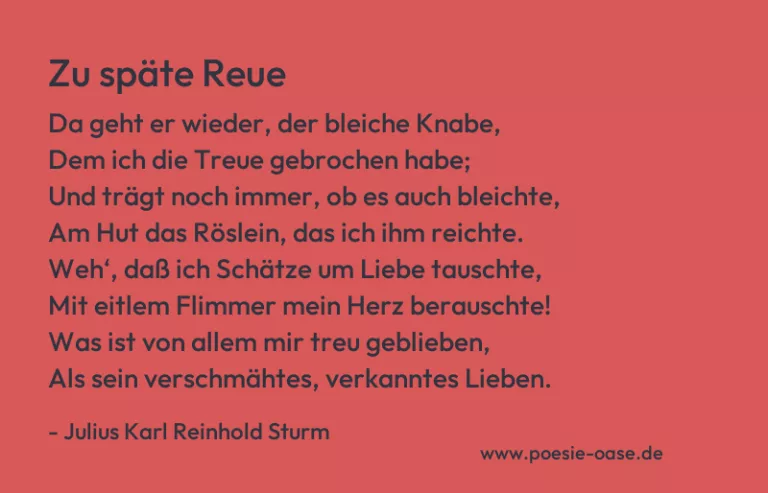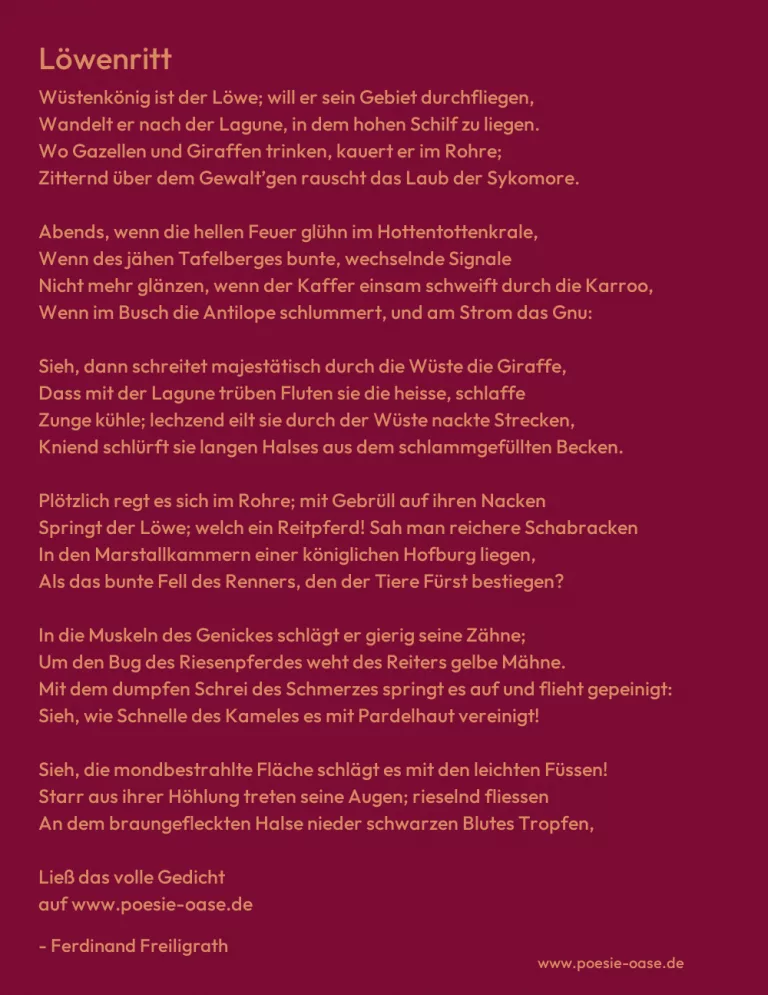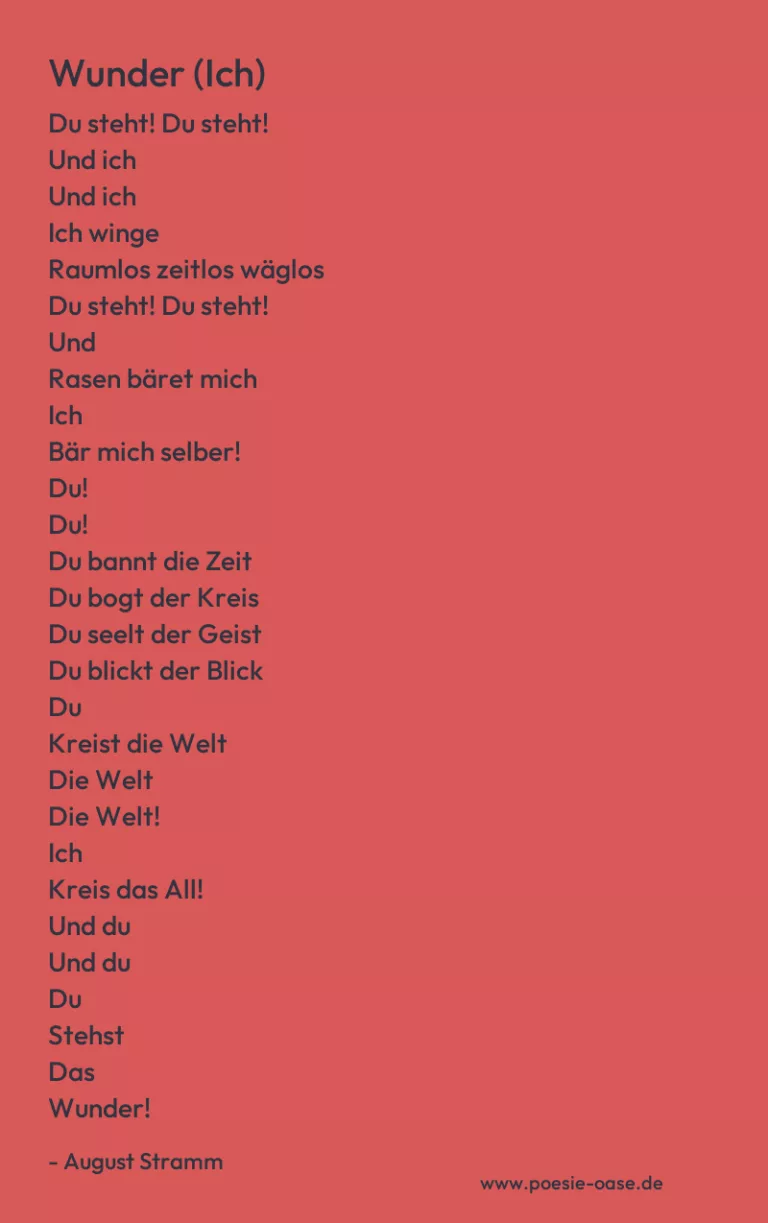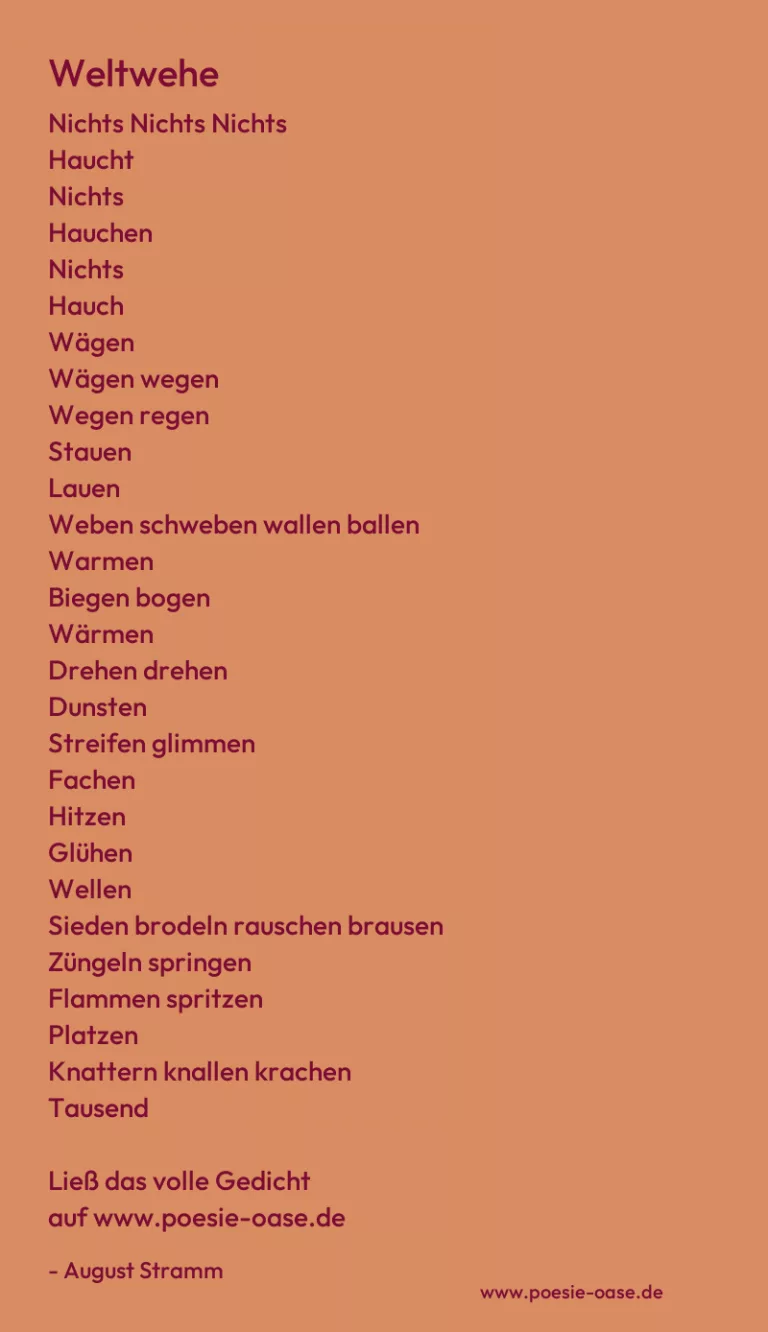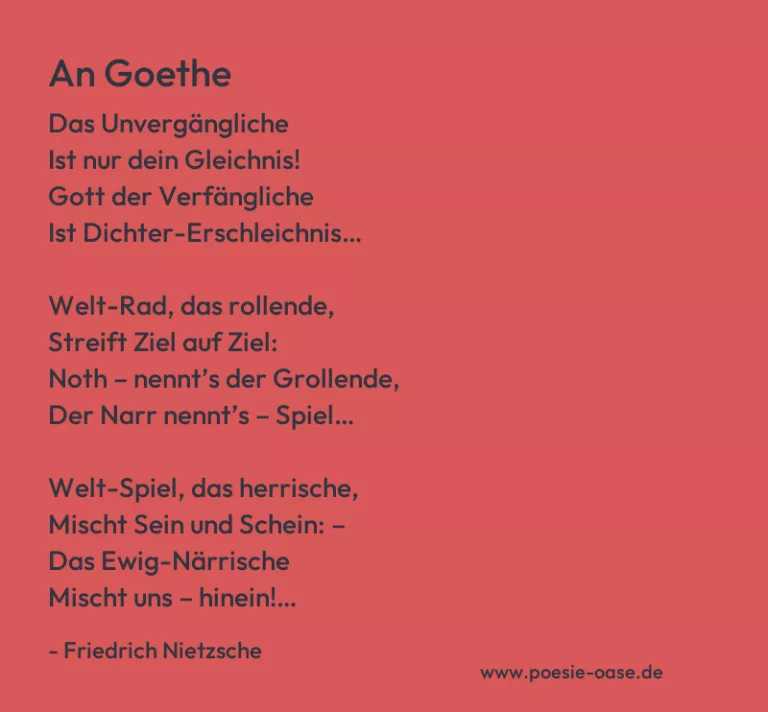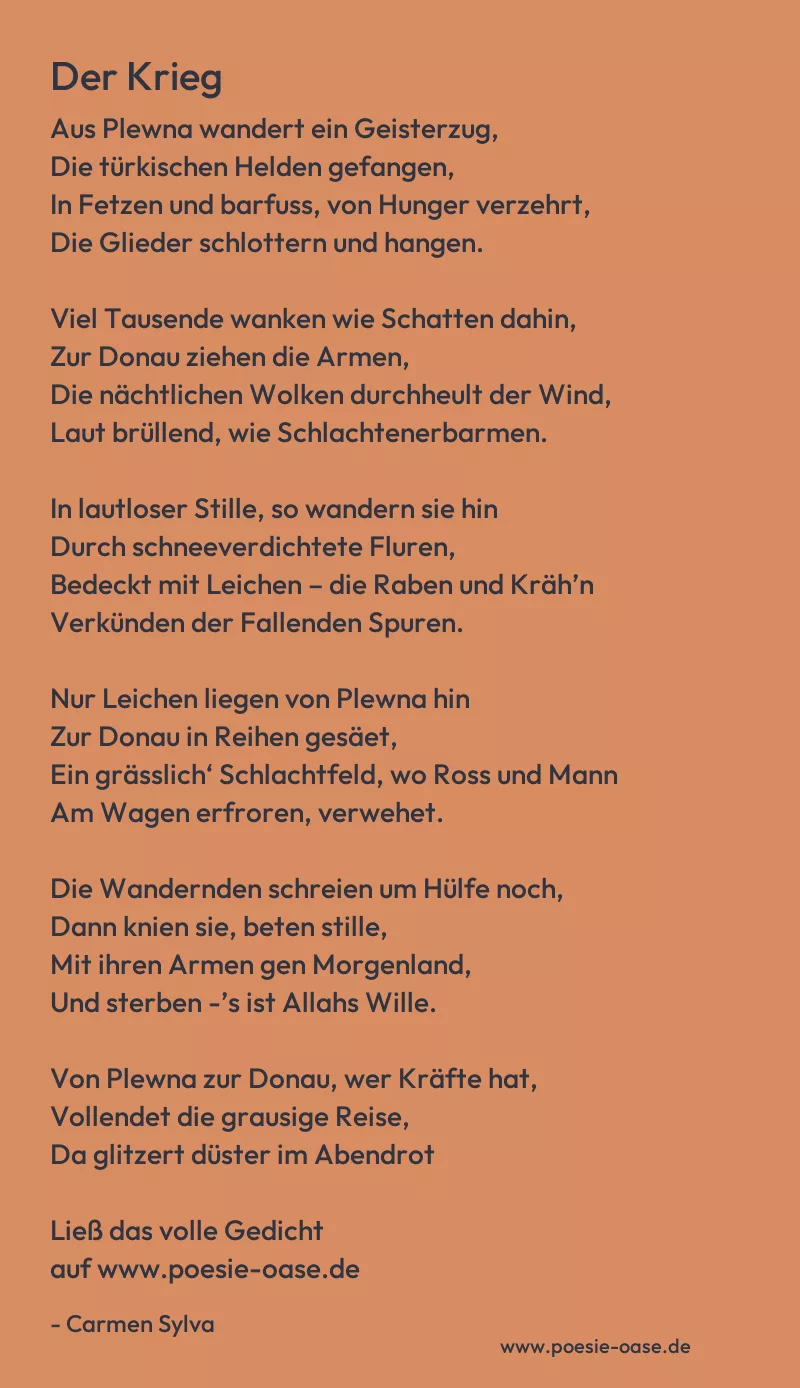Aus Plewna wandert ein Geisterzug,
Die türkischen Helden gefangen,
In Fetzen und barfuss, von Hunger verzehrt,
Die Glieder schlottern und hangen.
Viel Tausende wanken wie Schatten dahin,
Zur Donau ziehen die Armen,
Die nächtlichen Wolken durchheult der Wind,
Laut brüllend, wie Schlachtenerbarmen.
In lautloser Stille, so wandern sie hin
Durch schneeverdichtete Fluren,
Bedeckt mit Leichen – die Raben und Kräh’n
Verkünden der Fallenden Spuren.
Nur Leichen liegen von Plewna hin
Zur Donau in Reihen gesäet,
Ein grässlich‘ Schlachtfeld, wo Ross und Mann
Am Wagen erfroren, verwehet.
Die Wandernden schreien um Hülfe noch,
Dann knien sie, beten stille,
Mit ihren Armen gen Morgenland,
Und sterben -’s ist Allahs Wille.
Von Plewna zur Donau, wer Kräfte hat,
Vollendet die grausige Reise,
Da glitzert düster im Abendrot
Nicropolis, starrend von Eise.
Und rings ertönt ein Heulen und Schrei’n:
„O wollet uns Speise doch geben!
Was habt Ihr nicht lieber erschossen uns gleich!“
Die Lüfte, die eisigen, beben.
Zehntausend Gefangene schreien nach Brot,
Kein Brot ist zur Stunde zu haben,
Und markerschütternd durchtobt der Schrei
Die Straßen, die Wälle, den Graben.
Zehntausend liegen in jener Nacht
Verhungernd, mit sterbendem Munde,
Die Sieger sind selber von Tod bedroht –
Kein Brot! und nur Eis in der Runde!
Kein Brot! Und von jenseits da winkt das Land,
In dem lange verheißenen Frieden,
Doch hat sie die Donau mit krachendem Eis
In gewaltigen Massen geschieden.
Kein Brot! und es frieret in jener Nacht,
Als hätte Natur sich geschworen,
Den beiden Heeren den Untergang,
Fast waren sie alle verloren.
Doch endlich grauet der Tag, es kann
Die Panzerbarkasse nun wagen,
Vom Eis getragen! ein wenig Brot
Zu gemarterten Helden zu tragen.