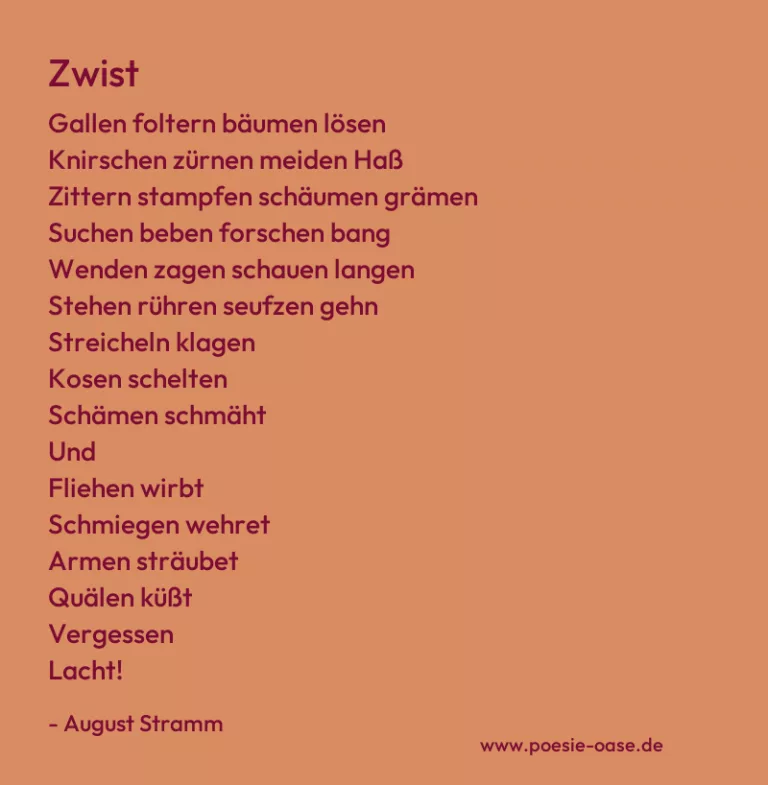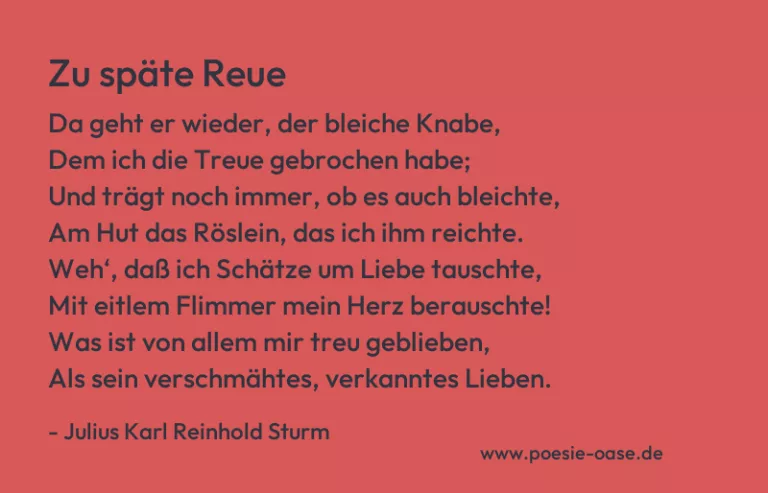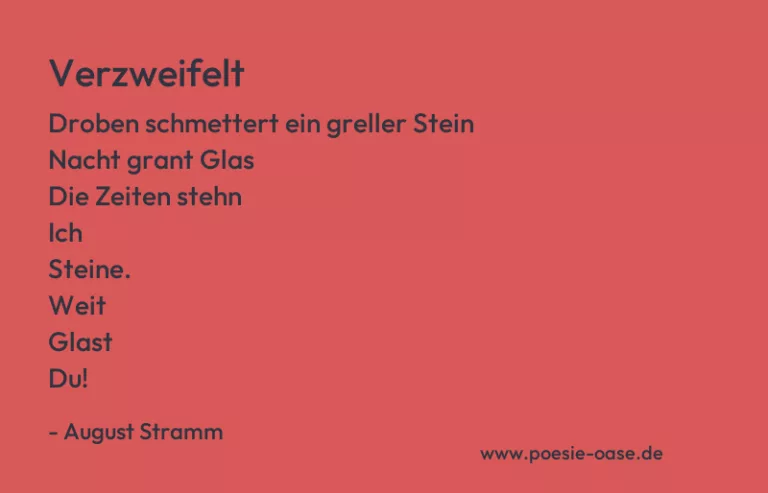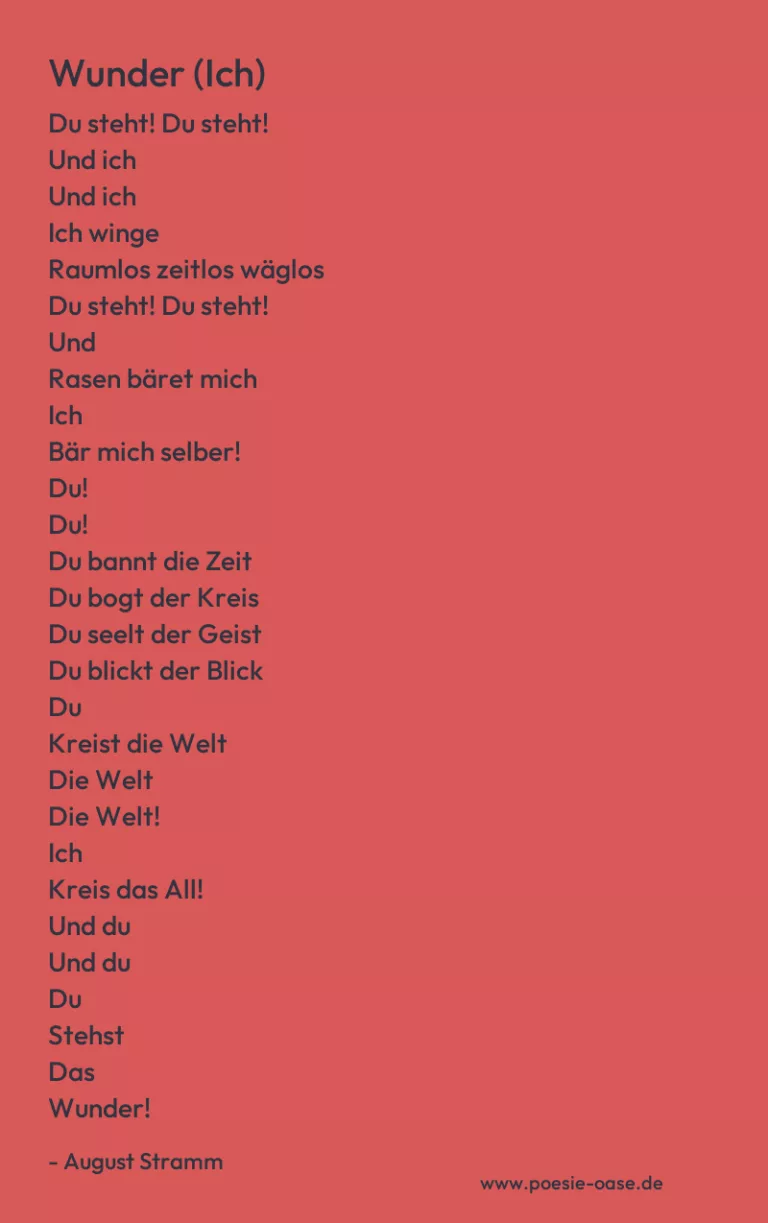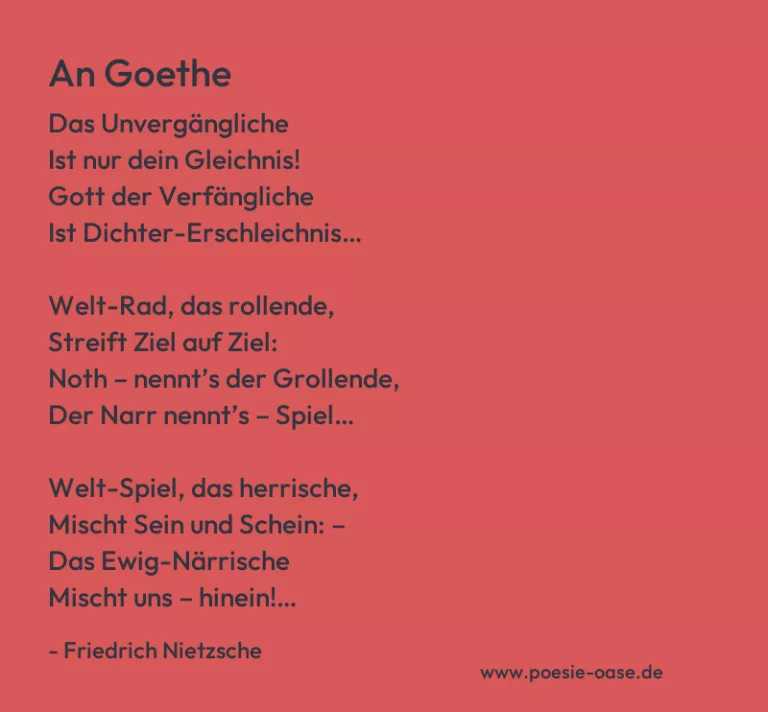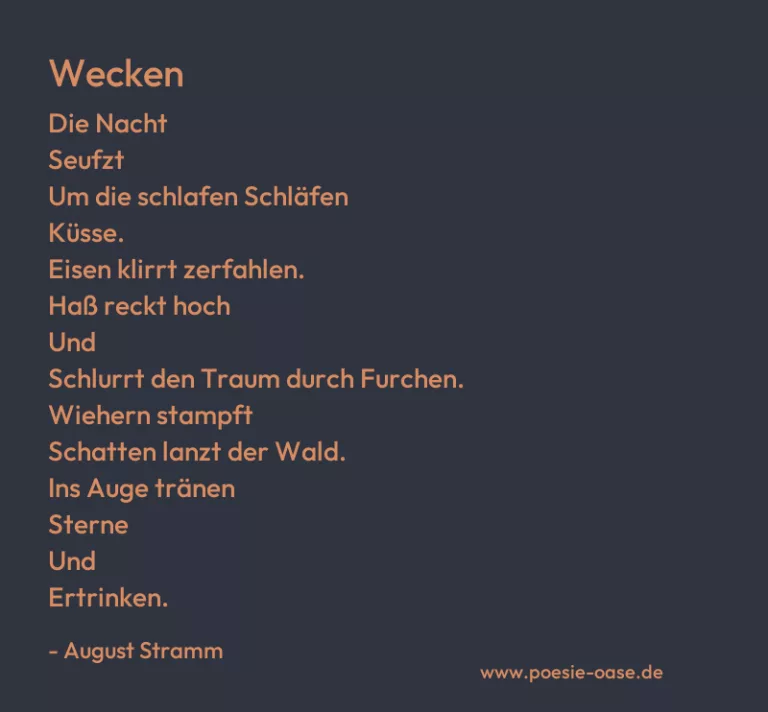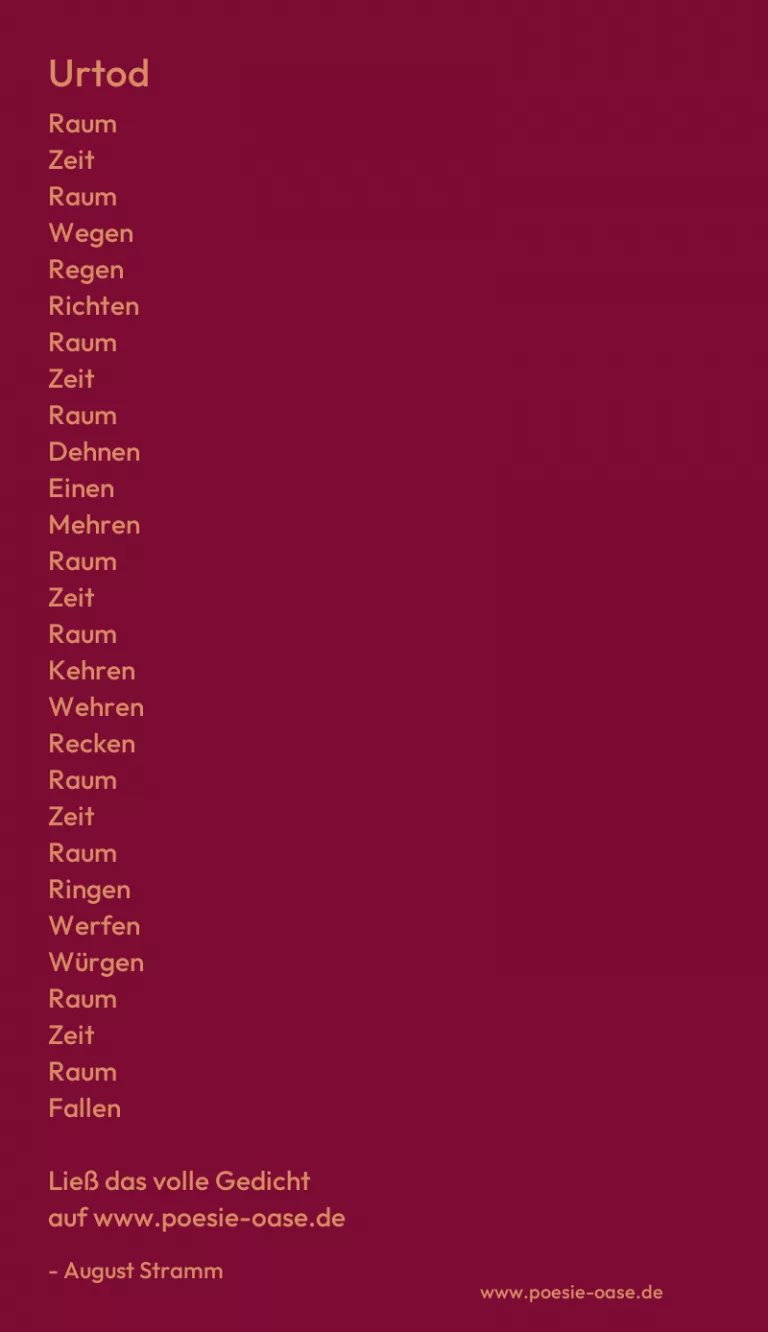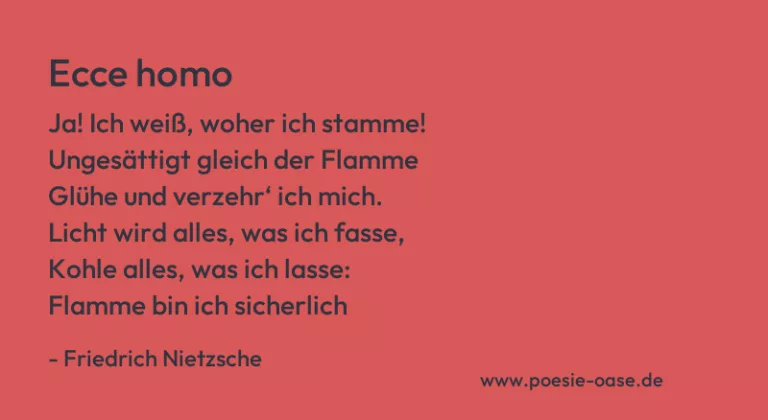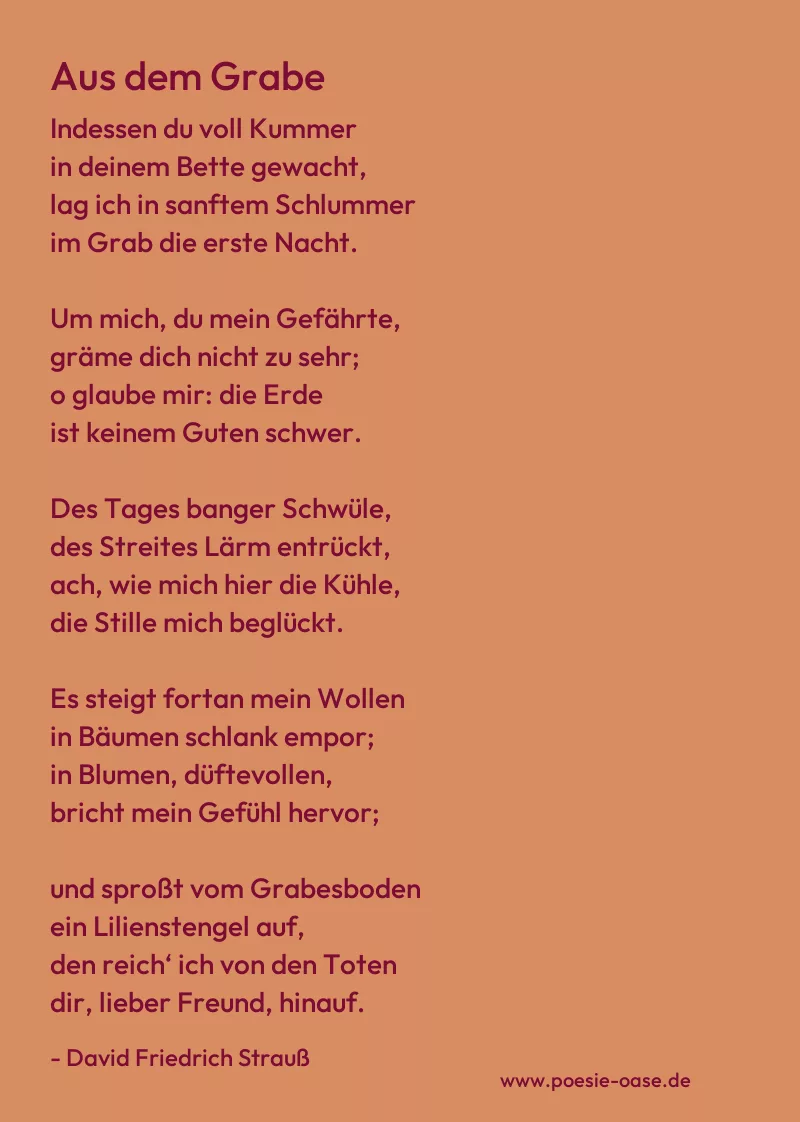Aus dem Grabe
Indessen du voll Kummer
in deinem Bette gewacht,
lag ich in sanftem Schlummer
im Grab die erste Nacht.
Um mich, du mein Gefährte,
gräme dich nicht zu sehr;
o glaube mir: die Erde
ist keinem Guten schwer.
Des Tages banger Schwüle,
des Streites Lärm entrückt,
ach, wie mich hier die Kühle,
die Stille mich beglückt.
Es steigt fortan mein Wollen
in Bäumen schlank empor;
in Blumen, düftevollen,
bricht mein Gefühl hervor;
und sproßt vom Grabesboden
ein Lilienstengel auf,
den reich‘ ich von den Toten
dir, lieber Freund, hinauf.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
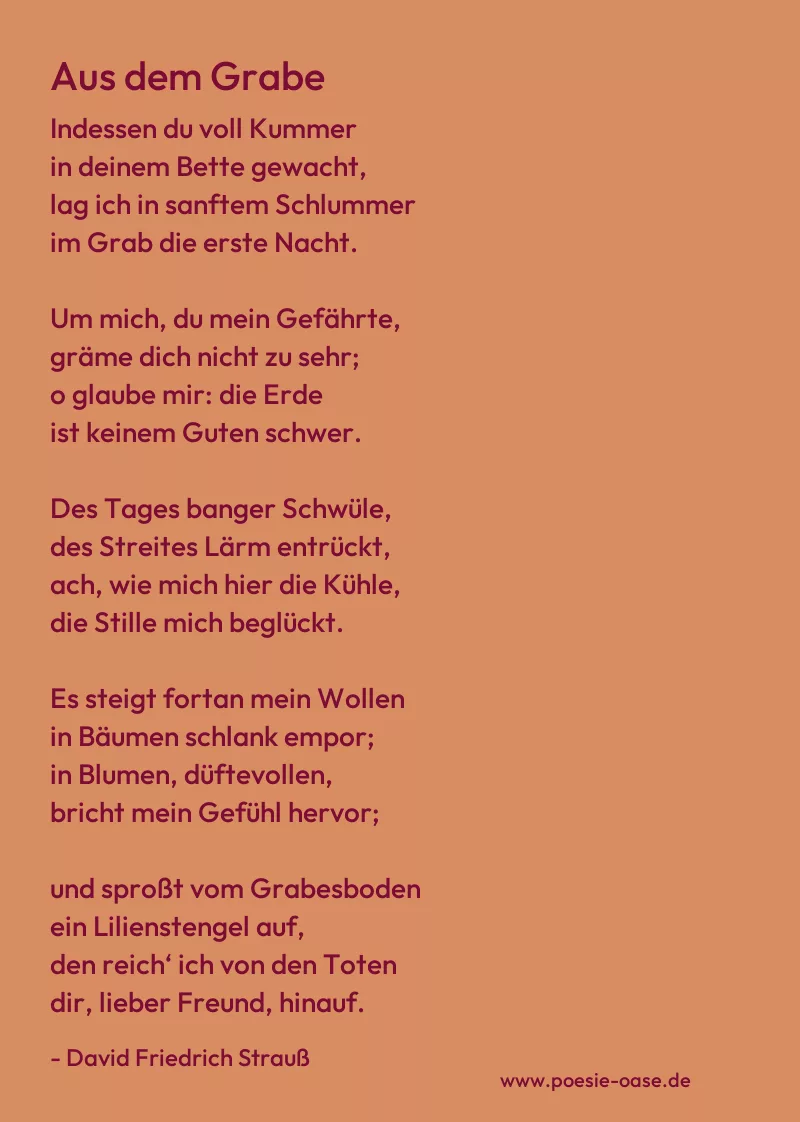
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Aus dem Grabe“ von David Friedrich Strauß thematisiert den Tod als eine befreiende und erlösende Erfahrung. Zu Beginn des Gedichts spricht der Sprecher von einer Person, die „voll Kummer“ in ihrem Bett gewacht hat, während er selbst „im sanften Schlummer“ im Grab die „erste Nacht“ verbracht. Der Gegensatz zwischen dem wachen Kummer der Lebenden und der Ruhe des Todes wird hier auf poetische Weise eingeführt. Der Tod erscheint nicht als etwas beängstigendes, sondern als eine friedliche und erlösende Ruhe, die im Vergleich zum Leben als befreiend empfunden wird.
In der zweiten Strophe wendet sich der Sprecher direkt an den „Gefährten“, der noch unter der Last des Lebens leidet. Er bittet darum, sich nicht zu sehr zu grämen, da „die Erde keinem Guten schwer“ sei. Der Tod wird hier als eine Form der Befreiung dargestellt, als eine Erleichterung von den Bürden des Lebens. Die Vorstellung, dass der Tod für den „Guten“ nicht belastend ist, verweist auf eine idealisierte Sichtweise des Todes als einen natürlichen und nicht zu fürchtenden Übergang.
Die dritte Strophe bringt eine weitere Dimension der Erhebung und Befreiung durch den Tod zum Ausdruck: Der Sprecher beschreibt, wie er sich von der „banger Schwüle“ des Tages und dem „Lärm“ des Streites entfernt hat. In der Stille des Grabes findet er eine neue, kühlende und beglückende Freiheit, die er in der Natur, in „Bäumen“ und „Blumen“, erfährt. Der Tod wird hier als eine Rückkehr zur Natur verstanden, in der der Mensch wieder in Einklang mit den natürlichen Zyklen tritt und sich von den Belastungen des menschlichen Lebens befreit.
In der letzten Strophe spricht der Sprecher von einer Metamorphose, bei der „sein Wollen“ in der Natur weiterlebt. Er sieht seine Gefühle in den Blumen und Düften, die aus dem Boden sprießen, und symbolisiert das Leben nach dem Tod durch das Bild eines „Lilienstengels“, der aus dem Grabesboden wächst. Der Lilienstengel, den er seinem „lieben Freund“ hinaufreicht, steht für die Fortdauer des Lebens und die Übergabe von Schönheit und Frieden an die Lebenden. Der Tod ist hier nicht das Ende, sondern eine Transformation, die es dem Sprecher ermöglicht, auf eine neue Art und Weise weiterzuleben.
Strauß verwendet in diesem Gedicht die Bilder von Natur und Leben nach dem Tod, um eine versöhnliche Sicht auf das Thema Tod zu bieten. Der Tod wird nicht als endgültiger Verlust dargestellt, sondern als eine Erlösung von den Härten des Lebens und als Übergang zu einer höheren, friedlicheren Existenz in der Natur. Das Gedicht regt zu einer reflektierten und positiven Haltung gegenüber dem Tod an, in dem er als natürliche Fortsetzung des Lebens verstanden wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.