Die Nacht wiegt auf den Lidern
Müdigkeit flackt und neckt
Der Feind verschmiegt
Die Pfeife schmurgt
Verloren
Und
Alle Räume
Frösteln
Schrumpfig
Klein.
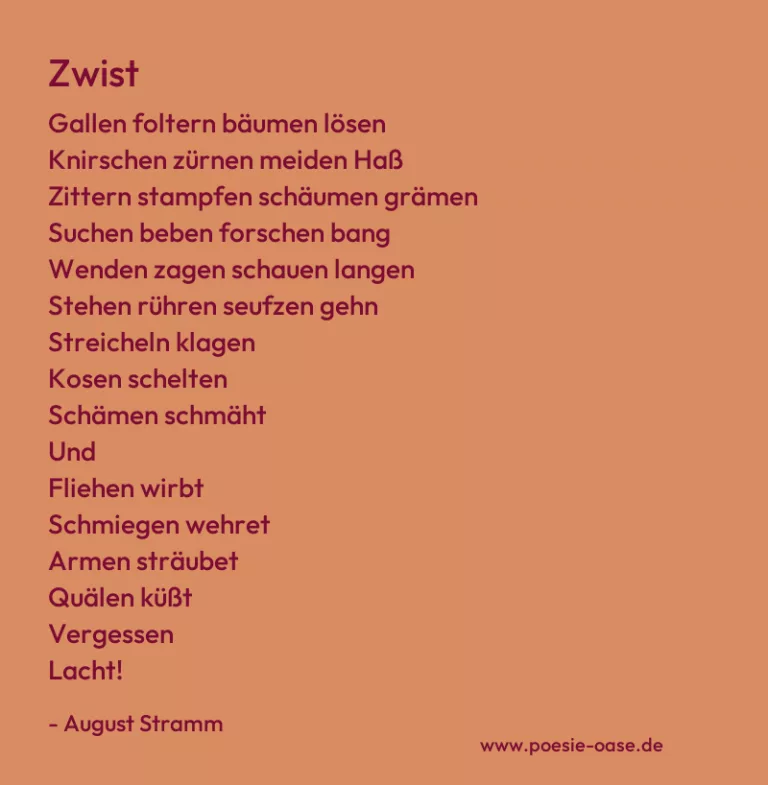
Zwist
- Angst
- Entdeckungen
- Freiheit & Sehnsucht
Die Nacht wiegt auf den Lidern
Müdigkeit flackt und neckt
Der Feind verschmiegt
Die Pfeife schmurgt
Verloren
Und
Alle Räume
Frösteln
Schrumpfig
Klein.
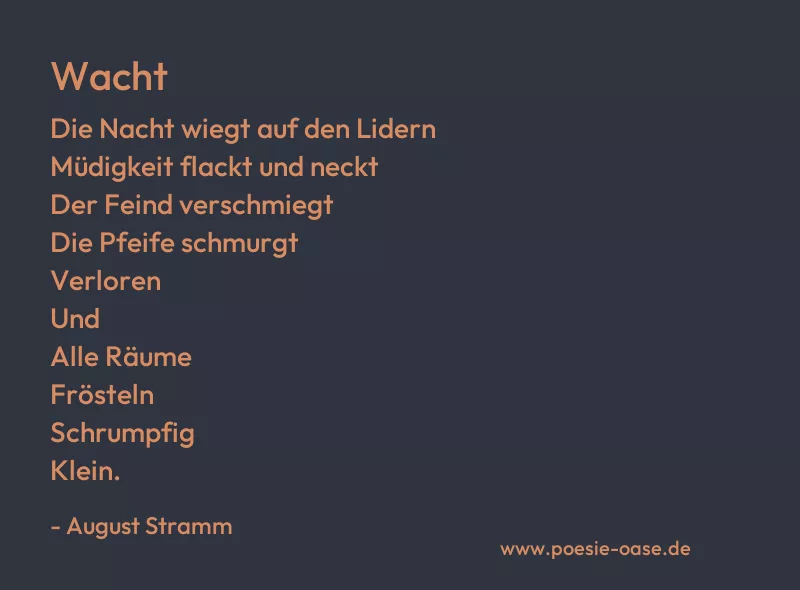
Das Gedicht „Wacht“ von August Stramm gehört zur expressionistischen Literatur des frühen 20. Jahrhunderts und verdichtet in radikaler sprachlicher Form eine Momentaufnahme nächtlicher Kriegswache. Stramm verwendet dabei eine stark reduzierte, fragmentierte Sprache, die eher Eindrücke und Atmosphären als lineare Gedanken vermittelt.
Bereits der erste Vers „Die Nacht wiegt auf den Lidern“ stellt eine körperliche, fast bedrückende Sinneswahrnehmung in den Vordergrund: Die Nacht wird zur physischen Last, die Müdigkeit zur dominierenden Empfindung. Diese subjektive Erfahrung steht im Zentrum des Gedichts und deutet auf einen Zustand zwischen Wachen und Einschlafen, zwischen Anspannung und Erschöpfung.
Mit ungewöhnlichen Wortneuschöpfungen wie „flackt“, „schmurgt“ oder „verschmiegt“ erzeugt Stramm eine eigentümliche, schwer greifbare Atmosphäre. Diese lautmalerischen, oft schwer deutbaren Begriffe sollen keine klare Bedeutung vermitteln, sondern ein Gefühl erzeugen – das Gefühl einer verzerrten, isolierten Wirklichkeit. Der Krieg verformt Sprache und Wahrnehmung gleichermaßen.
Der Raum, der sich in der letzten Strophe „verloren“ und „klein“ zeigt, ist Ausdruck existenzieller Verengung. Der Mensch auf Wacht erlebt sich selbst als isoliert, ausgesetzt und geschrumpft. Die Umgebung wirkt leblos und entfremdet, alle Räume „frösteln“ – eine körperliche wie seelische Kälte dominiert die Szene.
„Wacht“ zeigt beispielhaft, wie der Expressionismus traditionelle Ausdrucksformen aufbricht, um innere Zustände extremer Situationen – wie etwa den Krieg – unmittelbar erfahrbar zu machen. Das Gedicht reduziert sich auf Stimmungen, Geräusche und fragmentarische Bilder, die das Unheimliche, Bedrohliche und zugleich Einsame des nächtlichen Soldatenlebens intensiv spürbar machen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.