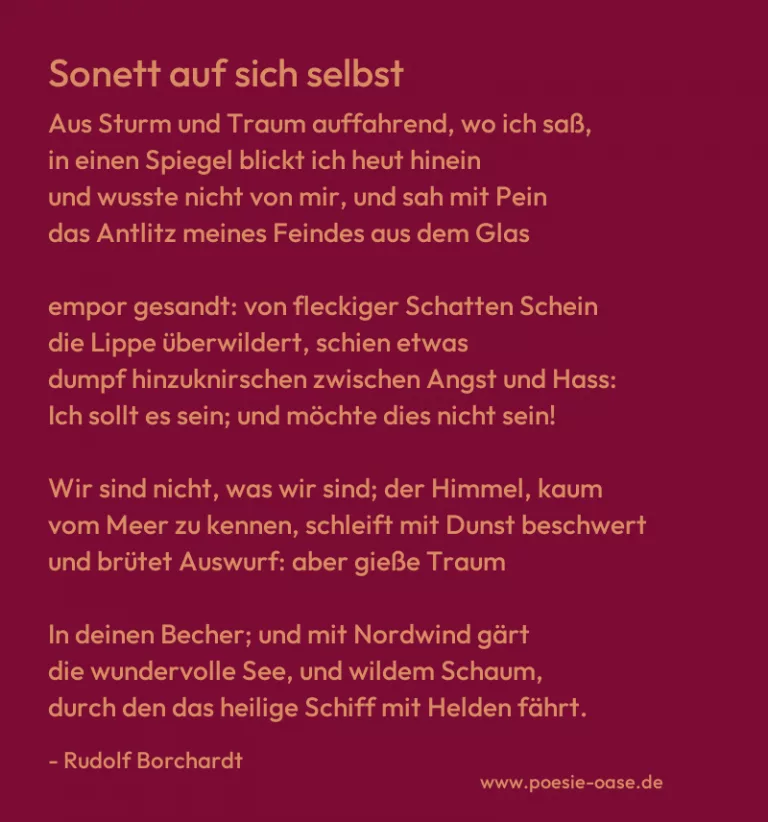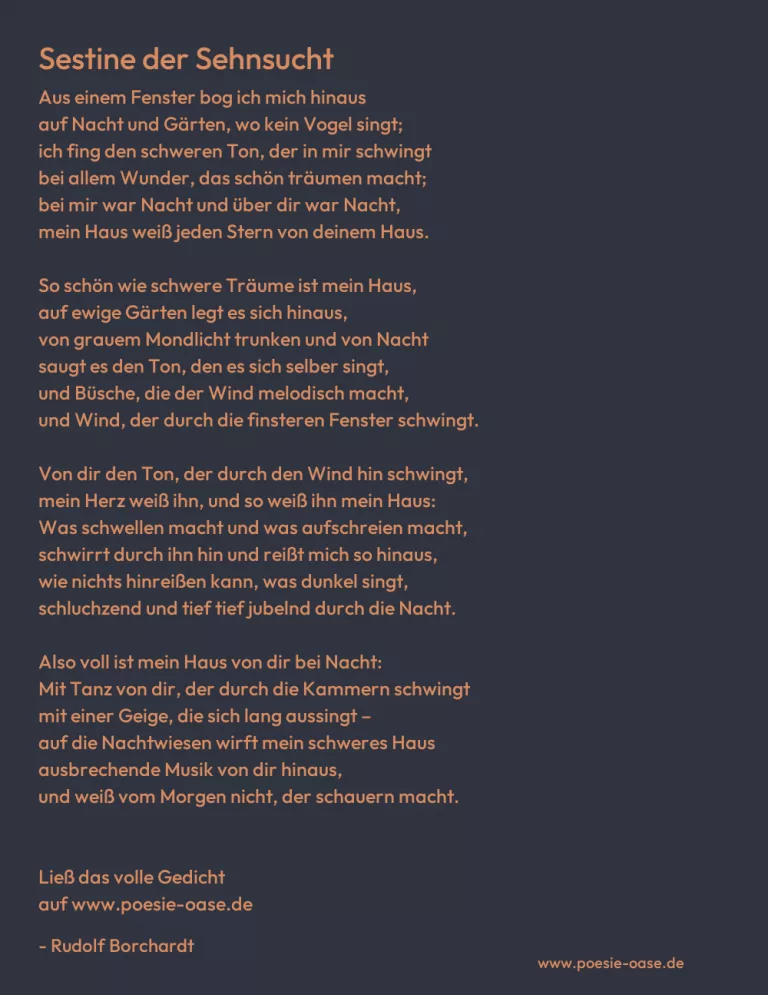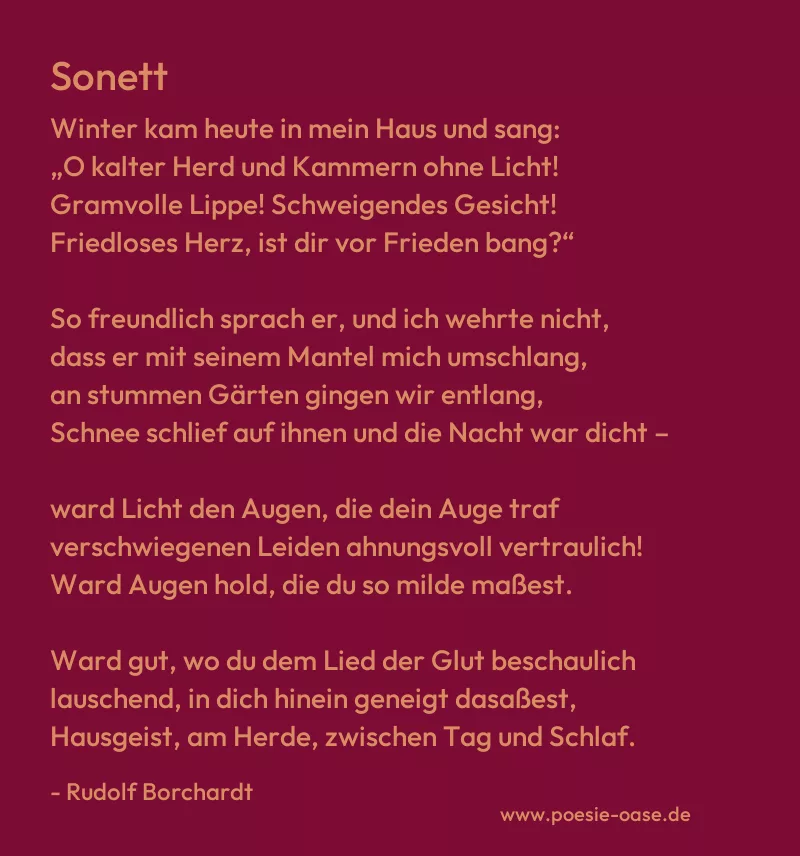Sonett
Winter kam heute in mein Haus und sang:
„O kalter Herd und Kammern ohne Licht!
Gramvolle Lippe! Schweigendes Gesicht!
Friedloses Herz, ist dir vor Frieden bang?“
So freundlich sprach er, und ich wehrte nicht,
dass er mit seinem Mantel mich umschlang,
an stummen Gärten gingen wir entlang,
Schnee schlief auf ihnen und die Nacht war dicht –
ward Licht den Augen, die dein Auge traf
verschwiegenen Leiden ahnungsvoll vertraulich!
Ward Augen hold, die du so milde maßest.
Ward gut, wo du dem Lied der Glut beschaulich
lauschend, in dich hinein geneigt dasaßest,
Hausgeist, am Herde, zwischen Tag und Schlaf.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
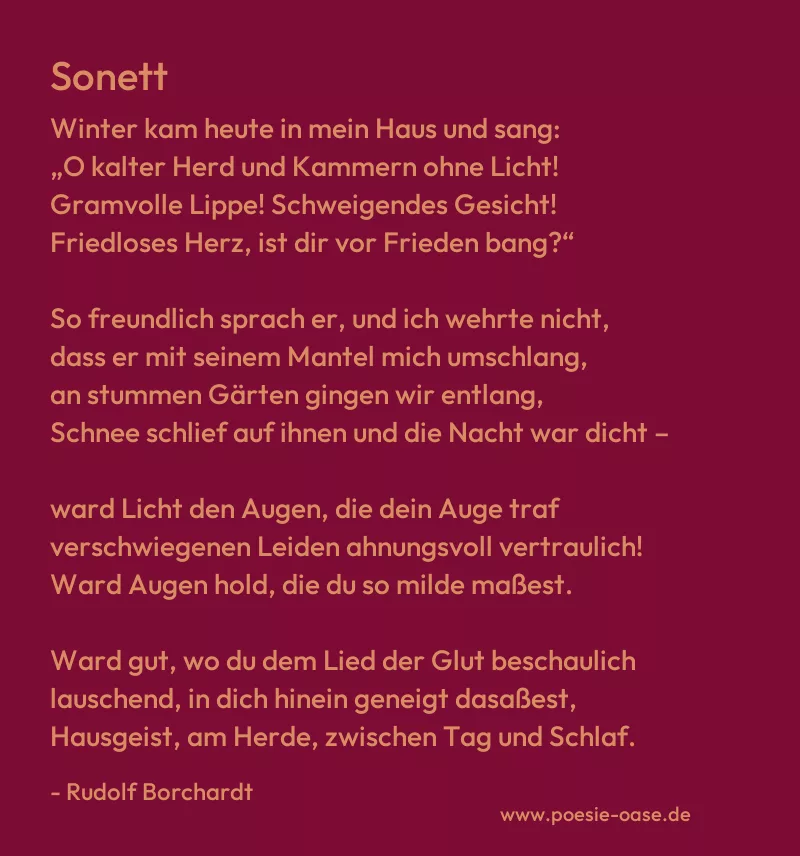
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sonett“ von Rudolf Borchardt beginnt mit einer metaphorischen Darstellung des Winters als eine personifizierte Figur, die in das Haus des lyrischen Ichs kommt und mit einer melancholischen Stimme spricht. Winter symbolisiert hier nicht nur die kalte Jahreszeit, sondern auch eine innere Gefühlswelt von Isolation und Resignation. Der „kalte Herd“ und die „Kammern ohne Licht“ stellen das Fehlen von Wärme und Lebensfreude dar, während die „gramvolle Lippe“ und das „schweigende Gesicht“ das Schweigen und die Trauer des Ichs widerspiegeln.
Im zweiten Teil des Gedichts ist Winter eine fast erlösende Präsenz, die nicht abgewiesen wird, sondern das lyrische Ich in eine düstere, aber tiefgehende Verbindung mit der Welt führt. Der Winter „umschlang“ den Dichter mit seinem Mantel und sie gingen an „stummen Gärten“ entlang, wo der Schnee auf den leeren Gärten ruht. Diese Bilder von Leere und Stille deuten auf eine tiefere seelische Resonanz hin, die sowohl einen Zustand des inneren Rückzugs als auch eine gewisse Akzeptanz des Schmerzes symbolisieren.
Die dritte Strophe zeigt eine plötzliche Wendung, indem sie die Augen des lyrischen Ichs thematisiert, die nun in einem neuen Licht erscheinen. Hier wird das Auge als ein Fenster zum inneren Leid und der veränderten Wahrnehmung dargestellt, die nach und nach zu einer Art sanfter Erleuchtung führt. Die „verschwiegenen Leiden“ sind jetzt nicht mehr nur ein dunkles Geheimnis, sondern werden von den „Augen hold“ mit einer gewissen Milde betrachtet, als ob der Dichter sich mit seinem eigenen Leid versöhnen würde.
Im letzten Teil des Gedichts wird das Bild eines „Hausgeistes“ am „Herde“ eingeführt, das die Rolle des Winter als eine Art inneren Begleiters und Versöhners unterstreicht. Der „Hausgeist“ wird zur Metapher für die Ruhe zwischen Tag und Nacht, zwischen aktiver Lebenszeit und stiller, reflektierender Zeit. Das Gedicht endet mit einem Gefühl von Akzeptanz und innerer Versöhnung, in dem der Winter als eine erlösende und heilende Kraft erscheint, die dem lyrischen Ich zur Erkenntnis seiner inneren Ruhe führt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.