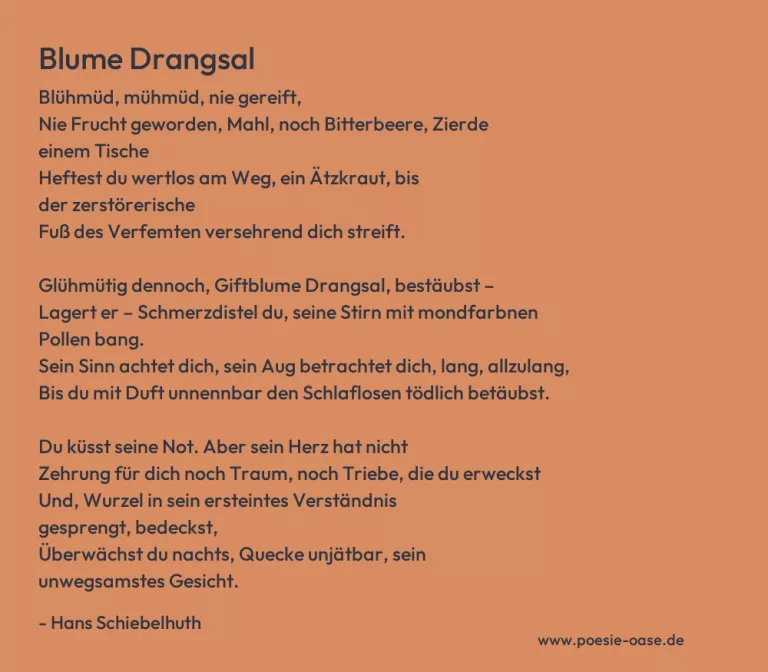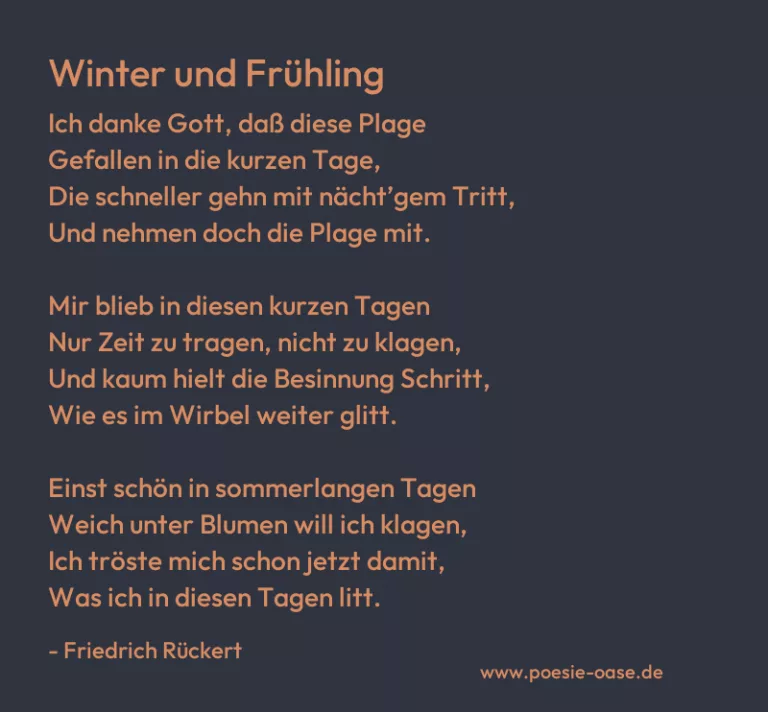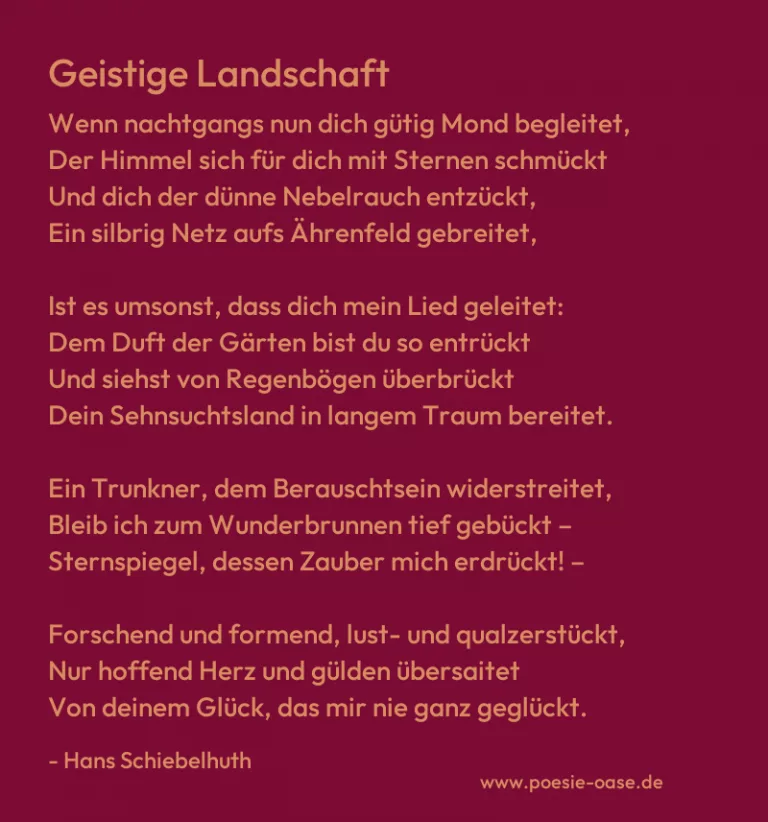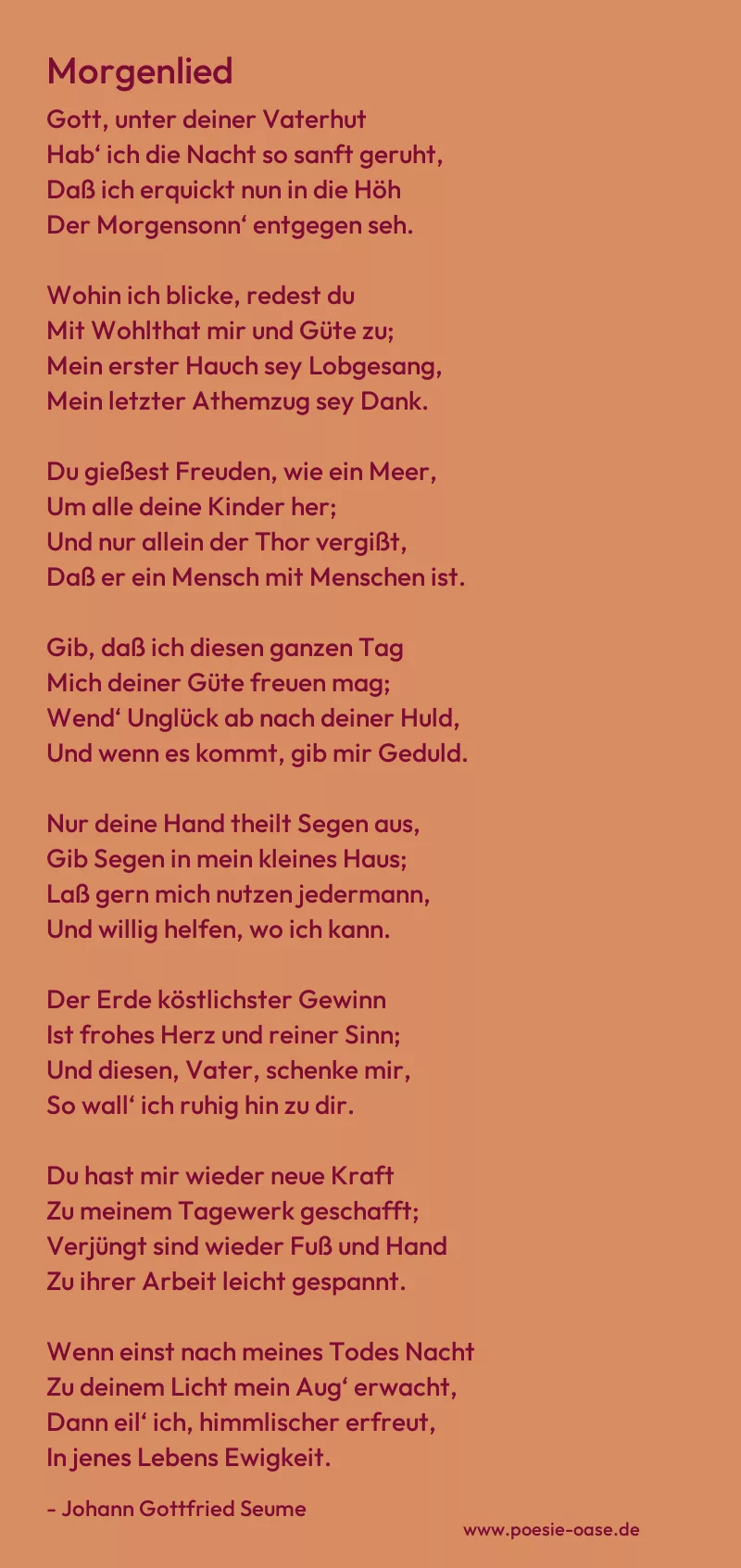Gott, unter deiner Vaterhut
Hab‘ ich die Nacht so sanft geruht,
Daß ich erquickt nun in die Höh
Der Morgensonn‘ entgegen seh.
Wohin ich blicke, redest du
Mit Wohlthat mir und Güte zu;
Mein erster Hauch sey Lobgesang,
Mein letzter Athemzug sey Dank.
Du gießest Freuden, wie ein Meer,
Um alle deine Kinder her;
Und nur allein der Thor vergißt,
Daß er ein Mensch mit Menschen ist.
Gib, daß ich diesen ganzen Tag
Mich deiner Güte freuen mag;
Wend‘ Unglück ab nach deiner Huld,
Und wenn es kommt, gib mir Geduld.
Nur deine Hand theilt Segen aus,
Gib Segen in mein kleines Haus;
Laß gern mich nutzen jedermann,
Und willig helfen, wo ich kann.
Der Erde köstlichster Gewinn
Ist frohes Herz und reiner Sinn;
Und diesen, Vater, schenke mir,
So wall‘ ich ruhig hin zu dir.
Du hast mir wieder neue Kraft
Zu meinem Tagewerk geschafft;
Verjüngt sind wieder Fuß und Hand
Zu ihrer Arbeit leicht gespannt.
Wenn einst nach meines Todes Nacht
Zu deinem Licht mein Aug‘ erwacht,
Dann eil‘ ich, himmlischer erfreut,
In jenes Lebens Ewigkeit.