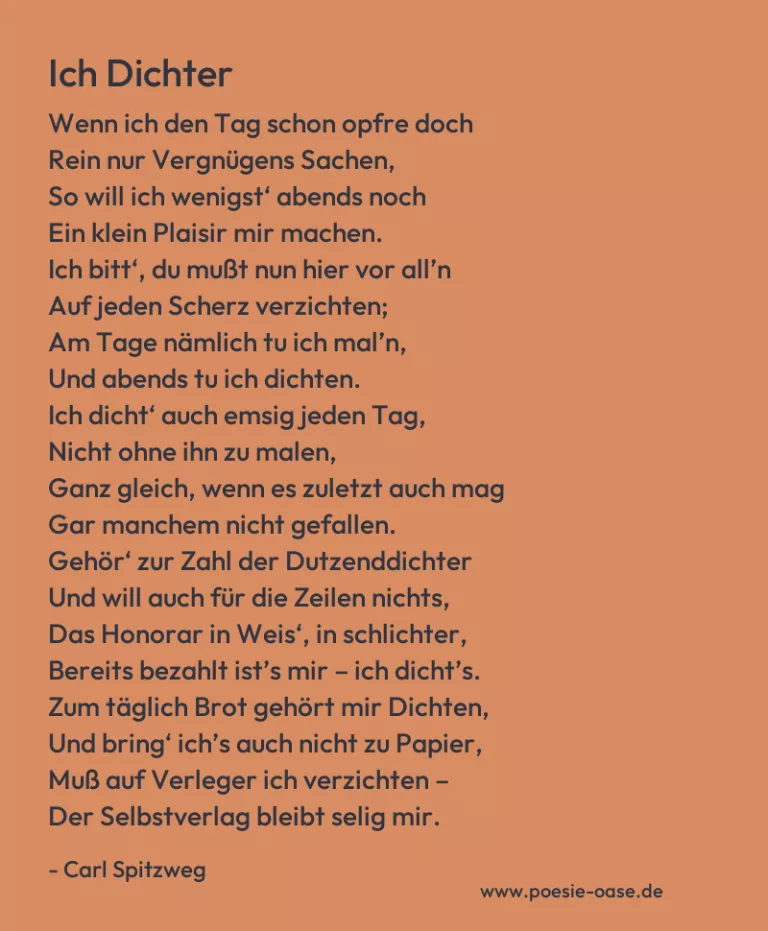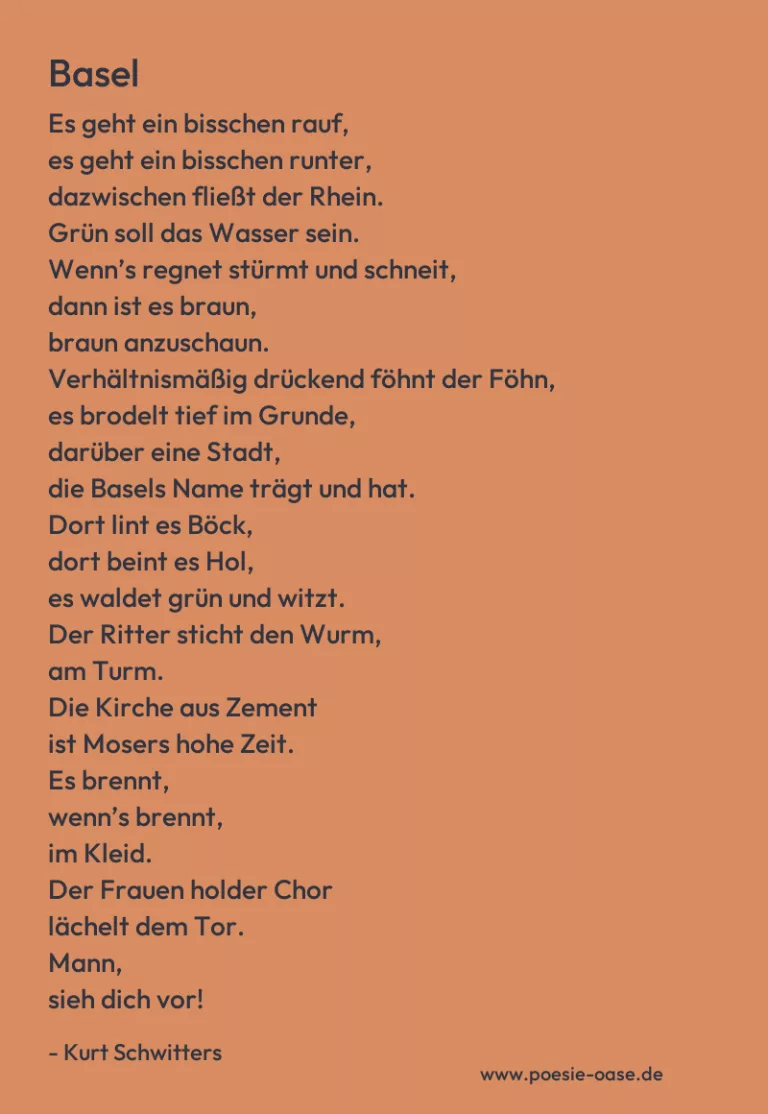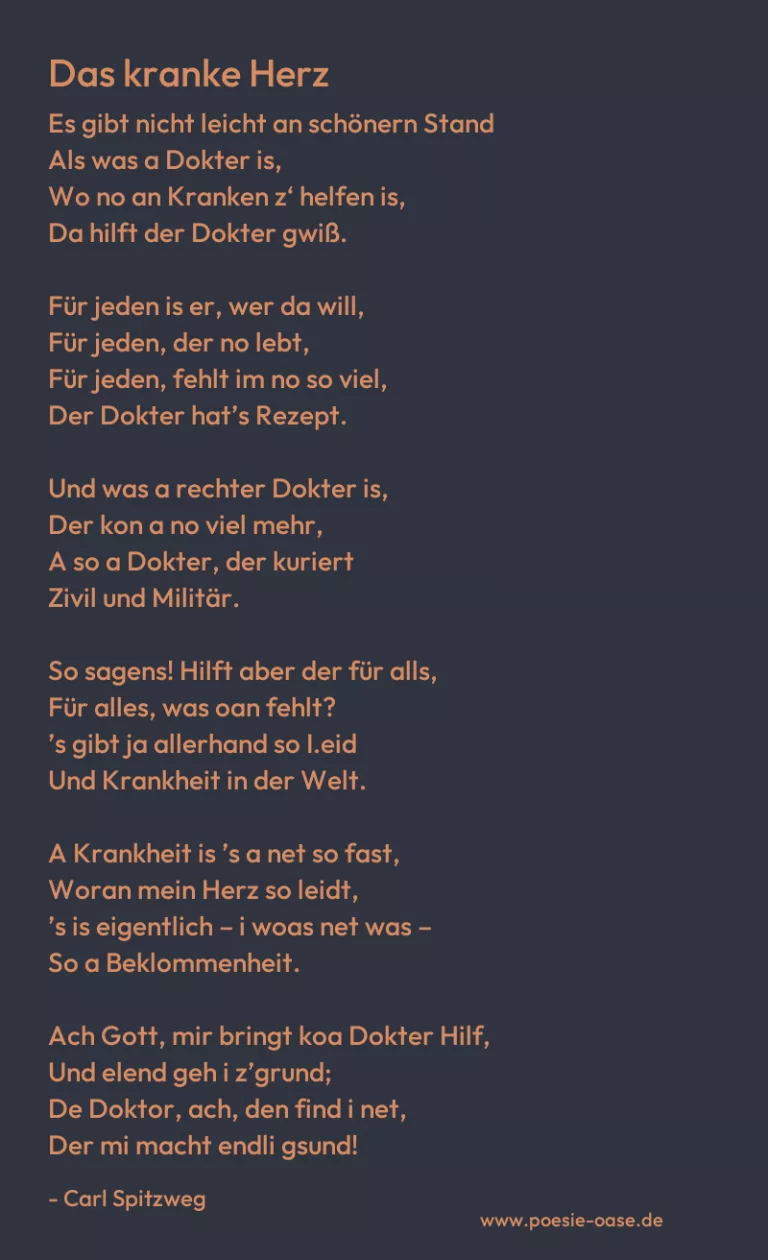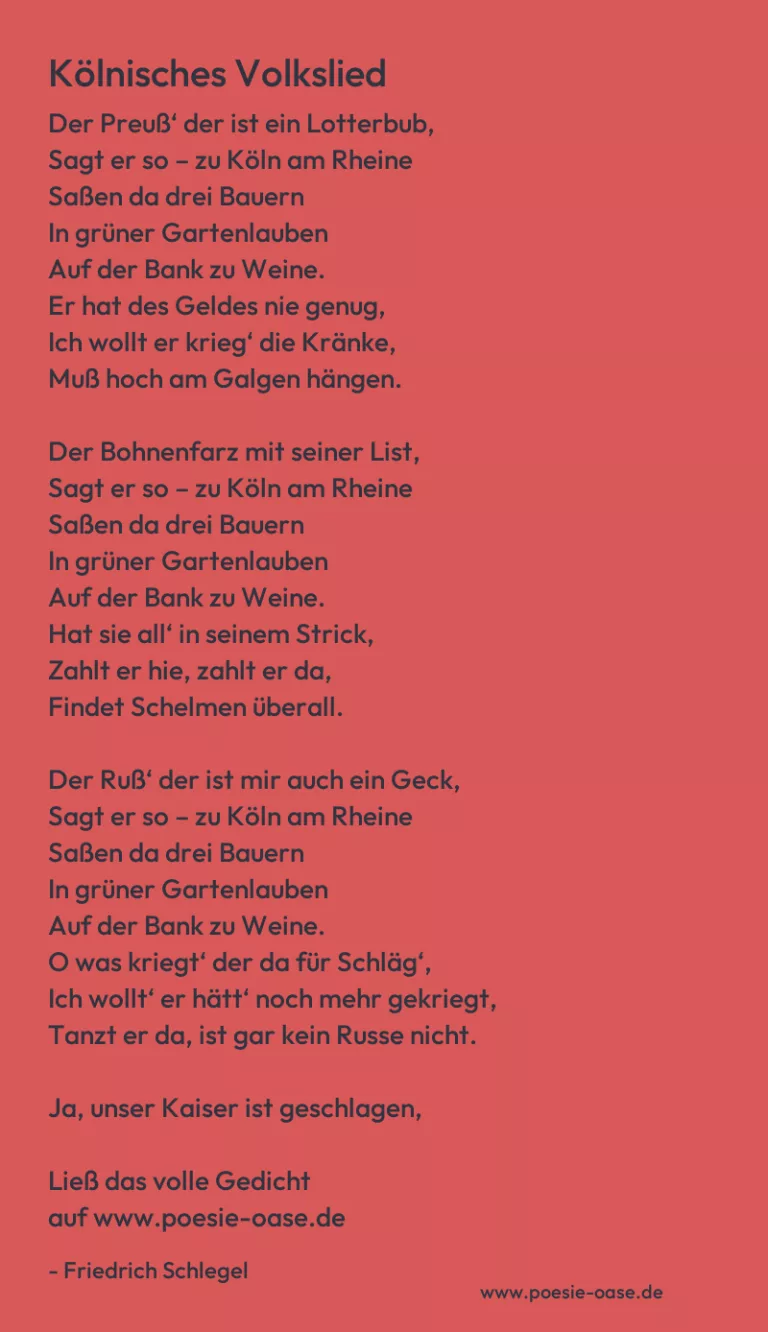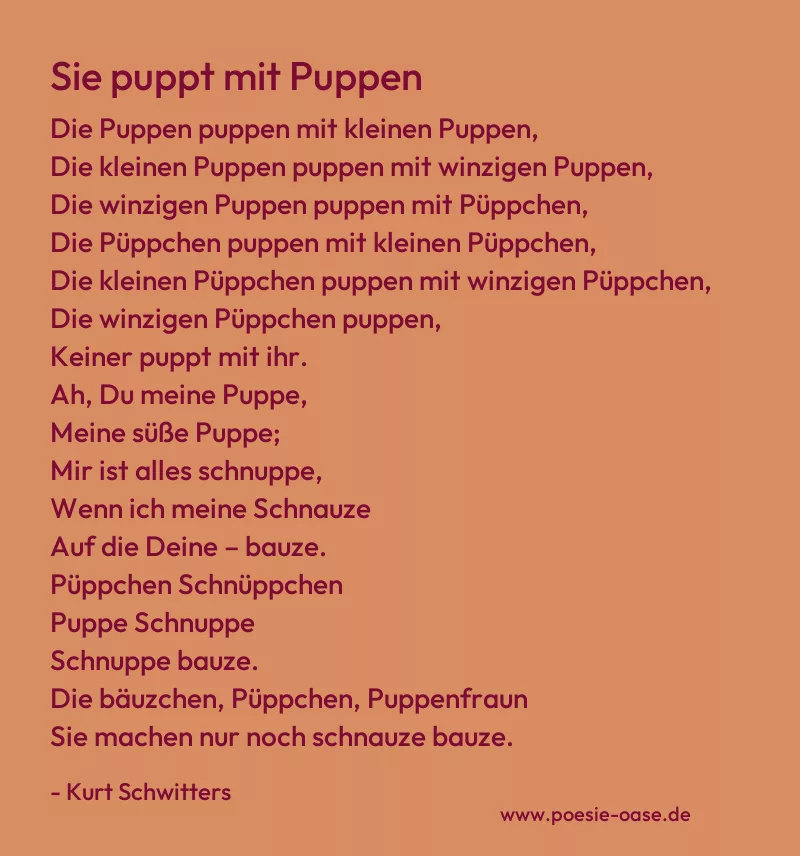Sie puppt mit Puppen
Die Puppen puppen mit kleinen Puppen,
Die kleinen Puppen puppen mit winzigen Puppen,
Die winzigen Puppen puppen mit Püppchen,
Die Püppchen puppen mit kleinen Püppchen,
Die kleinen Püppchen puppen mit winzigen Püppchen,
Die winzigen Püppchen puppen,
Keiner puppt mit ihr.
Ah, Du meine Puppe,
Meine süße Puppe;
Mir ist alles schnuppe,
Wenn ich meine Schnauze
Auf die Deine – bauze.
Püppchen Schnüppchen
Puppe Schnuppe
Schnuppe bauze.
Die bäuzchen, Püppchen, Puppenfraun
Sie machen nur noch schnauze bauze.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
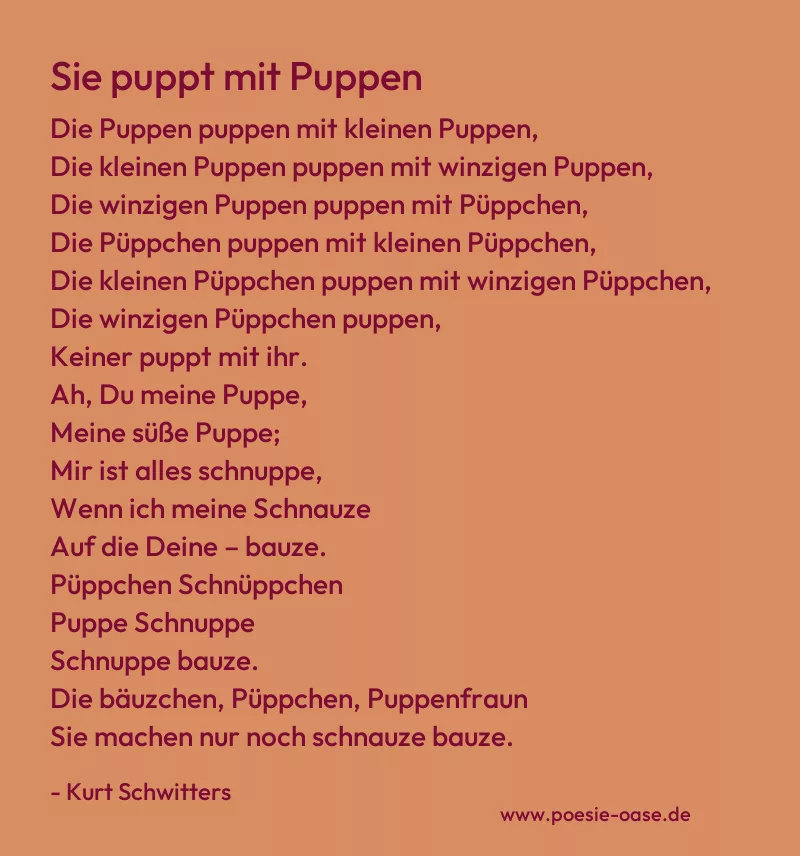
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sie puppt mit Puppen“ von Kurt Schwitters ist ein weiteres Beispiel für dadaistische Wortspielerei und die experimentelle Manipulation von Sprache. Die fortlaufende Wiederholung von „Puppen“ und „Püppchen“ sowie die Erfindung von neuen Begriffen wie „puppt“ und „bauze“ erzeugen eine Atmosphäre des Absurden, in der die Bedeutung der Wörter immer weiter zersplittert wird. Diese Wiederholungen erzeugen eine hypnotische, beinahe rhythmische Wirkung und betonen die Unfähigkeit, feste Bedeutung oder Ordnung in der Sprache zu finden.
Die wiederholte Struktur des Gedichts, bei der „die Puppen puppen mit kleinen Puppen“ und so weiter, suggeriert eine endlose, fast mechanistische Reproduktion. Hier könnte Schwitters auf die Idee der Automatismen oder das mechanische Verhalten von Dingen und Menschen anspielen. Es scheint ein fortlaufendes Spiel mit Objekten und ihrer Wiederholung, das durch die Schaffung von immer kleineren „Puppen“ eine Entmenschlichung und eine Zersplitterung der Bedeutung darstellt. Der Ausdruck „Keiner puppt mit ihr“ bricht diese endlose Kettenreaktion und führt zu einer Einsamkeit und einem Ausschluss. Die Puppen sind gefangen in einer endlosen Schleife der Reproduktion und Isolation.
Der zweite Teil des Gedichts – „Ah, Du meine Puppe, / Meine süße Puppe; / Mir ist alles schnuppe“ – ändert plötzlich den Ton und bringt eine Personifizierung der „Puppe“ ein. Der Sprecher richtet sich an die Puppe als Objekt der Zuneigung, doch gleichzeitig wird die Beziehung zwischen Sprecher und Puppe durch das Wort „schnuppe“ – was „egal“ oder „gleichgültig“ bedeutet – auf eine ironische Weise entwertet. Hier spielt Schwitters auf eine verzerrte, absurde Form der Zuneigung an, die zugleich eine Entfremdung enthält. Der humorvolle Ton, der durch das Wortspiel „Schnauze auf die Deine – bauze“ verstärkt wird, verleiht dem Gedicht eine bizarre Leichtigkeit, während es gleichzeitig die Bedeutungslosigkeit und Absurdität der Beziehung betont.
Der Abschluss des Gedichts, das in den unverständlichen Klangwörtern „Die bäuzchen, Püppchen, Puppenfraun / Sie machen nur noch schnauze bauze“ endet, führt den Leser weiter in das Absurde. Die Worte verlieren jegliche feste Bedeutung und werden zu Lautmalereien, die die Entfremdung und das Fehlen von Kommunikation verstärken. Die Wiederholung und die Transformation der Worte in eine rhythmische, unsinnige Sprache scheinen die Themen von Isolation und Sinnentleerung zu unterstreichen.
Insgesamt zeigt Schwitters hier auf humorvolle Weise die Absurdität und Leere von Beziehungen und Bedeutungen. Durch die spielerische Manipulation der Sprache und die kontinuierliche Wiederholung von Wörtern verweist er auf die Monotonie und Fragmentierung, die in der modernen Welt existieren, wo Kommunikation oft auf einen endlosen Kreis von unklaren Zeichen reduziert wird. Das Gedicht ist ein typisches Beispiel für die dadaistische Technik, die den Leser auffordert, die Bedeutung von Sprache selbst zu hinterfragen und zu erkennen, wie diese Bedeutung von der Gesellschaft, von Konventionen und von Wiederholungen entleert werden kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.