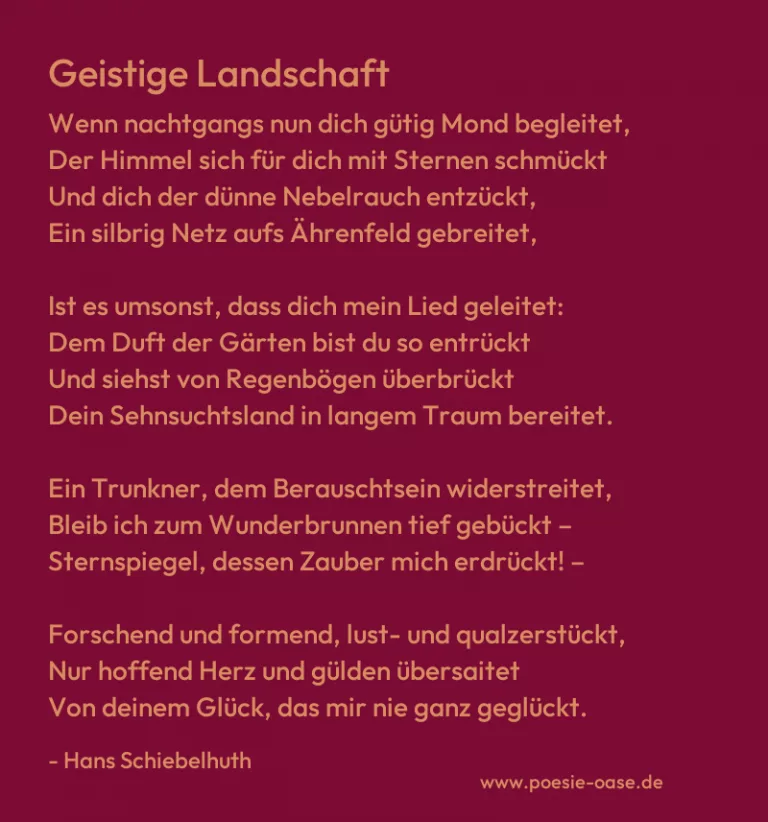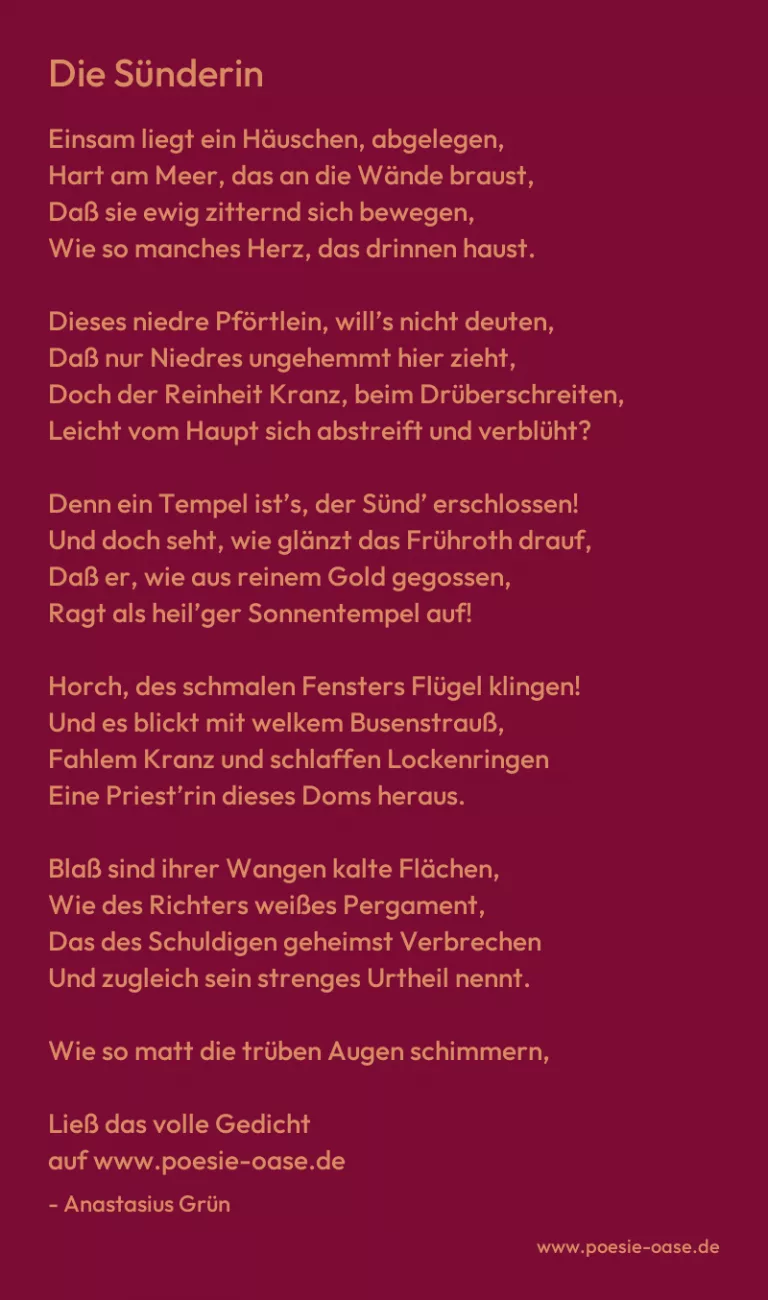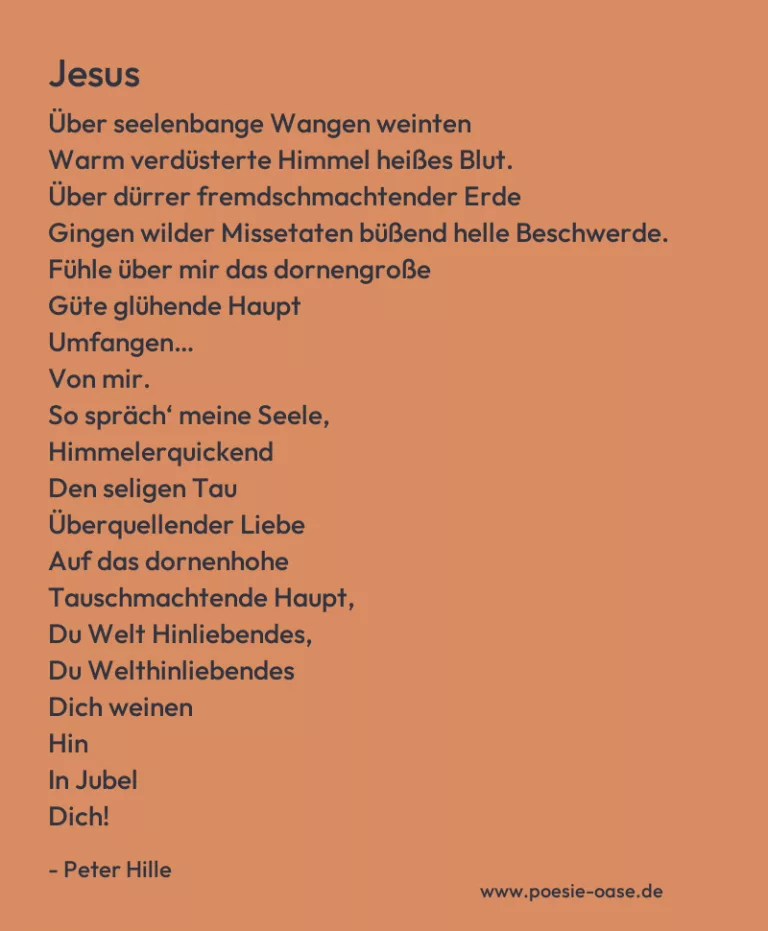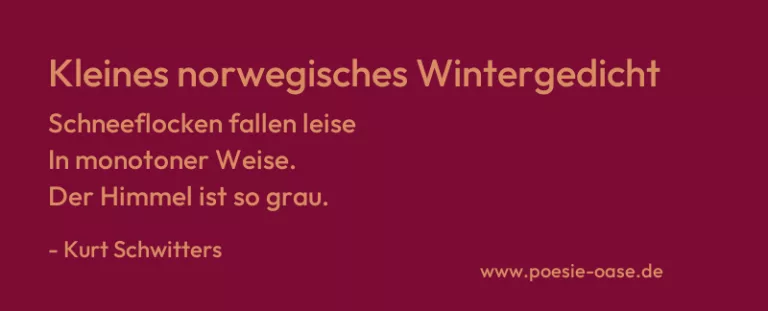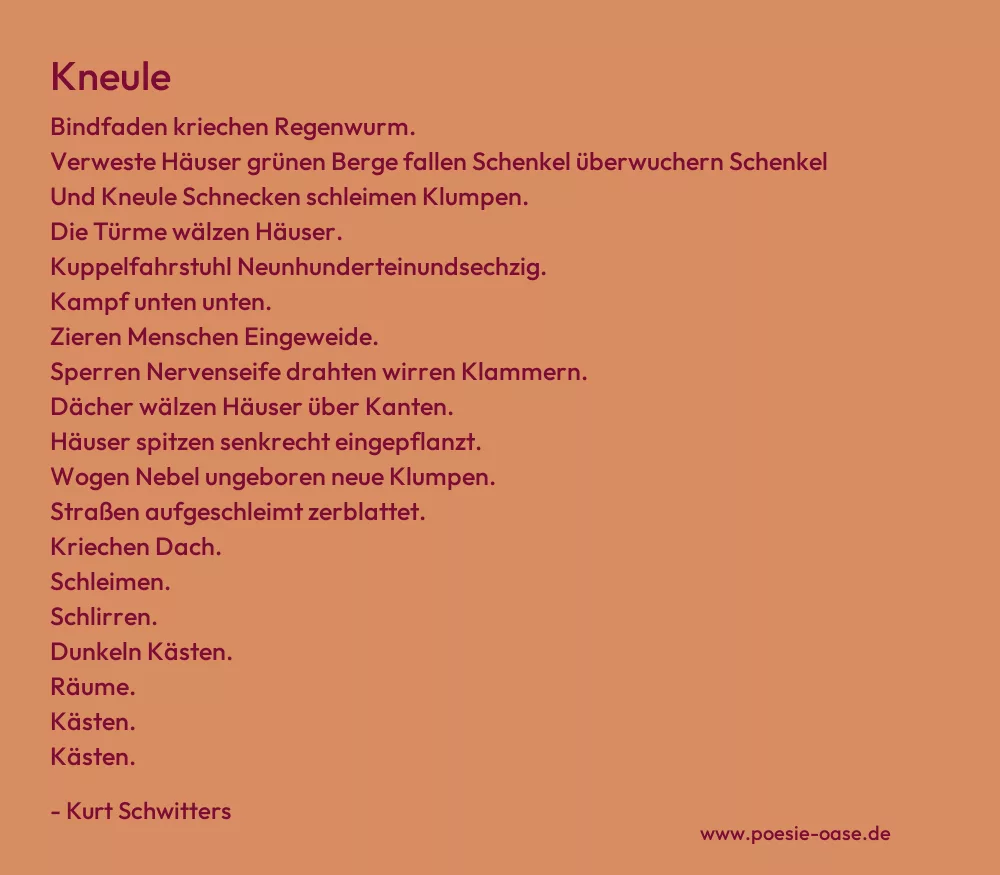Kneule
Bindfaden kriechen Regenwurm.
Verweste Häuser grünen Berge fallen Schenkel überwuchern Schenkel
Und Kneule Schnecken schleimen Klumpen.
Die Türme wälzen Häuser.
Kuppelfahrstuhl Neunhunderteinundsechzig.
Kampf unten unten.
Zieren Menschen Eingeweide.
Sperren Nervenseife drahten wirren Klammern.
Dächer wälzen Häuser über Kanten.
Häuser spitzen senkrecht eingepflanzt.
Wogen Nebel ungeboren neue Klumpen.
Straßen aufgeschleimt zerblattet.
Kriechen Dach.
Schleimen.
Schlirren.
Dunkeln Kästen.
Räume.
Kästen.
Kästen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
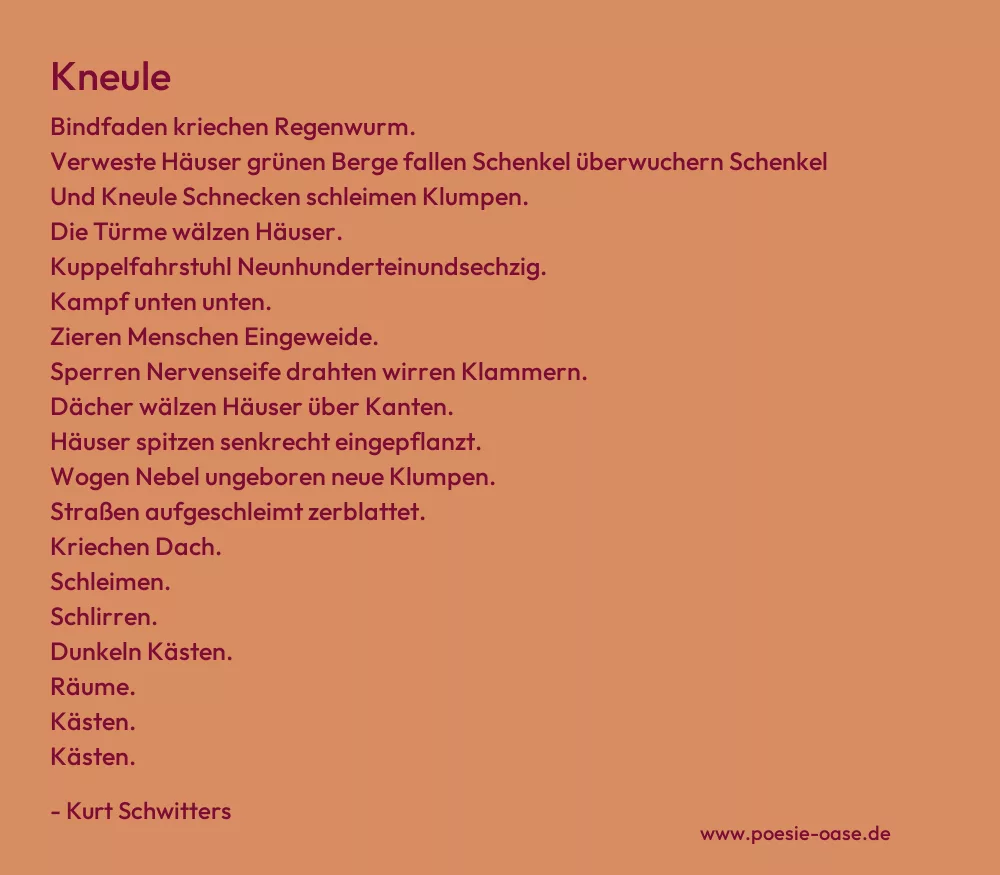
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Kneule“ von Kurt Schwitters ist ein weiteres Beispiel für dadaistische Sprachkunst, das mit einem chaotischen, surrealen Bildkosmos spielt. Die ungewöhnliche Bildsprache und die Fragmentierung der Realität vermitteln den Eindruck einer zerstörten oder transformierten Welt. Der Text verzichtet auf lineare Erzählweise und betont stattdessen die wilde, unstrukturierte Aneinanderreihung von Bildern und Lauten.
Die ersten Zeilen – „Bindfaden kriechen Regenwurm“ – erzeugen eine Assoziation von Lebewesen, die sich durch eine veränderte, fast bedrohliche Welt bewegen. Das Bild von „verweste Häusern“ und „grünen Bergen“ zeigt eine Welt im Verfall, die jedoch gleichzeitig von einem ungewöhnlichen, fast organischen Wachstum geprägt ist. Die Schilderung von „Schenkel überwuchern Schenkel“ und „Schnecken schleimen Klumpen“ lässt den Leser in eine surreale und groteske Szenerie eintauchen, in der die Trennung zwischen Natur, Architektur und menschlichem Körper verschwimmt.
Der Vers „Die Türme wälzen Häuser“ und die bizarre Anordnung von „Kuppelfahrstuhl Neunhunderteinundsechzig“ verstärken den Eindruck einer fragmentierten, verformten Welt. Schwitters schafft es, durch die ungewohnte Wortwahl und die Verfremdung der gewohnten Begriffe, den Leser zu einem anderen Wahrnehmen der Welt zu zwingen. Das scheinbar zufällige Zusammensetzen von Elementen wie „Nervenseife“ und „Klammern“ ruft ein Bild von Verwirrung und Überforderung hervor, das mit den Assoziationen zur modernen, von Maschinen und Technik dominierten Welt zusammenpasst.
Das Gedicht ist ein Paradebeispiel für dadaistische Zerstörung und Neuschöpfung. Die kontinuierliche Wiederholung des Wortes „Kästen“ verstärkt das Gefühl der Zwanghaftigkeit und Eingesperrtheit. Es könnte auf die Konformität und Begrenztheit der modernen Welt hinweisen, die durch die immer wiederkehrende Vorstellung von Kästen und zerfallenden Räumen symbolisiert wird. Der Text fordert den Leser heraus, die Bedeutung der Worte zu hinterfragen und die Verbindung zwischen den Bildern zu dekonstruieren. Es geht weniger um die traditionelle Bedeutung von Sprache, sondern um die Erzeugung eines neuen Verständnisses von Realität durch den Umgang mit Klängen und Fragmenten.
Schwitters nimmt die alltäglichen Bilder und verformt sie zu einer surreale Collage, die die Leser aus ihrer gewohnten Wahrnehmung herausführt und sie dazu bringt, sich der fragmentierten, chaotischen Welt zu stellen. Der Text bietet keine klare Botschaft oder Bedeutung, sondern ist ein experimentelles Spiel mit den Elementen der Sprache, das dem dadaistischen Prinzip folgt, die Grenzen von Kunst und Sprache aufzulösen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.