Schneeflocken fallen leise
In monotoner Weise.
Der Himmel ist so grau.

Tiefernst!
- Frieden
- Gemeinfrei
- Glaube & Spiritualität
Schneeflocken fallen leise
In monotoner Weise.
Der Himmel ist so grau.
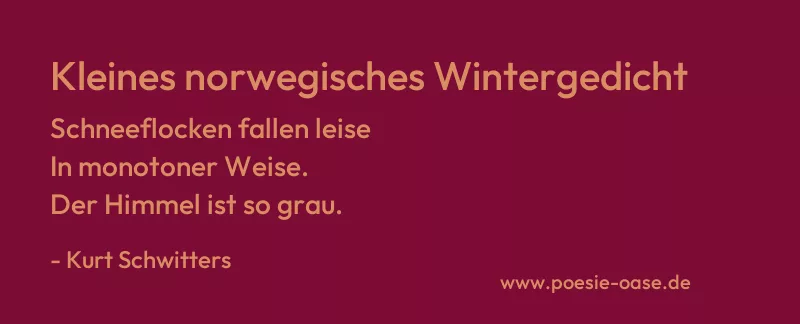
Das Gedicht „Kleines norwegisches Wintergedicht“ von Kurt Schwitters beschreibt auf schlichte Weise eine winterliche Szene, die durch ihre Minimalistik eine eindrucksvolle Atmosphäre erzeugt. Die „Schneeflocken“, die „leise“ und in „monotone[r] Weise“ fallen, schaffen ein Bild der Ruhe und Einsamkeit. Die wiederholte Betonung des „leisen“ Fallens und der Monotonie unterstreicht die Tristesse und das Gefühl der Langeweile, das der Winter in dieser Darstellung hervorruft. Der Schnee, der sich still und unaufhörlich niederlässt, symbolisiert die Langsamkeit und die gleichförmige Schwere dieser Jahreszeit.
Der „graue“ Himmel, der in der letzten Zeile des Gedichts erscheint, verstärkt das Bild der Tristesse und der Unbelebtheit. Grau ist eine Farbe, die mit Düsternis, Melancholie und Erschöpfung assoziiert wird. Der Himmel wird hier nicht als lebendiges Element, sondern als leere, nicht-wechselnde Fläche dargestellt, was die Kälte und das Gefühl der Einförmigkeit weiter verstärkt.
Schwitters gelingt es, mit wenigen Worten und ohne komplexe Metaphorik eine sehr klare und prägnante Stimmung zu erzeugen. In seiner Einfachheit kann das Gedicht als Reflexion über die winterliche Isolation und die Stille verstanden werden, die diese Jahreszeit mit sich bringen kann. Der Fokus auf das „leise“ Fallen und die „monotone“ Bewegung des Schnees lässt den Leser in eine fast meditative, gedämpfte Atmosphäre eintauchen. Es ist ein Gedicht, das durch seine Klarheit und Zurückhaltung eine tiefe emotionale Wirkung entfaltet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.