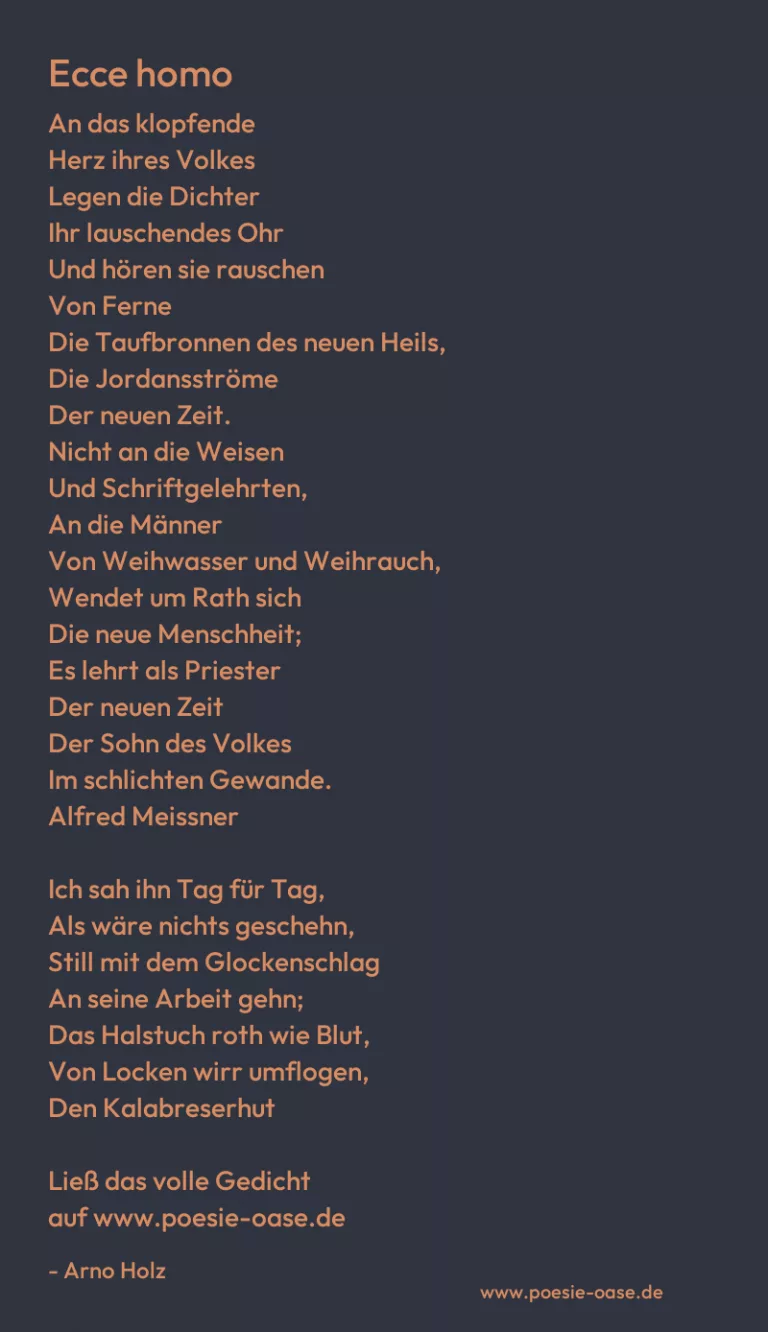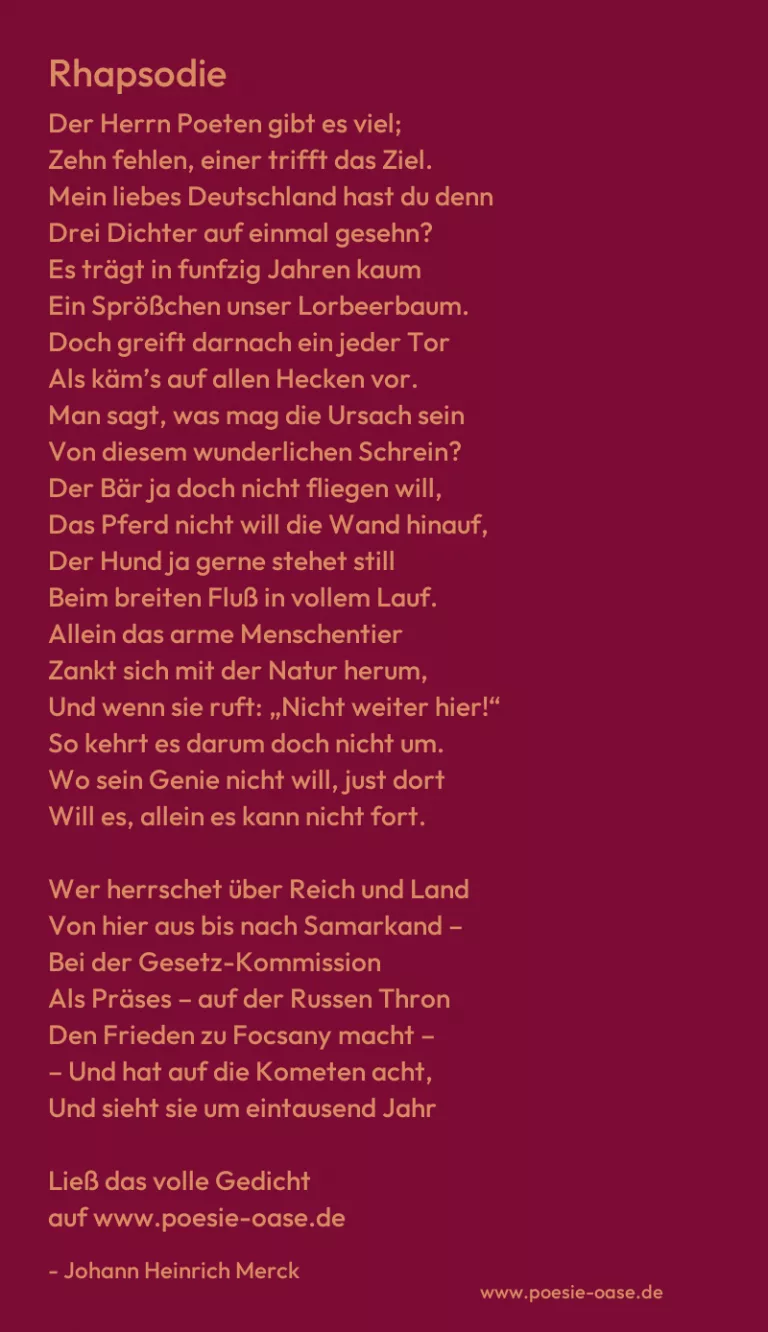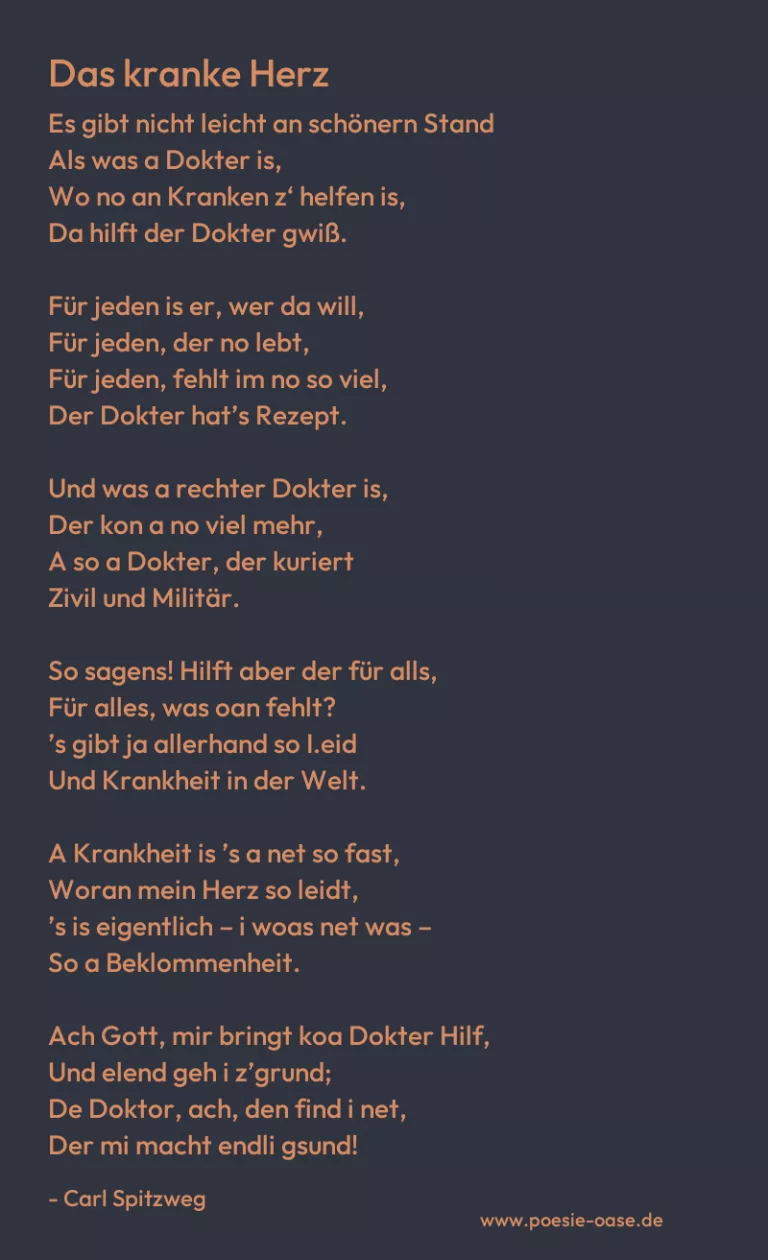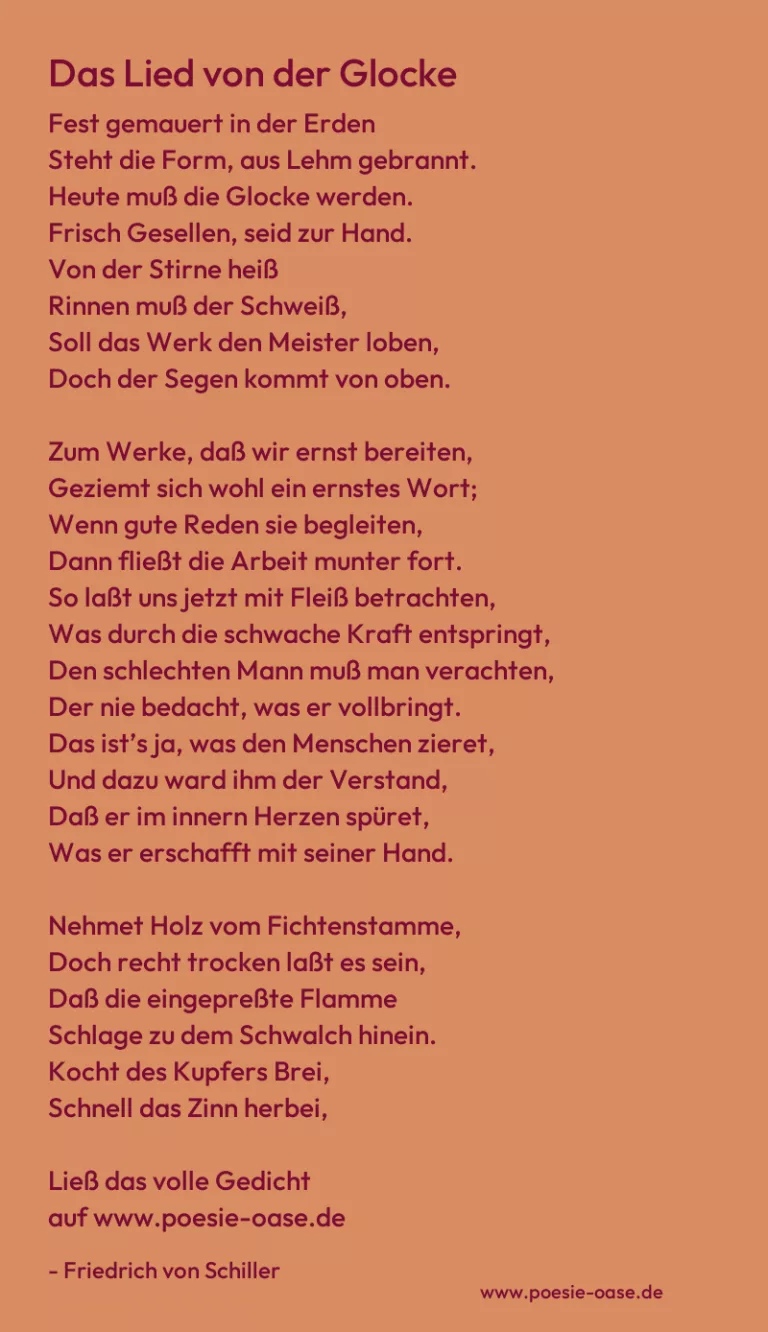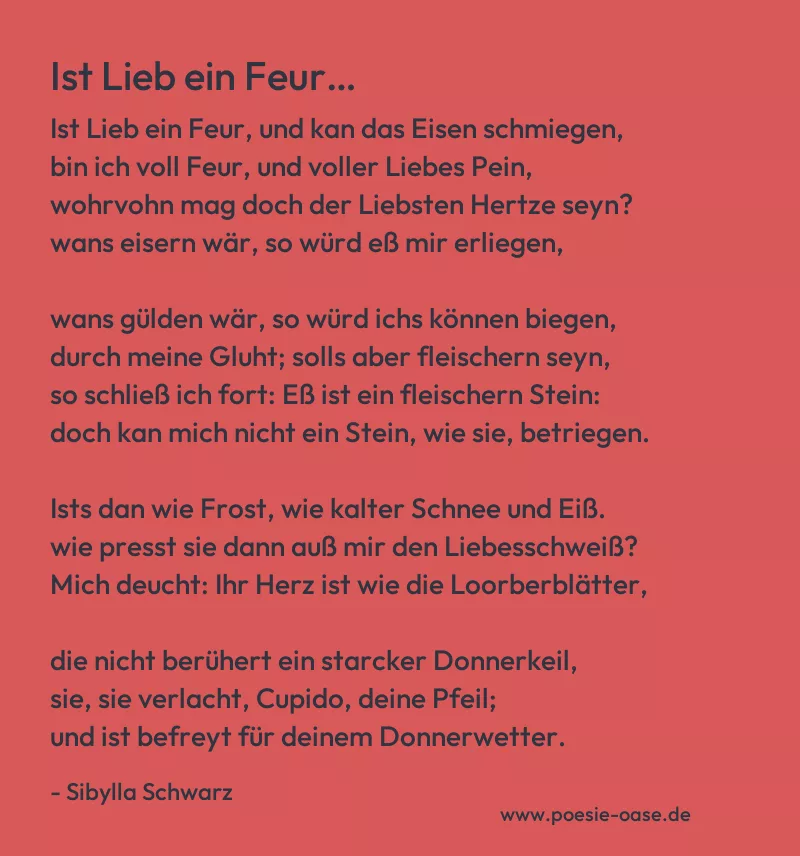Ist Lieb ein Feur…
Ist Lieb ein Feur, und kan das Eisen schmiegen,
bin ich voll Feur, und voller Liebes Pein,
wohrvohn mag doch der Liebsten Hertze seyn?
wans eisern wär, so würd eß mir erliegen,
wans gülden wär, so würd ichs können biegen,
durch meine Gluht; solls aber fleischern seyn,
so schließ ich fort: Eß ist ein fleischern Stein:
doch kan mich nicht ein Stein, wie sie, betriegen.
Ists dan wie Frost, wie kalter Schnee und Eiß.
wie presst sie dann auß mir den Liebesschweiß?
Mich deucht: Ihr Herz ist wie die Loorberblätter,
die nicht berühert ein starcker Donnerkeil,
sie, sie verlacht, Cupido, deine Pfeil;
und ist befreyt für deinem Donnerwetter.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
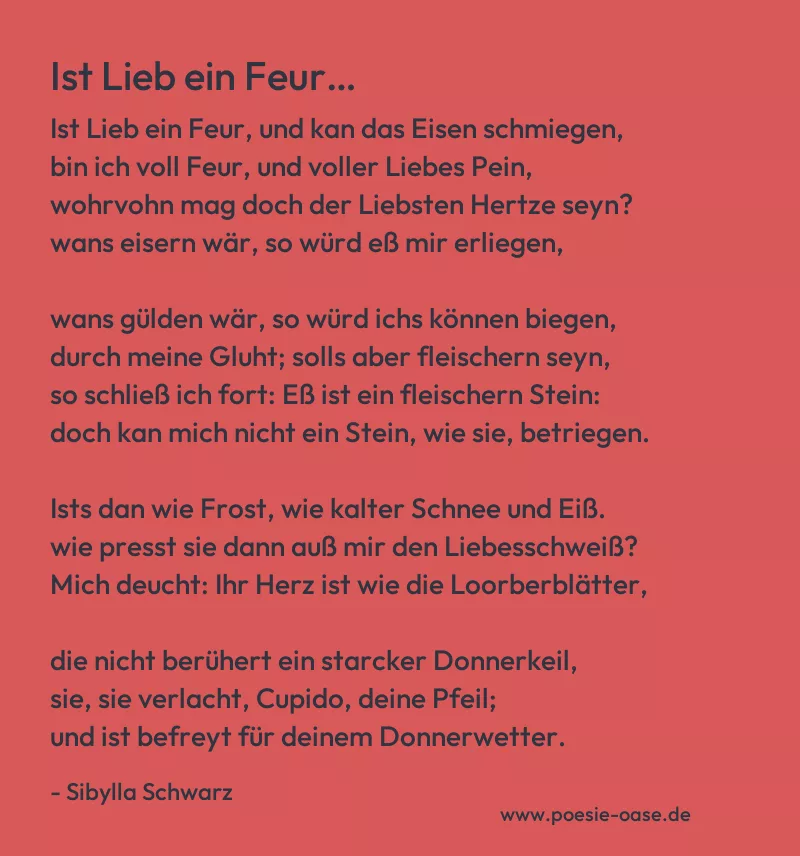
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ist Lieb ein Feur…“ von Sibylla Schwarz beschäftigt sich mit der intensiven und schmerzhaften Erfahrung der Liebe, die in einer Metaphorik von Feuer, Eis und Stein beschrieben wird. Zu Beginn stellt die Dichterin die Frage, ob die Liebe wie Feuer ist, das in der Lage ist, Eisen zu schmieden. In diesem Fall ist sie selbst „voll Feuer“ und leidet unter der „Liebes Pein“. Diese bildhafte Sprache unterstreicht die Leidenschaft und das leidvolle Gefühl, das die Liebe hervorruft, wobei die Dichte und Schwere des „Eisens“ als Symbol für das Herz der Geliebten verwendet wird. Sie fragt sich, warum das Herz ihrer Liebsten nicht der Hitze und dem Feuer ihrer Liebe nachgibt.
Im weiteren Verlauf des Gedichts wird diese Vorstellung weiter entwickelt. Die Dichterin stellt sich vor, dass, wenn das Herz der Geliebten aus „goldenem“ Material bestünde, sie es mit ihrer Glut biegen könnte. Gold, das weiche, formbare Metall, würde der Hitze ihrer Leidenschaft nachgeben. Doch sie erkennt, dass das Herz ihrer Geliebten anscheinend aus „fleischern“ Stoff besteht – ein „fleischern Stein“, der von der Glut unbeeindruckt bleibt. Dies führt zu der Erkenntnis, dass ihre Liebe an dieser Unbeweglichkeit des Herzens der Geliebten scheitert, was den Schmerz und die Enttäuschung verstärkt.
Die zweite Hälfte des Gedichts stellt das Herz der Geliebten als völlig unberührbar dar. Es wird mit „Frost“, „kaltem Schnee“ und „Eis“ verglichen, was die Kälte und Unbeweglichkeit der Geliebten betont. In diesem Zustand ist es nahezu unmöglich für die Dichterin, irgendeine Form von Leidenschaft oder Nähe zu erzeugen. Die Frage nach dem „Liebesschweiß“ – einem Zeichen der Erregung oder Leidenschaft – bleibt daher unbeantwortet. In der letzten Strophe wird das Herz der Geliebten schließlich mit Lorbeerblättern verglichen, die selbst einen „starcken Donnerkeil“ nicht berühren können. Diese Unberührbarkeit und Unempfindlichkeit gegenüber der Liebe der Dichterin stellt eine endgültige Abweisung dar, und die Geliebte erscheint als unerreichbar.
Abschließend wird das Bild von „Cupidon“ (der Gott der Liebe) und seinem „Donnerwetter“ eingeführt. Trotz der schmerzhaften Ablehnung durch das Herz der Geliebten bleibt sie unbeeindruckt und verlacht den Versuch, sie mit den Pfeilen der Liebe zu treffen. In dieser Darstellung wird das Herz der Geliebten als völlig immun gegen die Versuchungen der Liebe gezeigt, was den Schmerz und die Resignation der Dichterin weiter verstärkt. Das Gedicht endet in einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit, da die Liebe trotz aller Anstrengungen nicht erwidert wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.