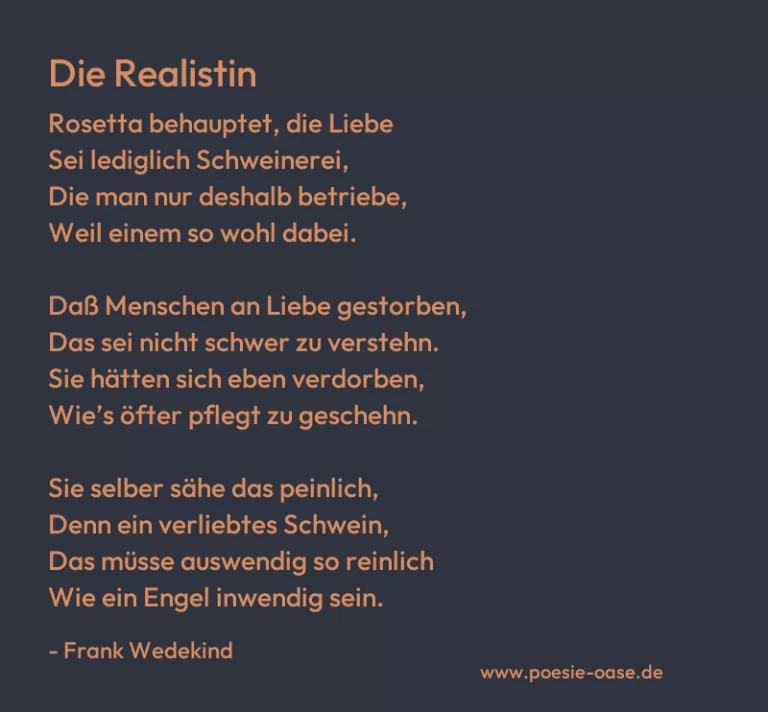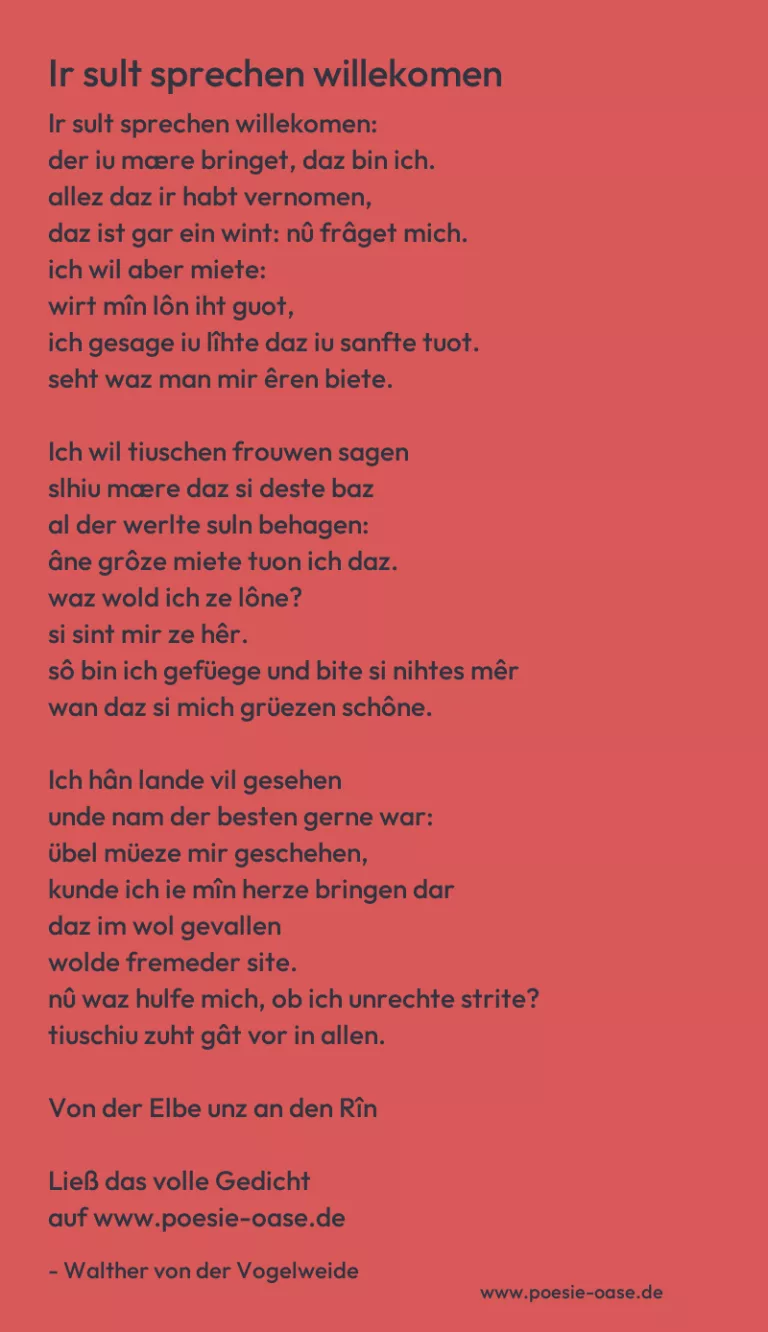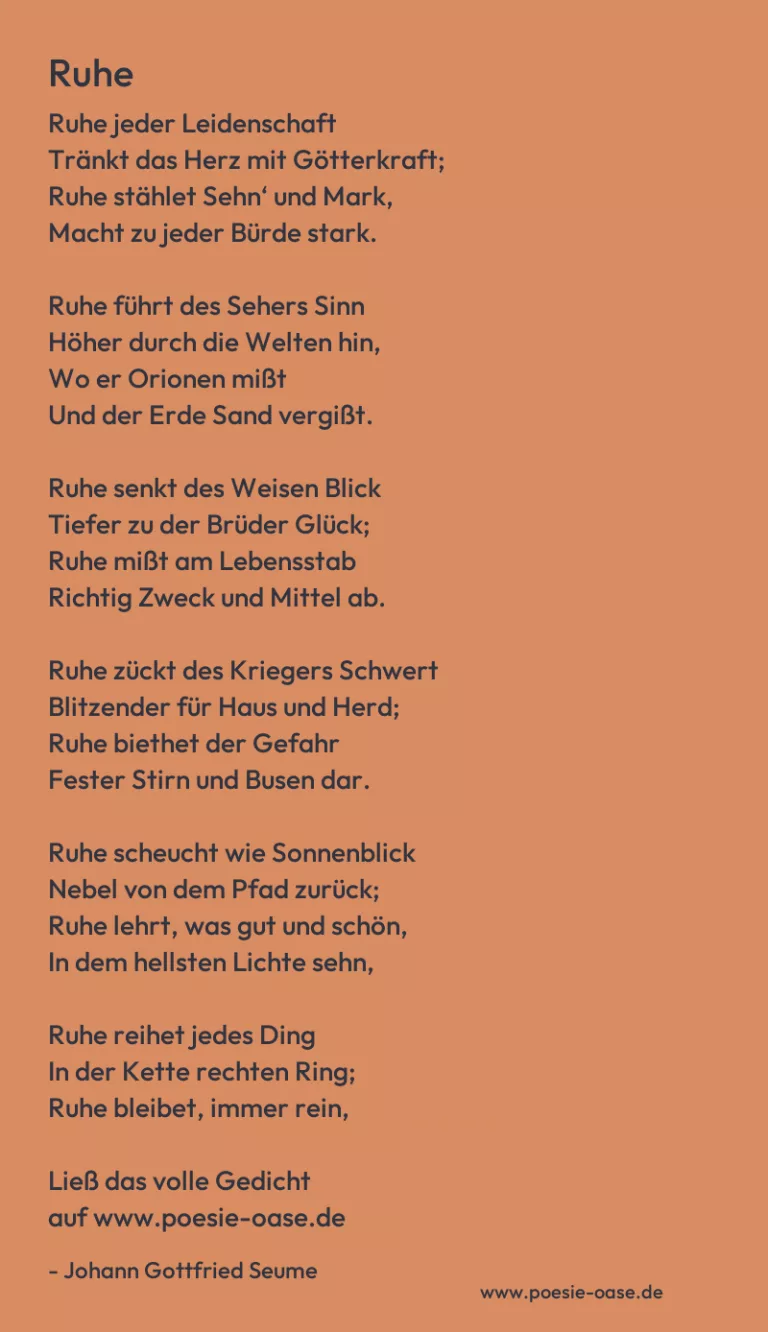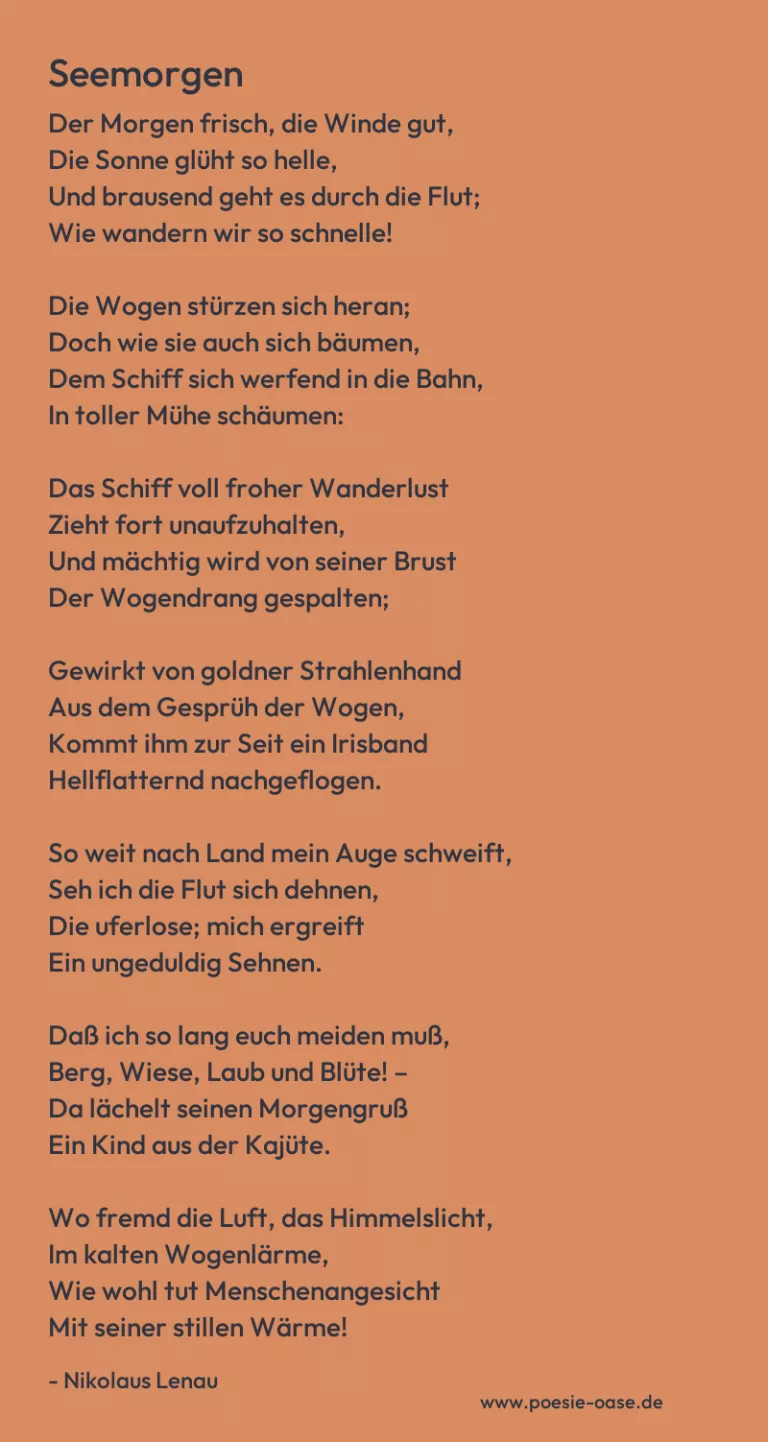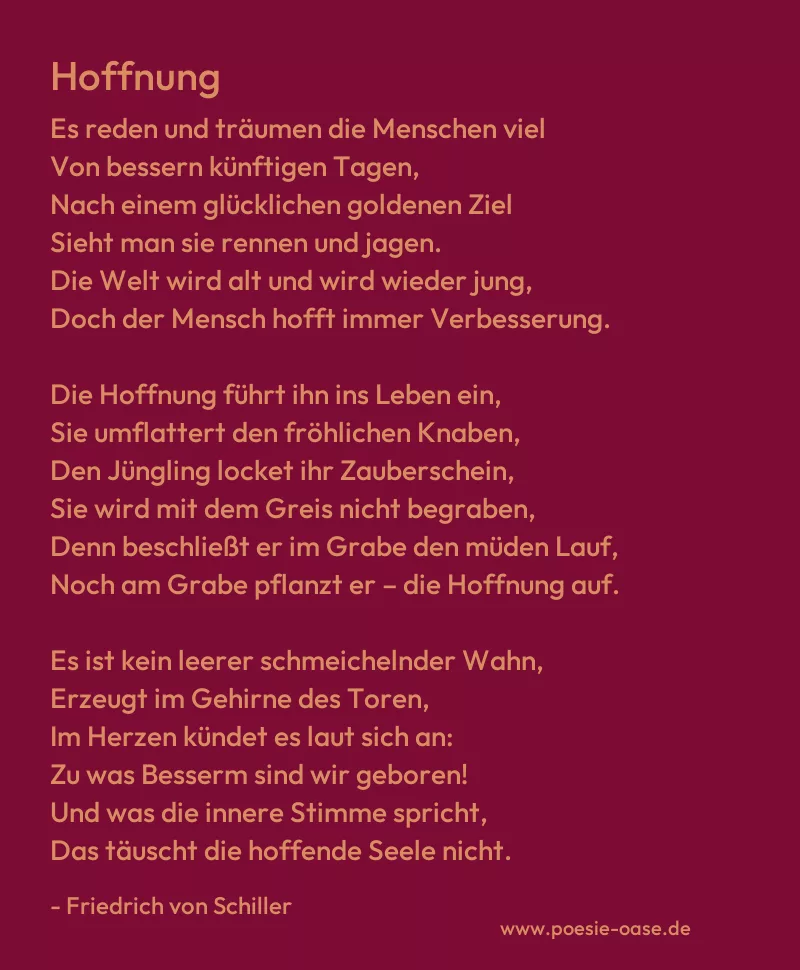Hoffnung
Es reden und träumen die Menschen viel
Von bessern künftigen Tagen,
Nach einem glücklichen goldenen Ziel
Sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung,
Doch der Mensch hofft immer Verbesserung.
Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,
Sie umflattert den fröhlichen Knaben,
Den Jüngling locket ihr Zauberschein,
Sie wird mit dem Greis nicht begraben,
Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf,
Noch am Grabe pflanzt er – die Hoffnung auf.
Es ist kein leerer schmeichelnder Wahn,
Erzeugt im Gehirne des Toren,
Im Herzen kündet es laut sich an:
Zu was Besserm sind wir geboren!
Und was die innere Stimme spricht,
Das täuscht die hoffende Seele nicht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
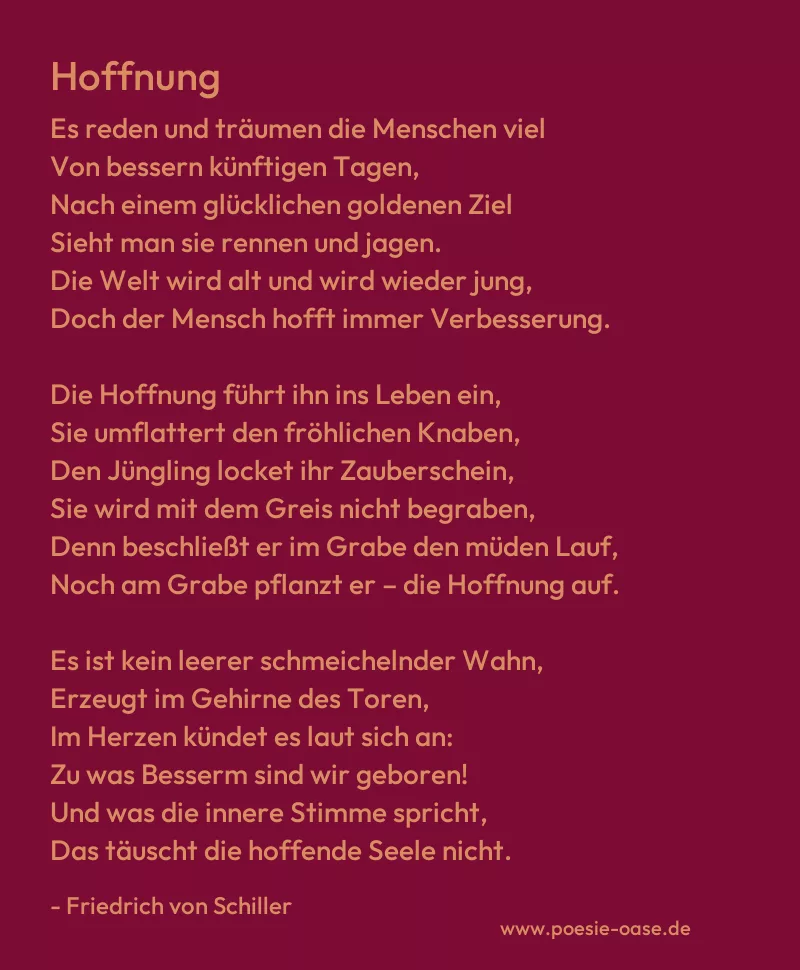
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Hoffnung“ von Friedrich von Schiller behandelt das zentrale Thema der menschlichen Sehnsucht nach Verbesserung und einem besseren zukünftigen Leben. Hoffnung wird hier als eine mächtige und beständige Kraft beschrieben, die den Menschen über alle Lebensphasen hinweg begleitet und ihm einen Sinn für die Zukunft gibt.
Zu Beginn des Gedichts wird die menschliche Sehnsucht nach besseren Zeiten und einem „goldenen Ziel“ thematisiert. Schiller stellt fest, dass die Menschen immer von einer glücklicheren Zukunft träumen und nach diesem Ideal streben, egal wie alt die Welt oder der Mensch wird. Die Hoffnung ist dabei eine konstante Begleiterin, die den Menschen antreibt und ihm hilft, selbst in schwierigen Zeiten nach Verbesserung zu streben. Diese hoffnungsvollen Träume sind tief in der menschlichen Natur verwurzelt und leiten das Handeln der Menschen.
Die Hoffnung wird als eine lebendige Kraft dargestellt, die den Menschen von der Kindheit bis ins hohe Alter begleitet. Sie wird metaphorisch als ein „Zauberschein“ beschrieben, der sowohl den fröhlichen Knaben als auch den Greis in seinen Bann zieht. Besonders bemerkenswert ist die Vorstellung, dass die Hoffnung den „müden Lauf“ des Lebens auch im Alter noch begleitet, sodass der Mensch selbst im Angesicht des Todes nicht aufhört zu hoffen. „Noch am Grabe pflanzt er – die Hoffnung auf“ ist ein kraftvolles Bild für die Unsterblichkeit der Hoffnung, die niemals vergeht, sondern immer weiterlebt.
Schiller geht weiter und betont, dass Hoffnung kein „leerer schmeichelnder Wahn“ ist, sondern eine echte innere Überzeugung. Sie ist nicht das Produkt der Täuschung oder des blinden Glaubens, sondern ein tiefes Gefühl, das im Herzen der Menschen verankert ist. Der Mensch ist nach Schiller zu „Besserem geboren“, und die Hoffnung ist die Stimme, die ihn daran erinnert. Diese innere Stimme, die sich in der Hoffnung äußert, führt den Menschen zu dem Glauben an eine bessere Zukunft und lässt ihn nicht in Verzweiflung versinken.
Insgesamt vermittelt das Gedicht die Idee, dass Hoffnung eine essentielle und transformative Kraft im Leben des Menschen darstellt. Sie ist nicht nur ein flüchtiger Traum, sondern eine fundamentale, nahezu spirituelle Energie, die den Menschen dazu antreibt, immer nach Verbesserung zu streben, selbst in den schwierigsten Momenten des Lebens. Schiller zeigt hier die unerschütterliche Natur der Hoffnung und ihre Rolle als Triebfeder des menschlichen Lebens.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.