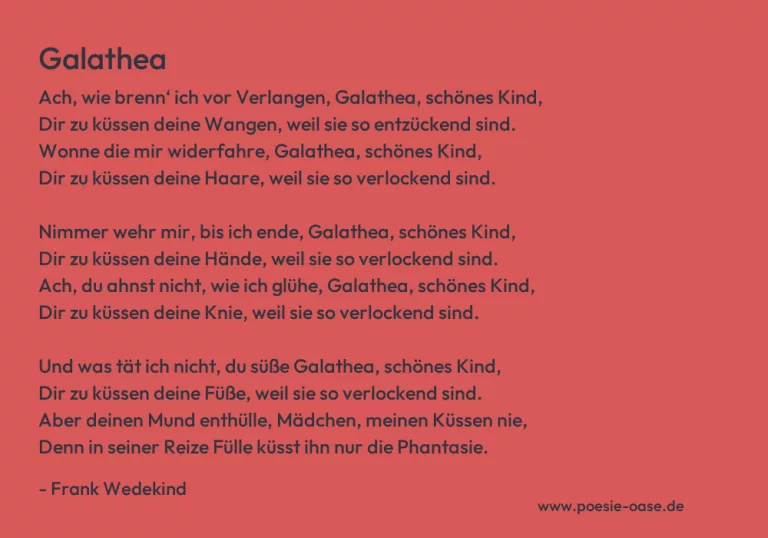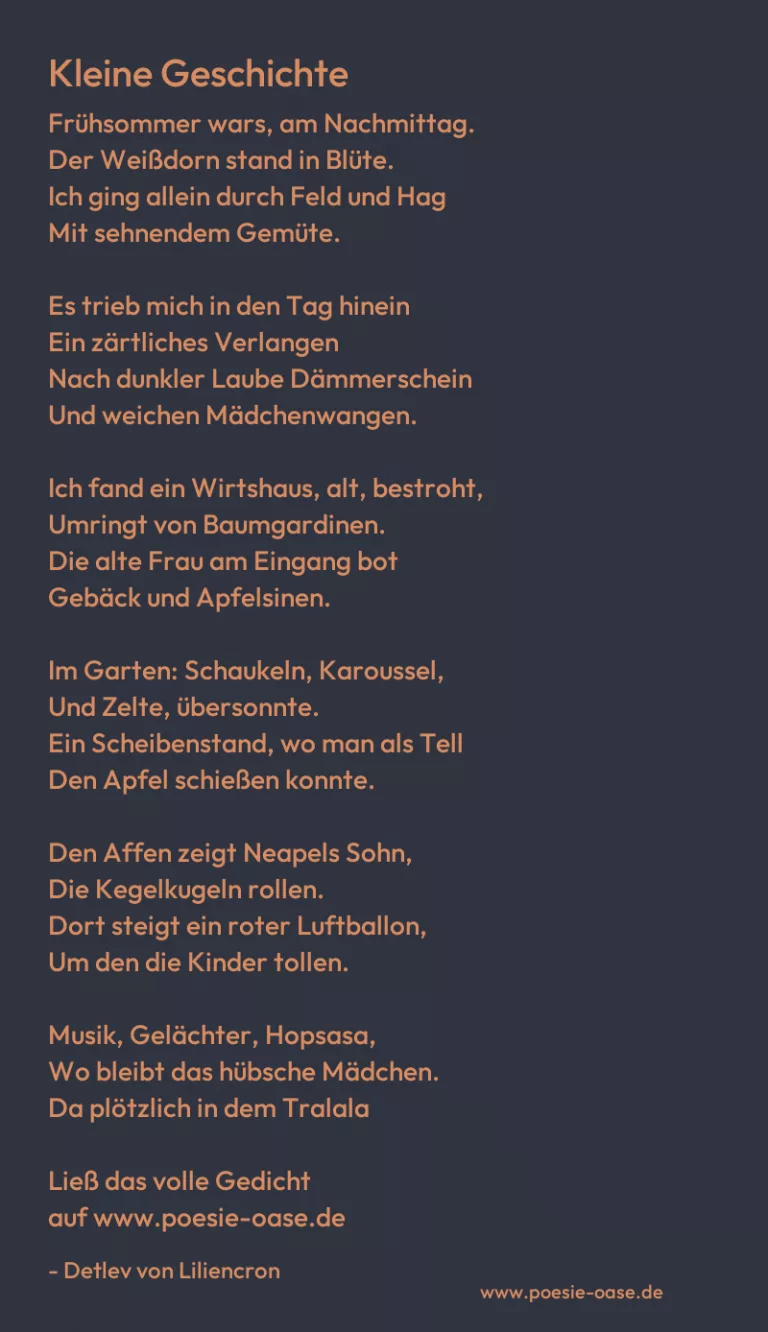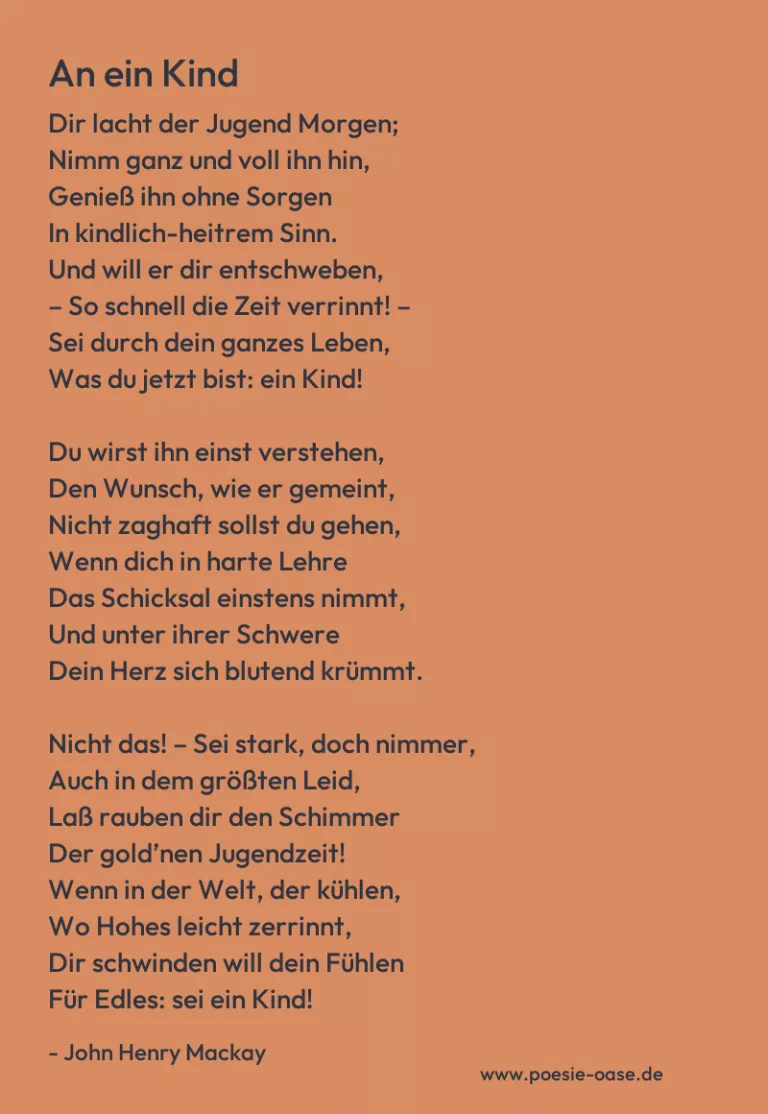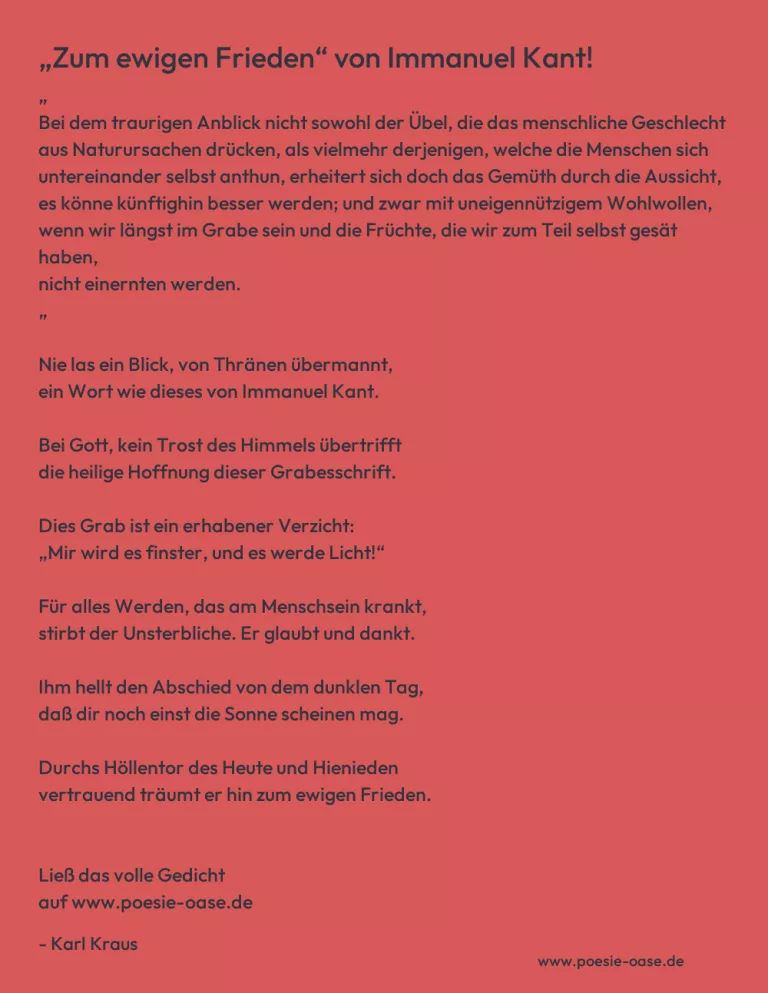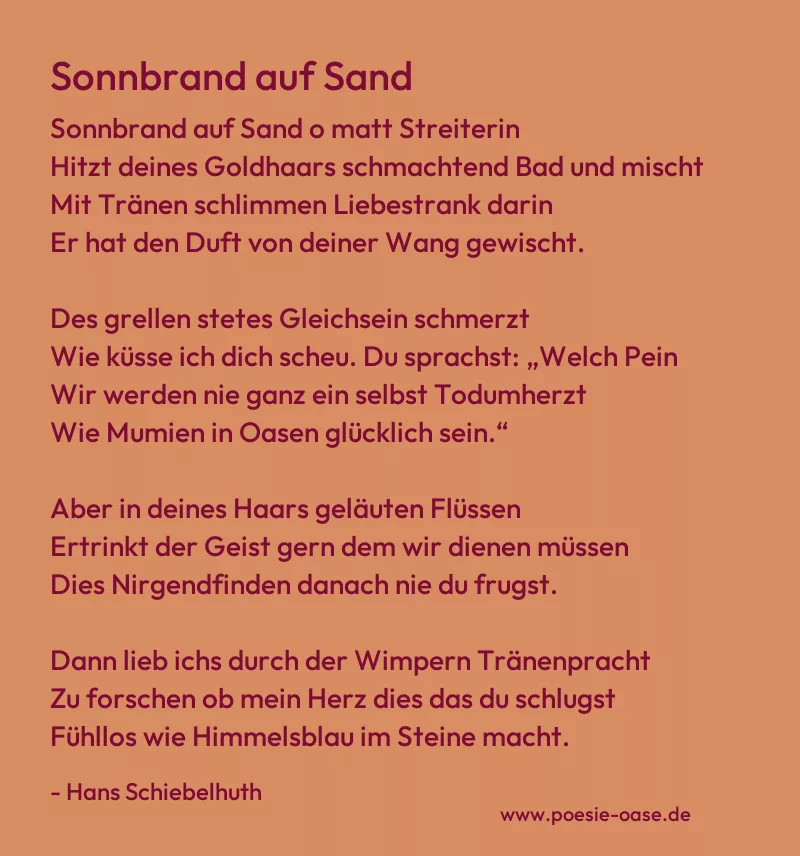Sonnbrand auf Sand
Sonnbrand auf Sand o matt Streiterin
Hitzt deines Goldhaars schmachtend Bad und mischt
Mit Tränen schlimmen Liebestrank darin
Er hat den Duft von deiner Wang gewischt.
Des grellen stetes Gleichsein schmerzt
Wie küsse ich dich scheu. Du sprachst: „Welch Pein
Wir werden nie ganz ein selbst Todumherzt
Wie Mumien in Oasen glücklich sein.“
Aber in deines Haars geläuten Flüssen
Ertrinkt der Geist gern dem wir dienen müssen
Dies Nirgendfinden danach nie du frugst.
Dann lieb ichs durch der Wimpern Tränenpracht
Zu forschen ob mein Herz dies das du schlugst
Fühllos wie Himmelsblau im Steine macht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
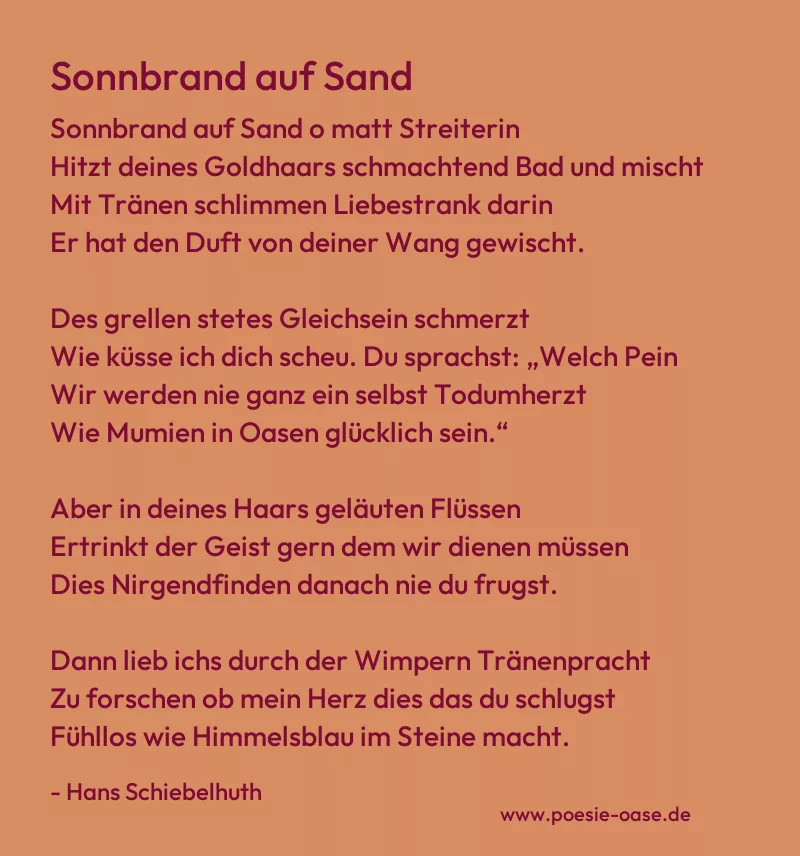
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sonnbrand auf Sand“ von Hans Schiebelhuth entwirft eine vielschichtige, emotionale Landschaft, die von schmerzhaften, unerfüllten Gefühlen und der Zerrissenheit zwischen Sehnsucht und Distanz geprägt ist. Zu Beginn des Gedichts wird die „Sonnbrand auf Sand“ als eine Metapher für intensives, aber auch schmerzliches Verlangen verwendet. Das „Goldhaar“ und die „Tränen“ vermischen sich mit einem „Liebestrank“, der den Duft einer geliebten Person symbolisiert, aber zugleich auch die Unvollkommenheit dieser Liebe – eine Liebe, die durch den Schmerz des Verlustes oder der Entfremdung verdorben ist.
Der Schmerz des „steten Gleichseins“ wird als eine konstante, quälende Präsenz beschrieben. Das lyrische Ich fühlt sich von der Liebe gequält und kann gleichzeitig nicht von ihr lassen. Die Vorstellung, nie „ganz ein selbst“ zu werden, zeigt die Unfähigkeit der Liebenden, vollständig miteinander eins zu werden. Dies wird als eine Art metaphysischer und existenzieller Pein beschrieben, die sogar den Tod oder die Erinnerung an die Liebe in einer versteinerten, unlebendigen Form als „Mumien in Oasen“ thematisiert – ein Bild für Liebe, die nicht wirklich lebt, sondern nur noch als leere Hülle existiert.
Die „Haare“ und die „Flüsse“, die das Gedicht beschreibt, könnten symbolisch für den Fluss der Zeit und der unaufhörlichen, sich verändernden Emotionen stehen. Der „Geist“, der „dem wir dienen müssen“, verweist auf das unfreiwillige Dienen der eigenen Sehnsüchte und der unerwiderten Liebe, die das lyrische Ich gefangen hält. Die Suche nach Erfüllung wird als ein „Nirgendfinden“ dargestellt – eine nie endende Reise ohne Hoffnung auf ein Ziel.
Am Ende des Gedichts bleibt ein ambivalentes Bild von Liebe und Sehnsucht. Das lyrische Ich sucht nach einem tieferen Verständnis oder einer Erlösung, doch es bleibt in einer schmerzhaften Ungewissheit gefangen. Die „Wimpern Tränenpracht“ verweist auf die emotionalen Narben, die das Herz des Ichs trägt, und das „Himmelsblau im Steine macht“ deutet auf die Kälte und das Verblassen der Hoffnung hin. Schiebelhuth vermittelt mit seiner dichten und symbolreichen Sprache eine existenzielle Auseinandersetzung mit der Liebe als eine paradoxe Mischung aus Schönheit, Schmerz und Unerreichbarkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.