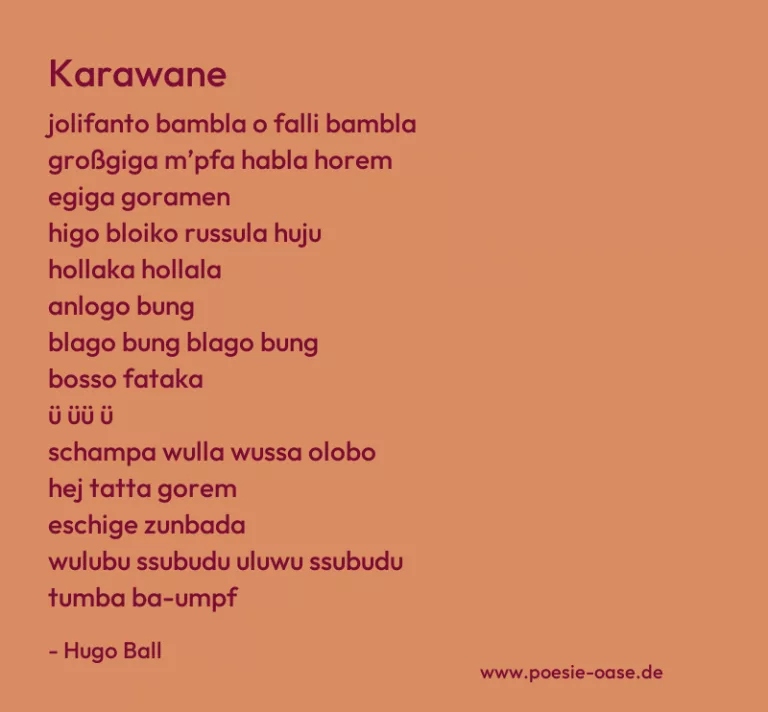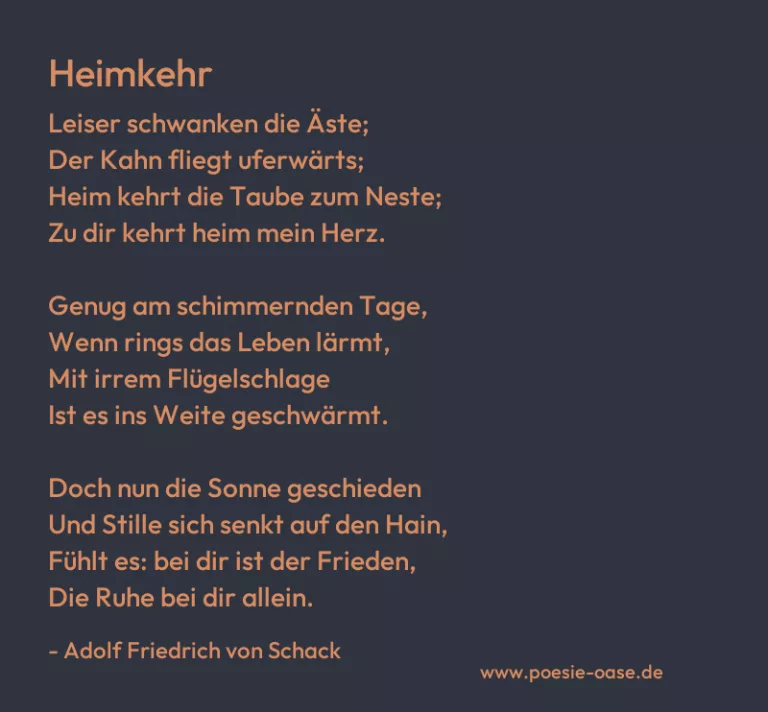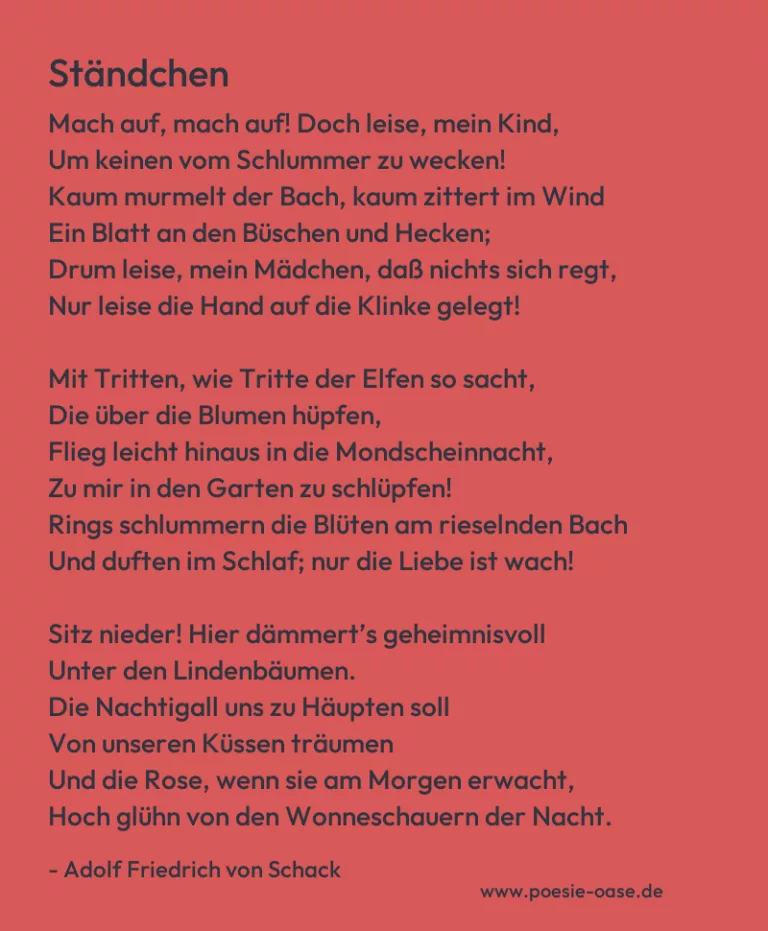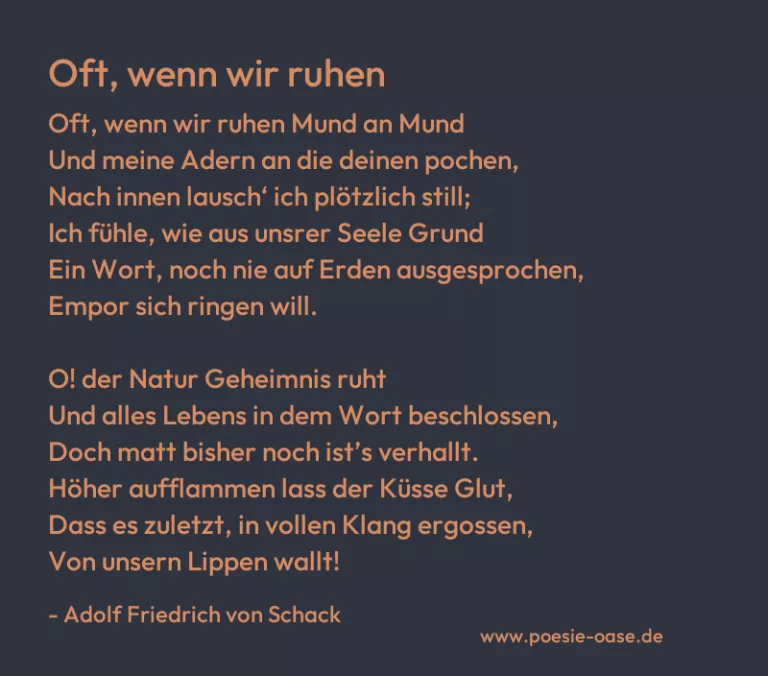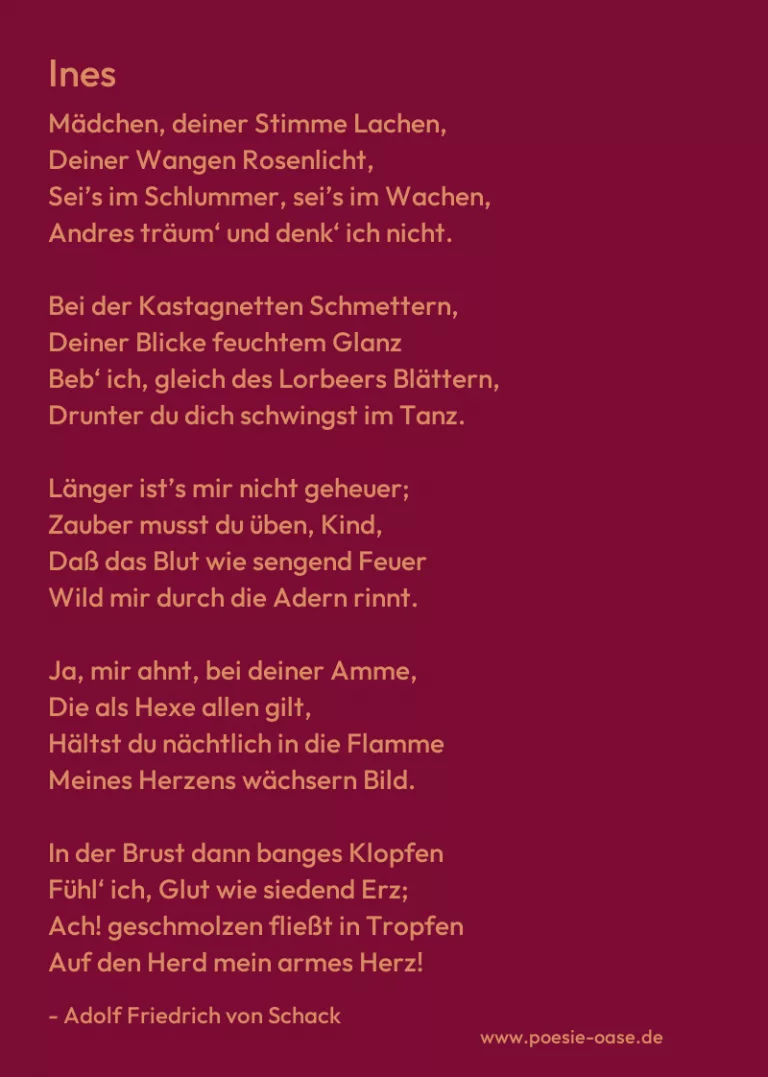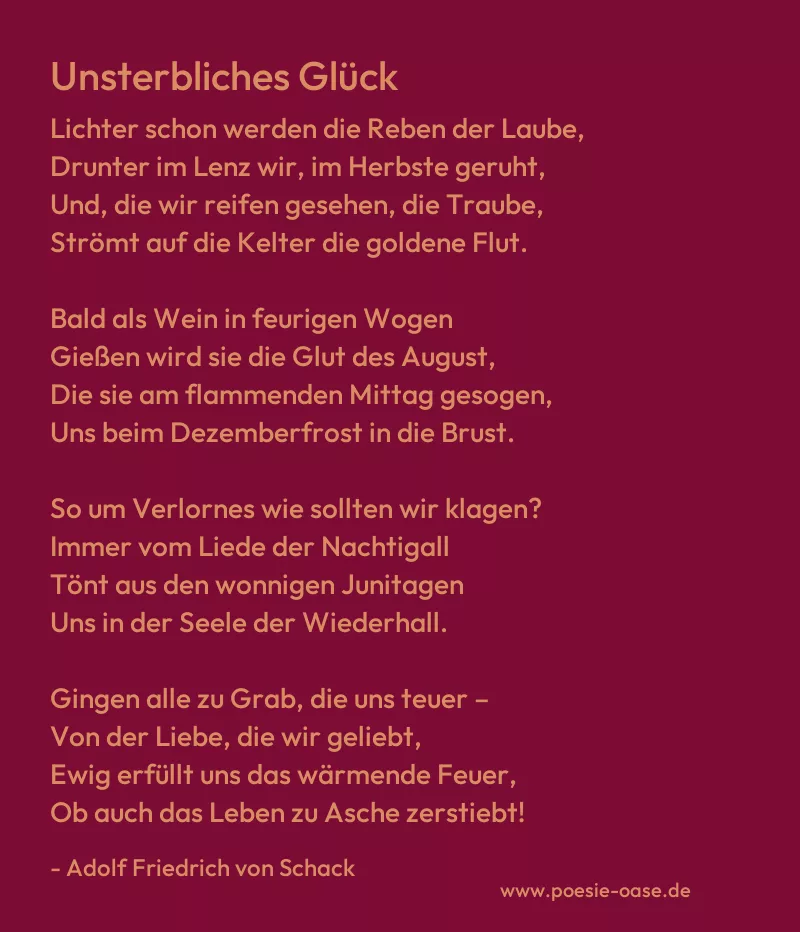Unsterbliches Glück
Lichter schon werden die Reben der Laube,
Drunter im Lenz wir, im Herbste geruht,
Und, die wir reifen gesehen, die Traube,
Strömt auf die Kelter die goldene Flut.
Bald als Wein in feurigen Wogen
Gießen wird sie die Glut des August,
Die sie am flammenden Mittag gesogen,
Uns beim Dezemberfrost in die Brust.
So um Verlornes wie sollten wir klagen?
Immer vom Liede der Nachtigall
Tönt aus den wonnigen Junitagen
Uns in der Seele der Wiederhall.
Gingen alle zu Grab, die uns teuer –
Von der Liebe, die wir geliebt,
Ewig erfüllt uns das wärmende Feuer,
Ob auch das Leben zu Asche zerstiebt!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
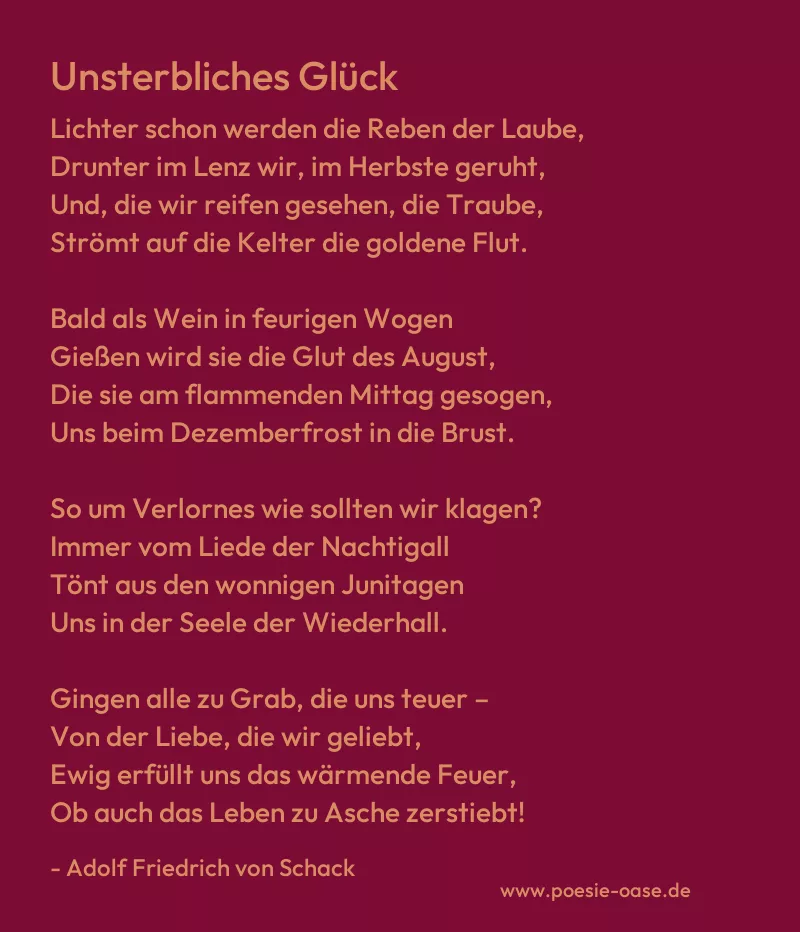
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Unsterbliches Glück“ von Adolf Friedrich von Schack thematisiert die ewige Kraft der Liebe und des Glücks, die über den Tod hinaus Bestand hat. Zu Beginn beschreibt der Sprecher den Zyklus der Natur, der von der Rebe und der Traube symbolisiert wird. Die „goldene Flut“, die auf die Kelter strömt, steht für die Früchte des Lebens, die im Sommer und Herbst gereift sind und nun in den Wein überführt werden. Dieser Prozess von Wachstum und Reifung ist eng mit den Zyklen der Natur und des menschlichen Lebens verbunden, was die Vergänglichkeit und das stetige Weitergehen des Lebens betont.
Die zweite Strophe vertieft dieses Bild, indem der Wein als Symbol für die Emotionen und Erfahrungen des Lebens genutzt wird. Die „feurigen Wogen“ des Weins, die „die Glut des August“ und „uns in die Brust“ strömen, stellen die intensiven, leidenschaftlichen Momente dar, die im Sommer und in der Jugend gesammelt werden. Auch der winterliche „Dezemberfrost“ ist Teil des Zyklus, was den Wechsel der Jahreszeiten und damit auch das Altern und die Vergänglichkeit des Lebens widerspiegelt. Dennoch bleibt der Wein als Symbol für das Leben und seine Energie lebendig und kraftvoll, auch wenn die äußeren Umstände sich verändern.
Im dritten Abschnitt ruft der Sprecher dazu auf, nicht über das „Verlornes“ zu klagen, sondern die ewige Kraft des „Liedes der Nachtigall“ und den „Wiederhall“ der „Junitagen“ zu hören. Dies verweist auf die Idee, dass selbst die vergänglichen Dinge – wie die schönen Sommermonate und die Liebe – in der Erinnerung und im Lied weiterleben. Die „Nachtigall“ symbolisiert hier den fortwährenden Klang der Liebe und Freude, der trotz der Vergänglichkeit des Lebens immer wiederkehrt. Die Freude an der Liebe wird als ein bleibendes Erbe beschrieben, das auch die dunkleren Zeiten überdauert.
Die letzte Strophe bringt die zentrale Botschaft des Gedichts auf den Punkt: Auch wenn die Menschen, die uns lieb und teuer sind, „zu Grab“ gehen, wird uns die „Liebe“, die wir erlebt haben, weiterhin „wärmend“ begleiten. Es ist ein Aufruf, die Liebe als ein unsterbliches Gut zu verstehen, das selbst die Zerstörung des physischen Lebens überdauert. Die Vorstellung, dass „das Leben zu Asche zerstiebt“, wird in der Liebe, die „uns ewig erfüllt“, übertroffen. So wird die Liebe im Gedicht als ein ewiges, unzerstörbares Glück dargestellt, das über den Tod hinaus besteht und die Menschen in ihren Erinnerungen und in ihrem inneren Leben weiterträgt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.