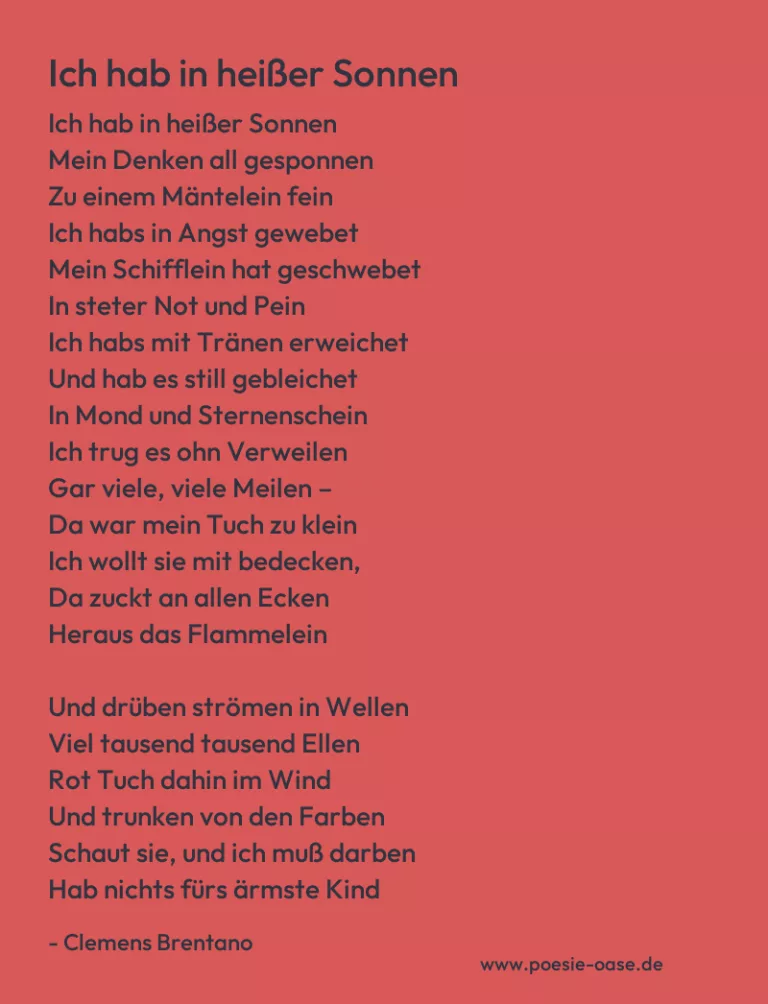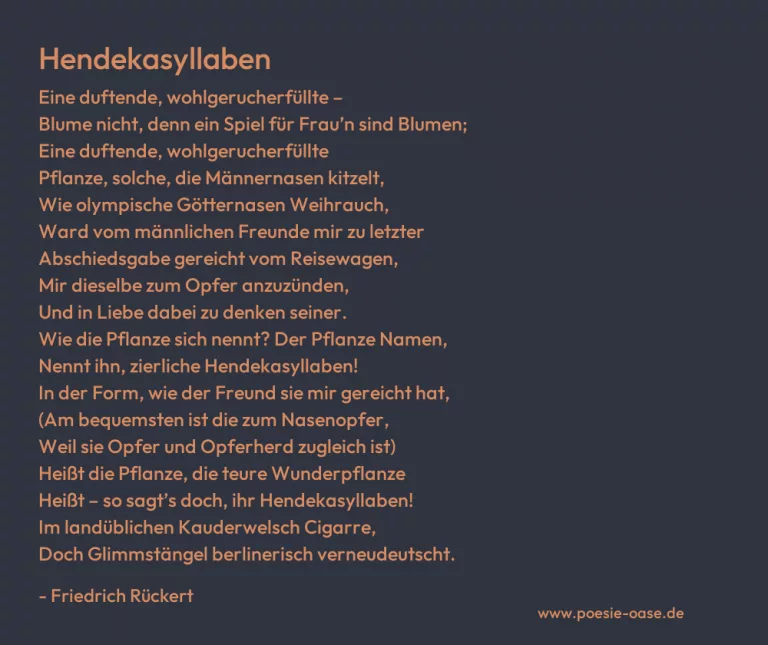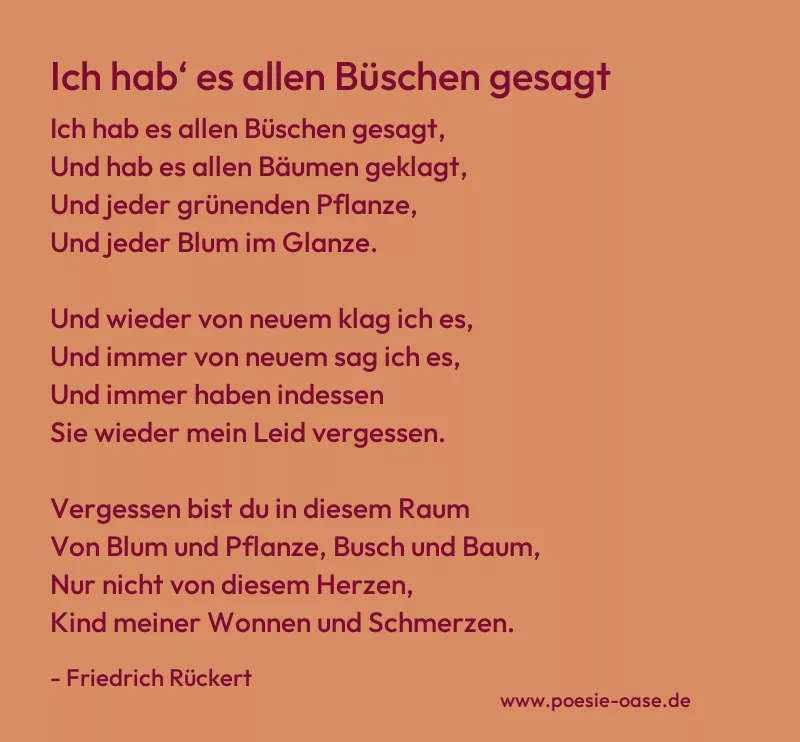Ich hab‘ es allen Büschen gesagt
Ich hab es allen Büschen gesagt,
Und hab es allen Bäumen geklagt,
Und jeder grünenden Pflanze,
Und jeder Blum im Glanze.
Und wieder von neuem klag ich es,
Und immer von neuem sag ich es,
Und immer haben indessen
Sie wieder mein Leid vergessen.
Vergessen bist du in diesem Raum
Von Blum und Pflanze, Busch und Baum,
Nur nicht von diesem Herzen,
Kind meiner Wonnen und Schmerzen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
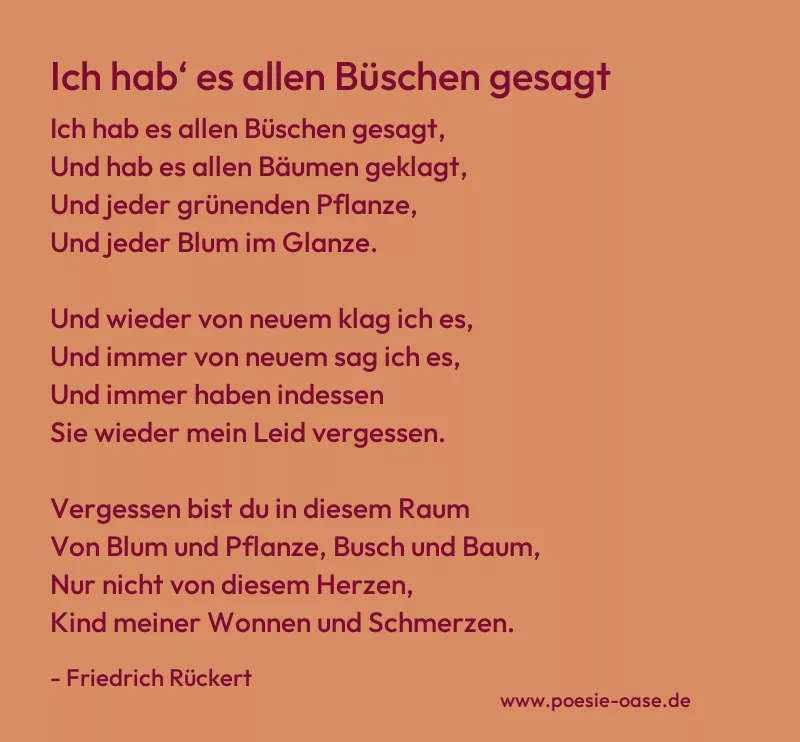
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich hab‘ es allen Büschen gesagt“ von Friedrich Rückert beschreibt eine tiefe, persönliche Klage über Verlust und bleibende Liebe. Zu Beginn offenbart der Sprecher seine Verzweiflung: Er hat seine Trauer der ganzen Natur anvertraut – den Büschen, Bäumen, Pflanzen und Blumen. Diese Hinwendung zur Natur verdeutlicht die Einsamkeit und das Bedürfnis, das eigene Leid mitzuteilen, selbst wenn es keine menschlichen Zuhörer gibt.
Im zweiten Teil des Gedichts wird der Schmerz noch verstärkt: Obwohl der Sprecher seine Klage immer wieder wiederholt, vergessen die Pflanzen und Bäume sein Leid. Diese Vergänglichkeit der Natur steht im Kontrast zur Unvergänglichkeit des inneren Schmerzes. Die Natur wird gleichgültig dargestellt – sie hört zwar, doch bewahrt sie nichts davon.
Am Ende richtet sich der Blick des Sprechers direkt auf die geliebte Person, das „Kind meiner Wonnen und Schmerzen“. Trotz aller Vergänglichkeit bleibt diese Person im Herzen lebendig und unvergessen. Die Liebe und der Schmerz, die mit ihr verbunden sind, haben einen festen, unerschütterlichen Platz im Inneren des Sprechers, ganz im Gegensatz zur vergänglichen, gleichgültigen Natur.
Rückert bringt in einfacher, aber eindringlicher Sprache das tiefe Bedürfnis nach Erinnerung und innerer Verbundenheit zum Ausdruck. Das Gedicht zeigt die Kluft zwischen der gleichgültigen Außenwelt und der intensiven, unverlierbaren inneren Liebe.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.