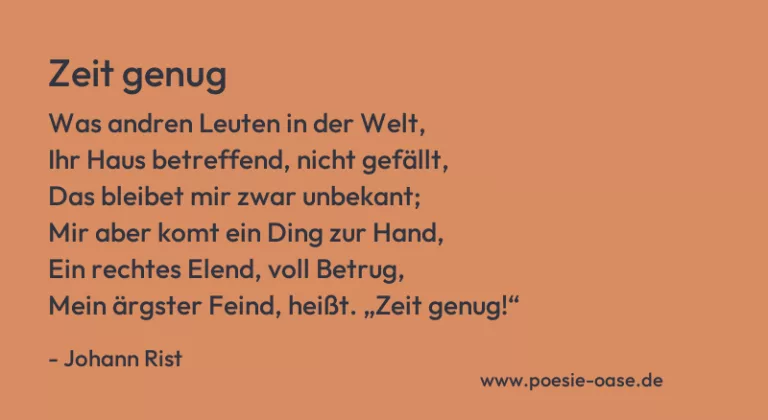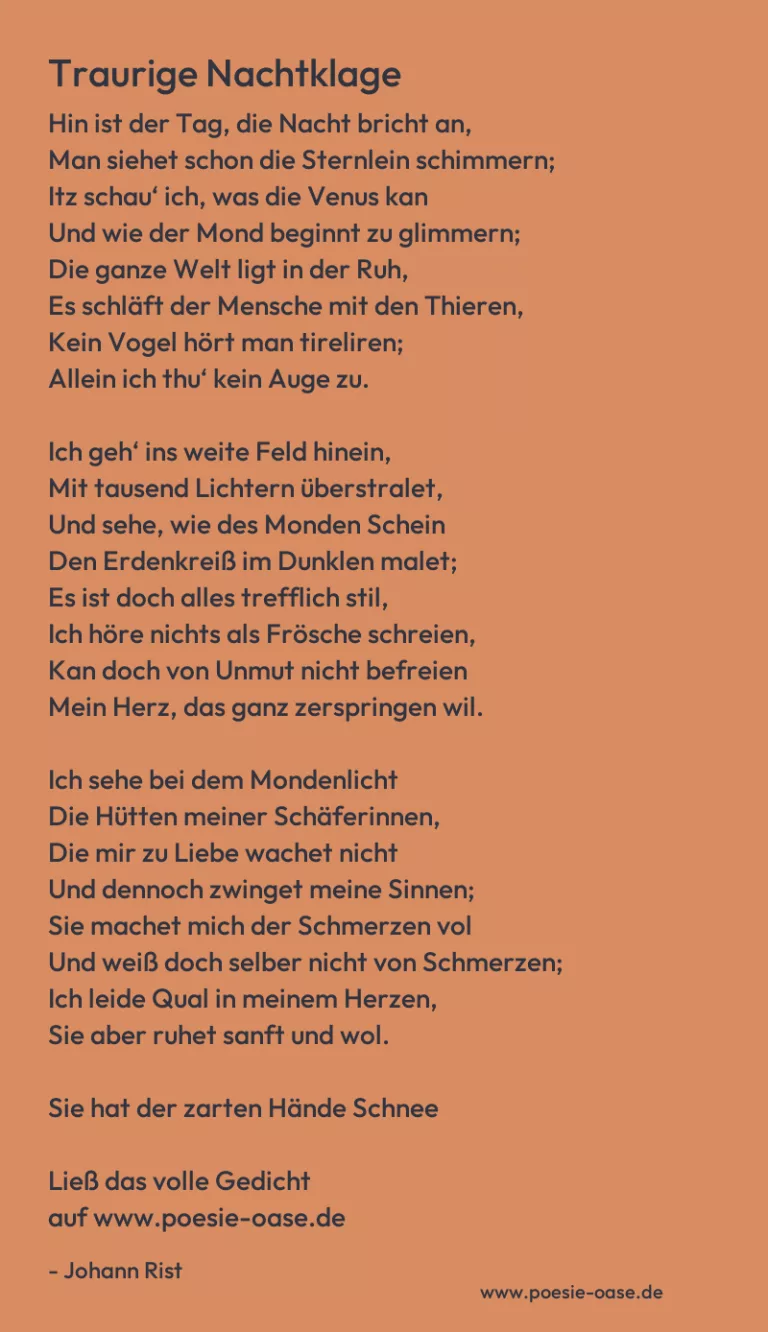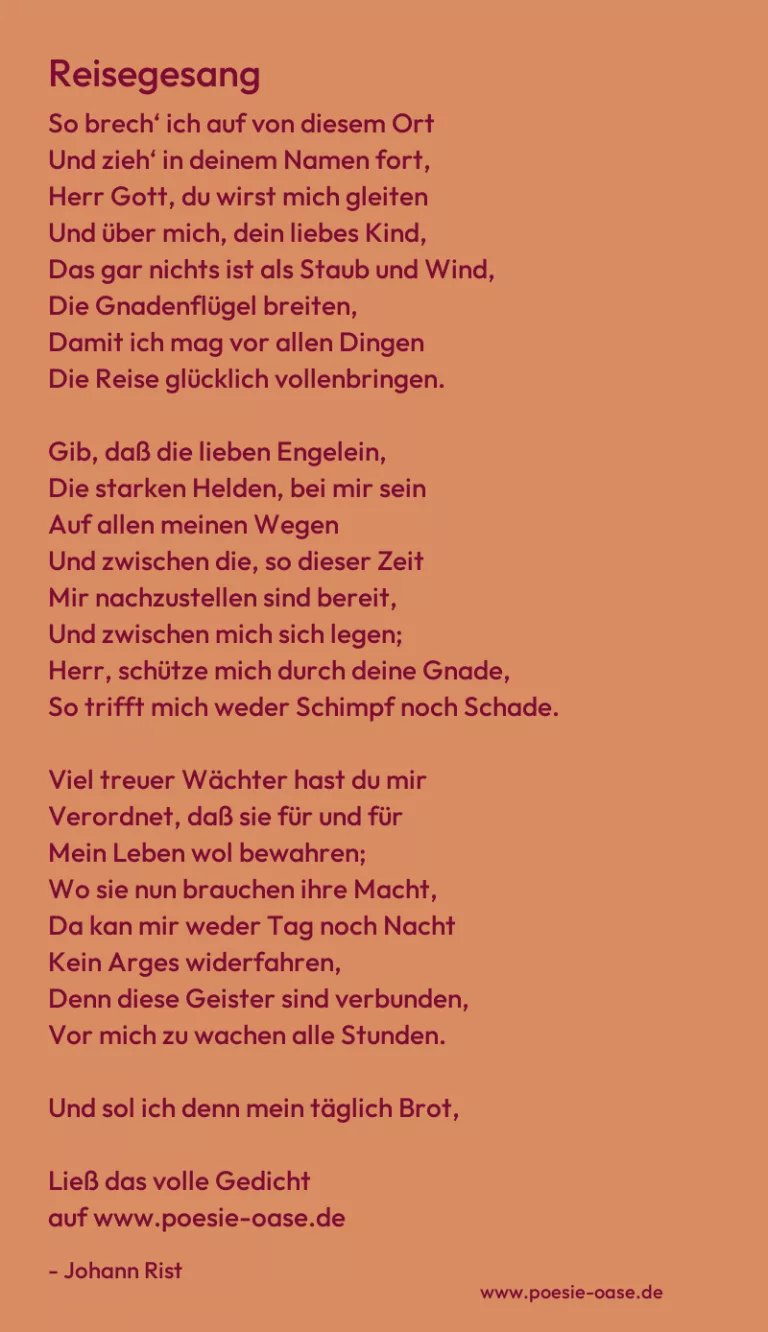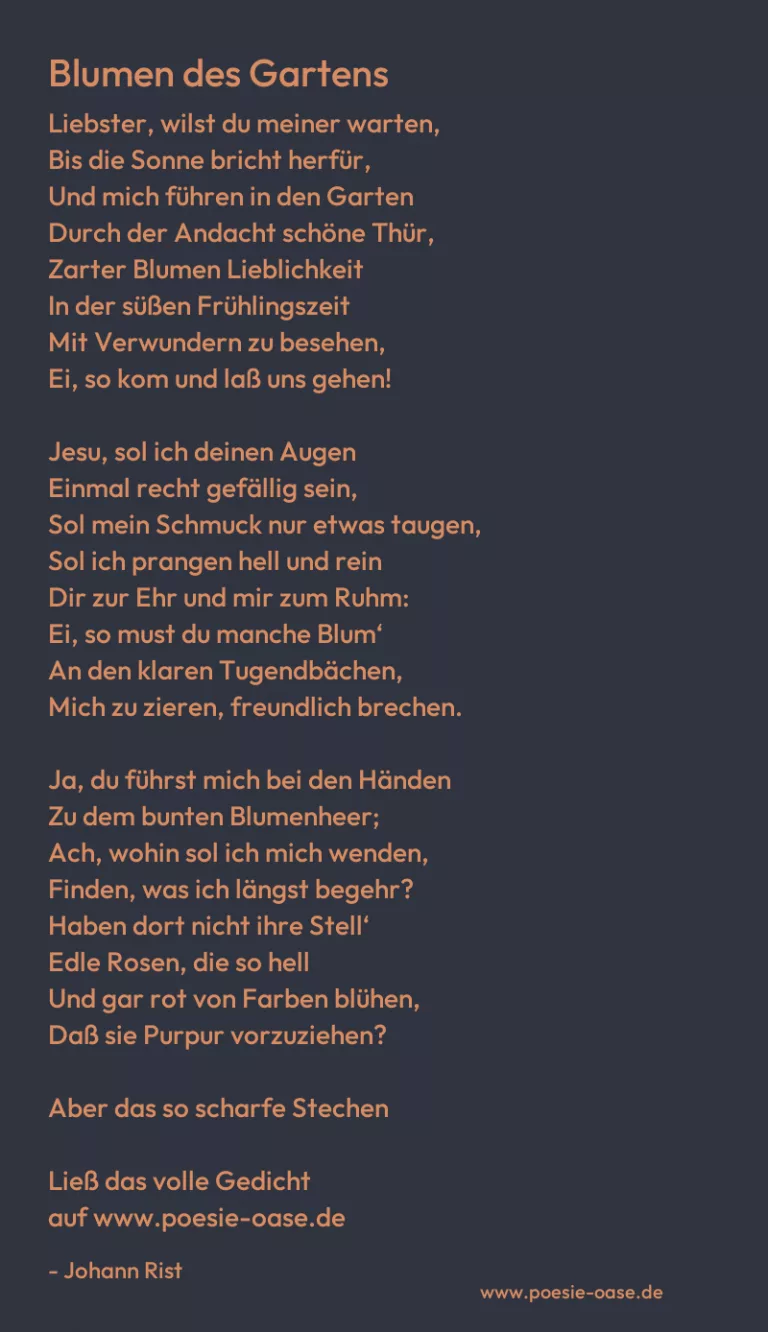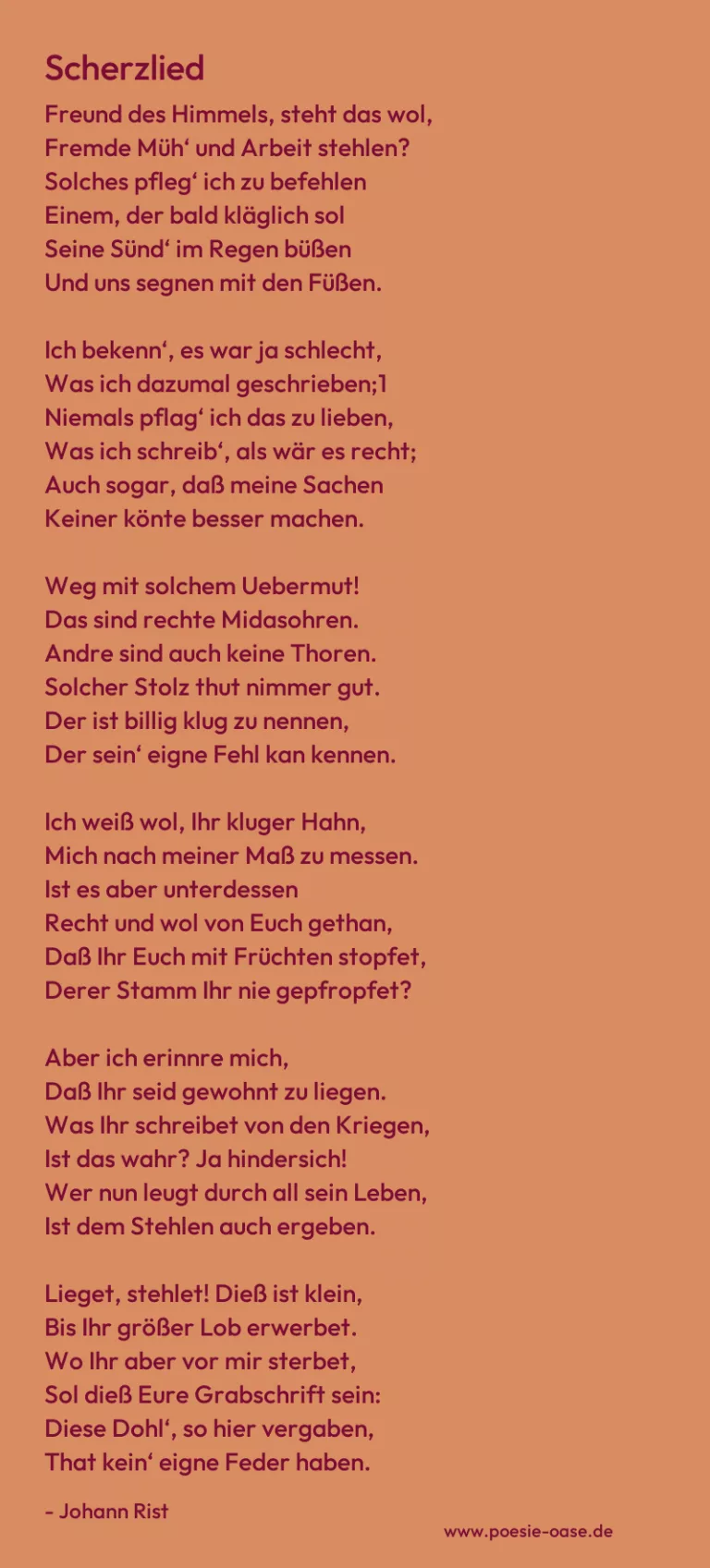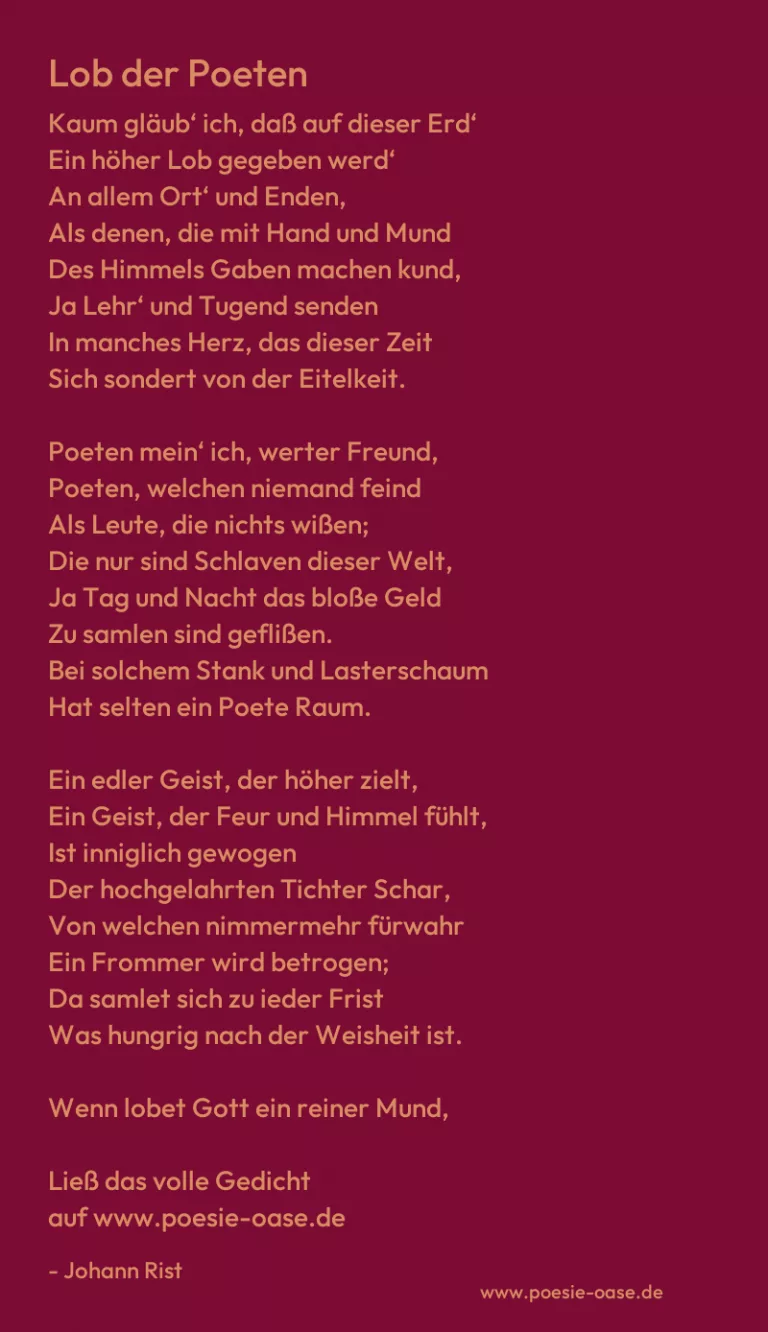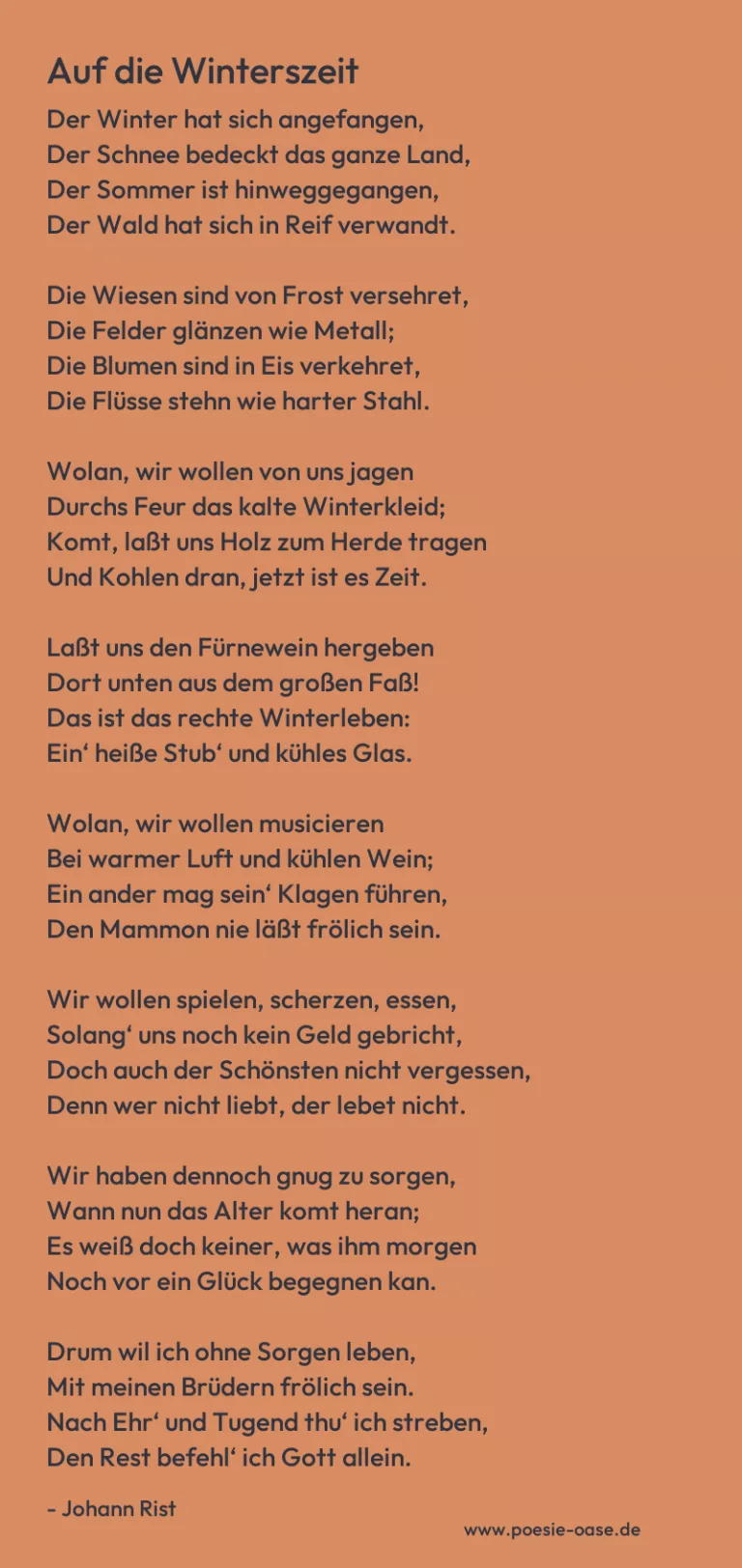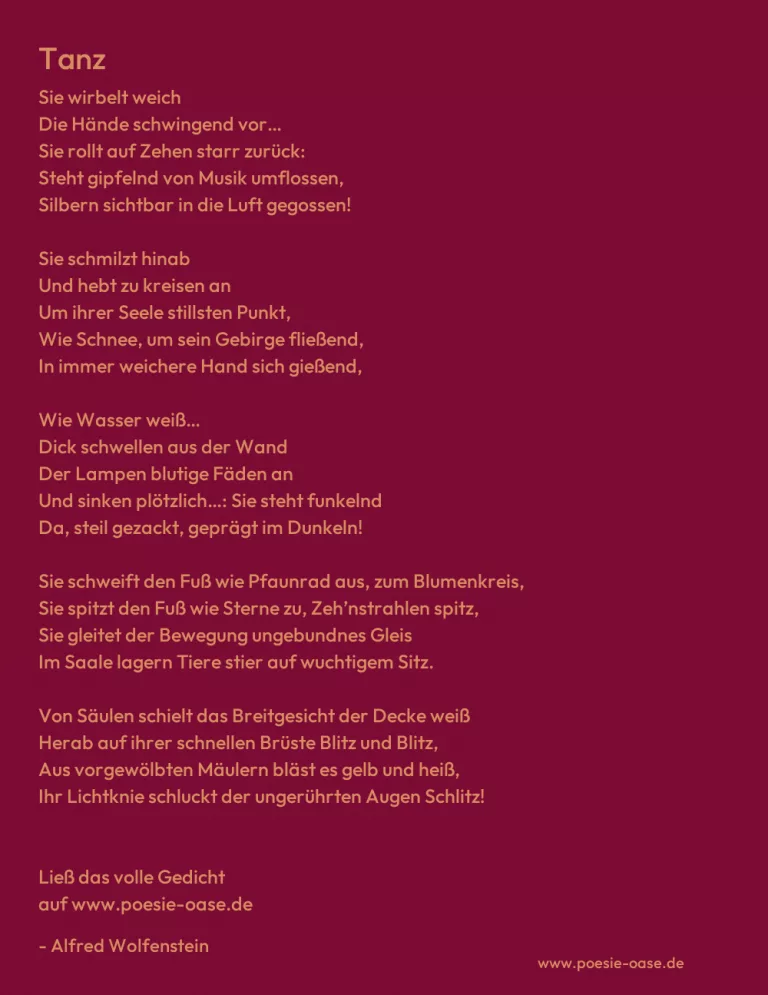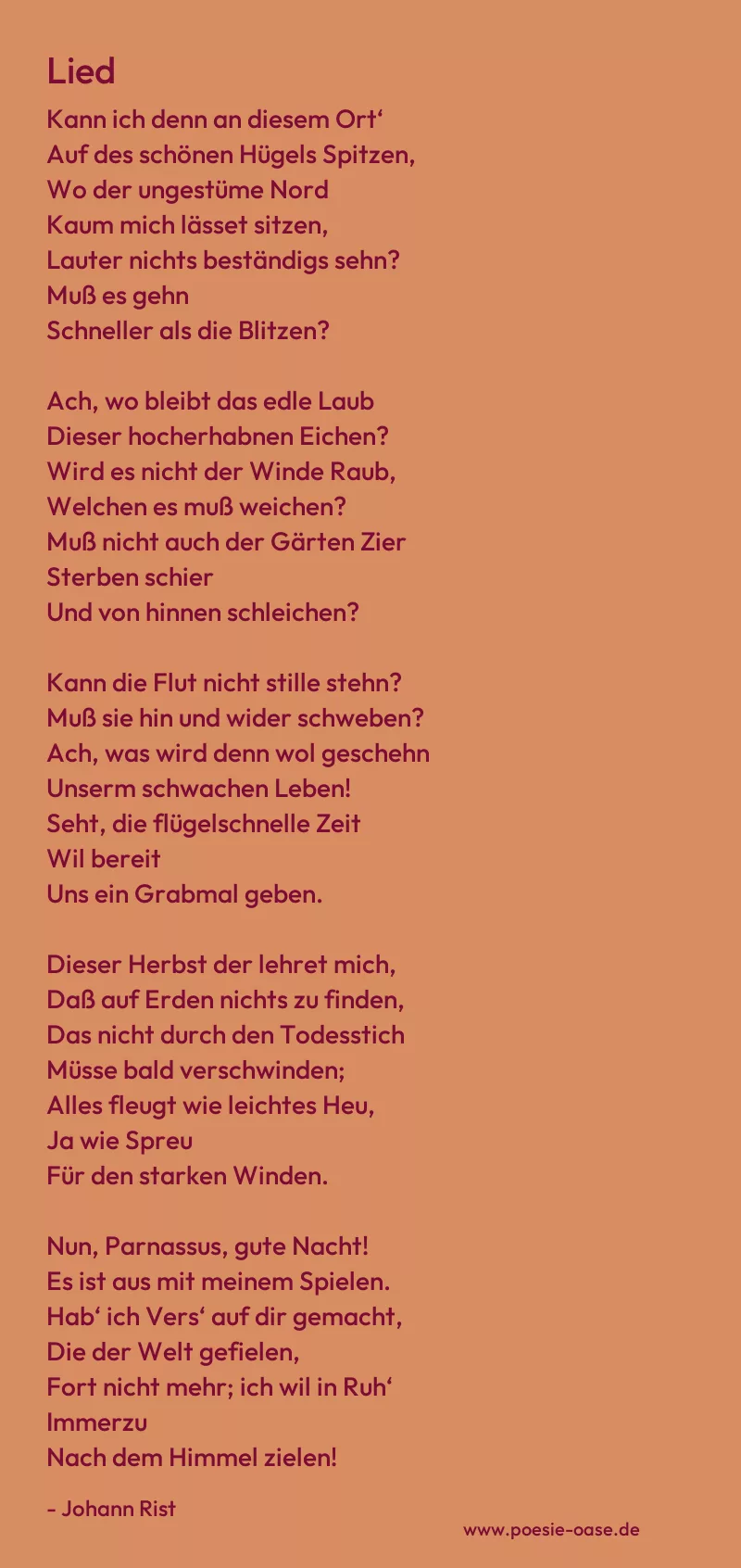Kann ich denn an diesem Ort‘
Auf des schönen Hügels Spitzen,
Wo der ungestüme Nord
Kaum mich lässet sitzen,
Lauter nichts beständigs sehn?
Muß es gehn
Schneller als die Blitzen?
Ach, wo bleibt das edle Laub
Dieser hocherhabnen Eichen?
Wird es nicht der Winde Raub,
Welchen es muß weichen?
Muß nicht auch der Gärten Zier
Sterben schier
Und von hinnen schleichen?
Kann die Flut nicht stille stehn?
Muß sie hin und wider schweben?
Ach, was wird denn wol geschehn
Unserm schwachen Leben!
Seht, die flügelschnelle Zeit
Wil bereit
Uns ein Grabmal geben.
Dieser Herbst der lehret mich,
Daß auf Erden nichts zu finden,
Das nicht durch den Todesstich
Müsse bald verschwinden;
Alles fleugt wie leichtes Heu,
Ja wie Spreu
Für den starken Winden.
Nun, Parnassus, gute Nacht!
Es ist aus mit meinem Spielen.
Hab‘ ich Vers‘ auf dir gemacht,
Die der Welt gefielen,
Fort nicht mehr; ich wil in Ruh‘
Immerzu
Nach dem Himmel zielen!