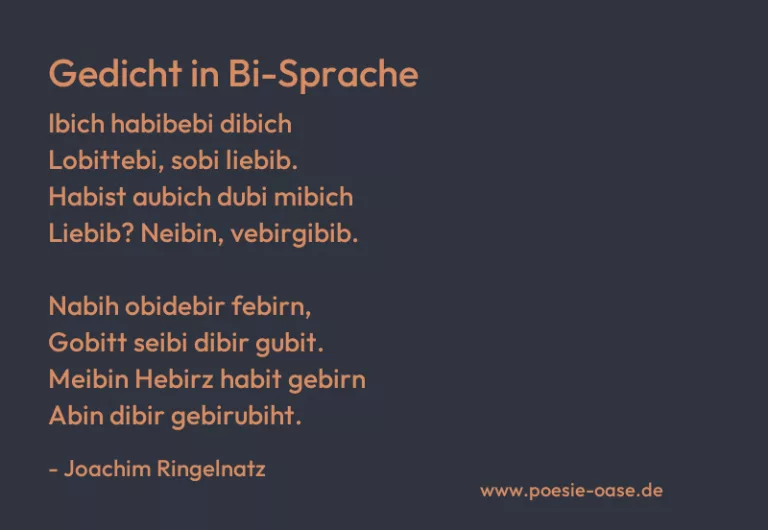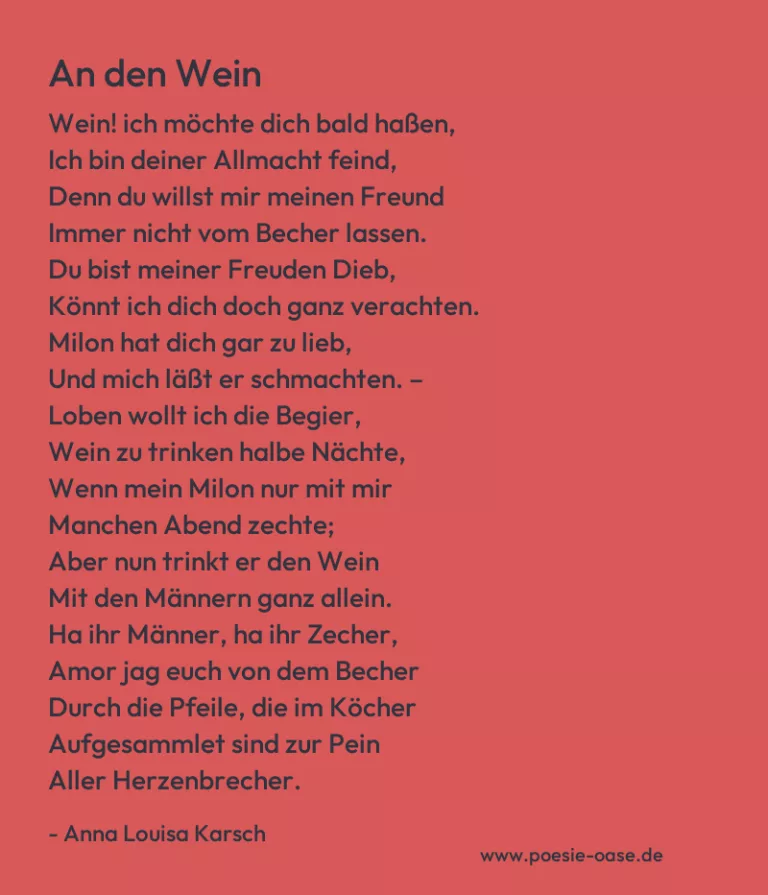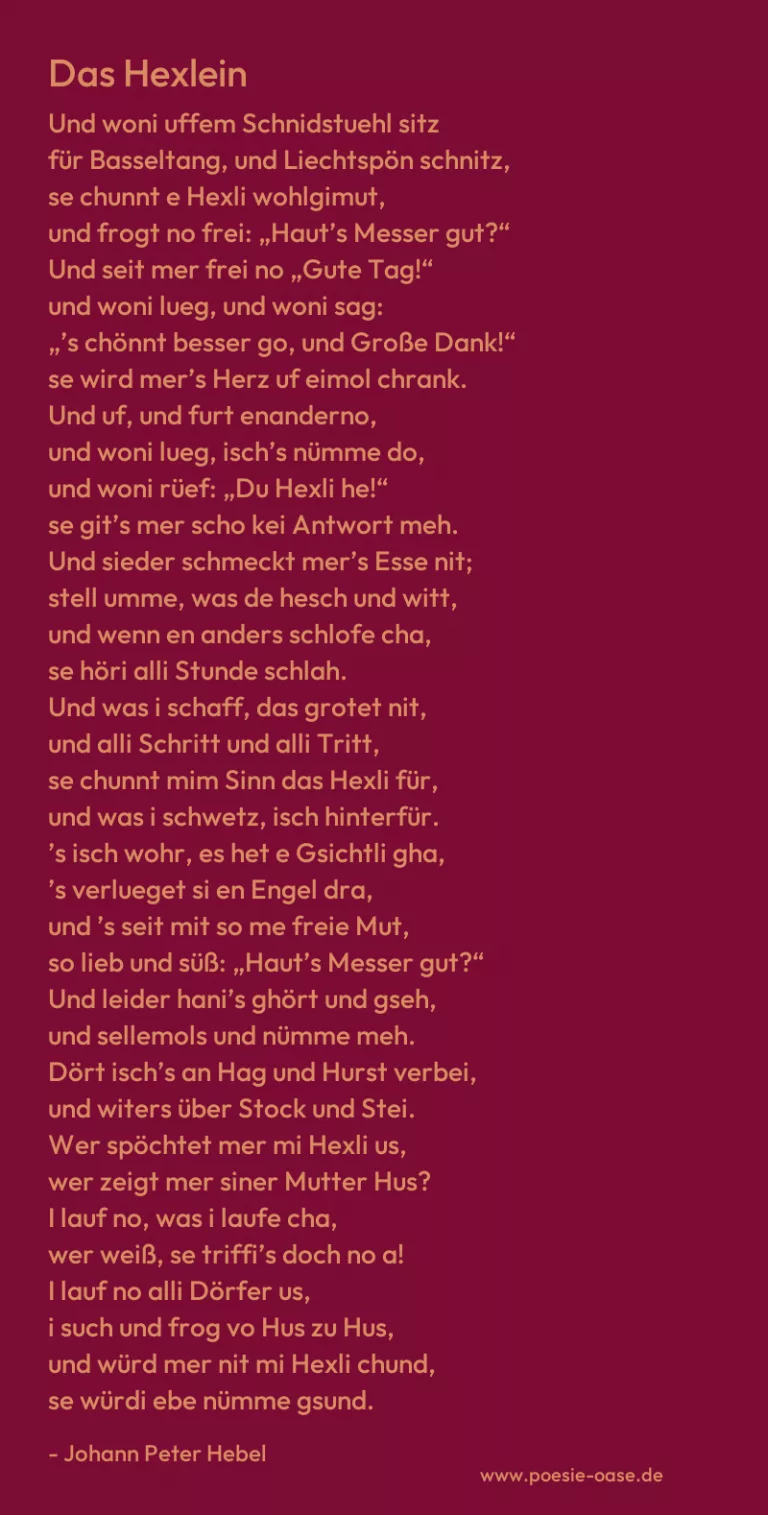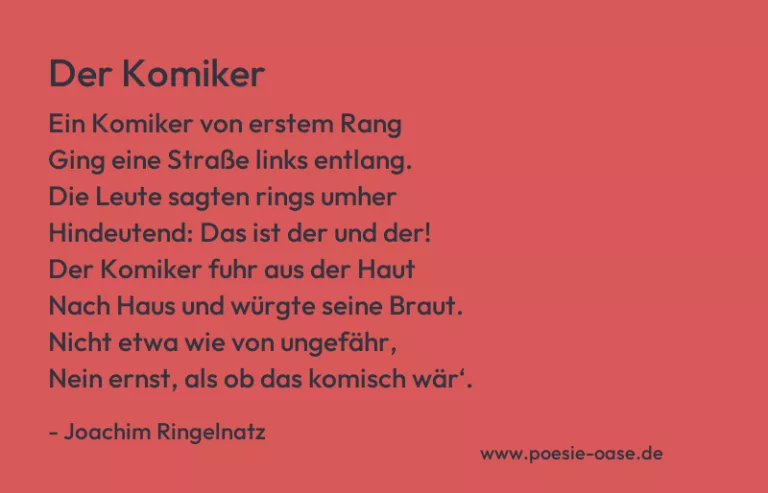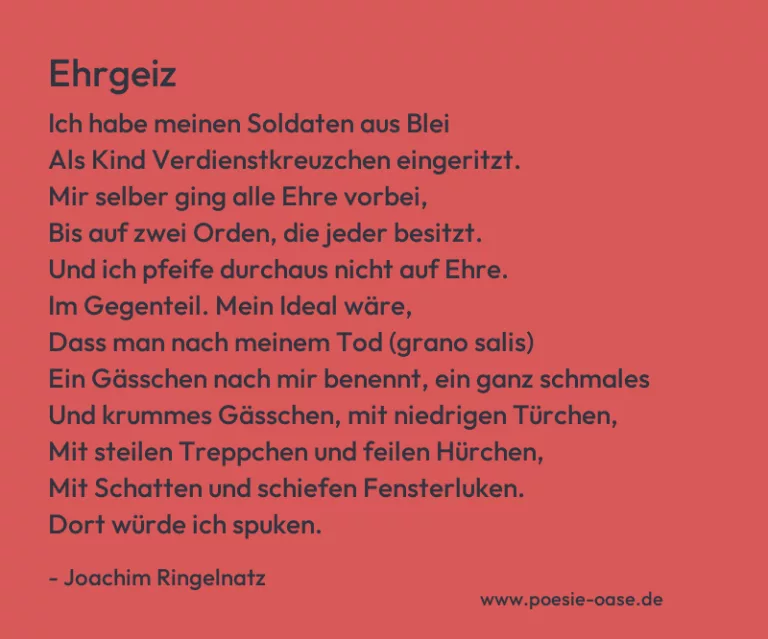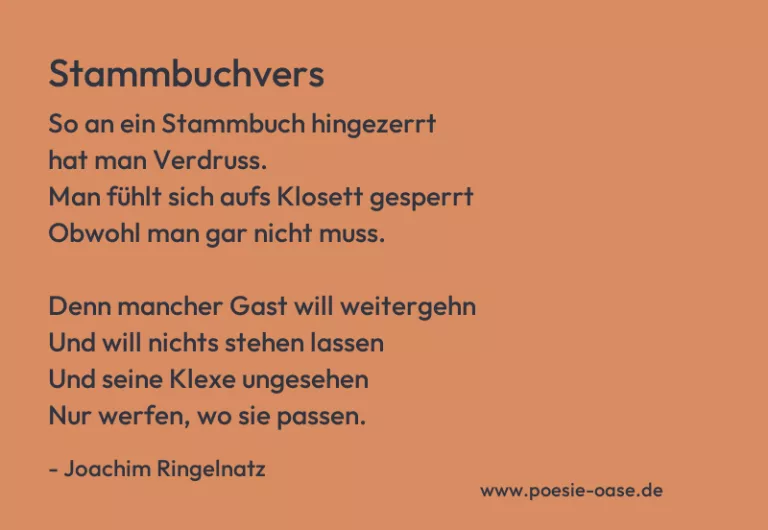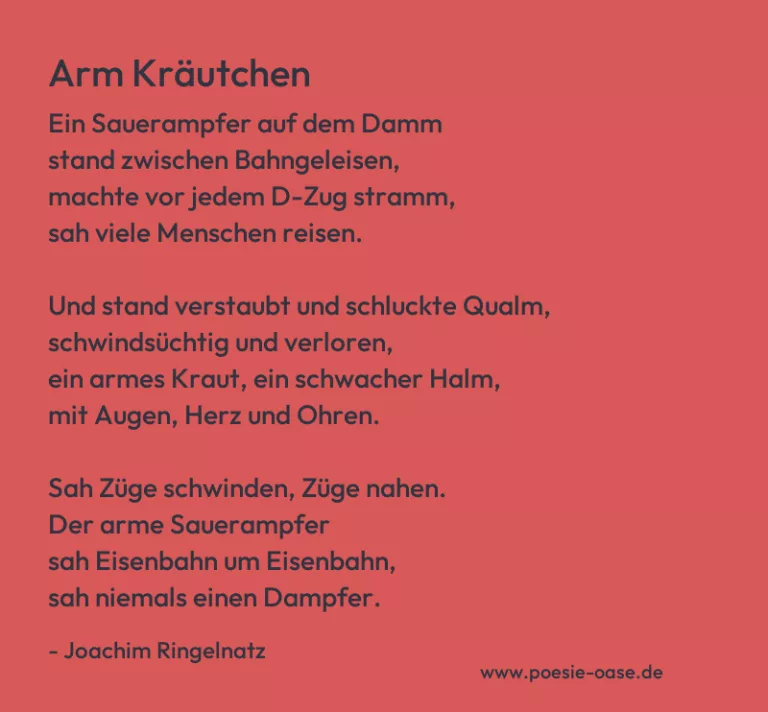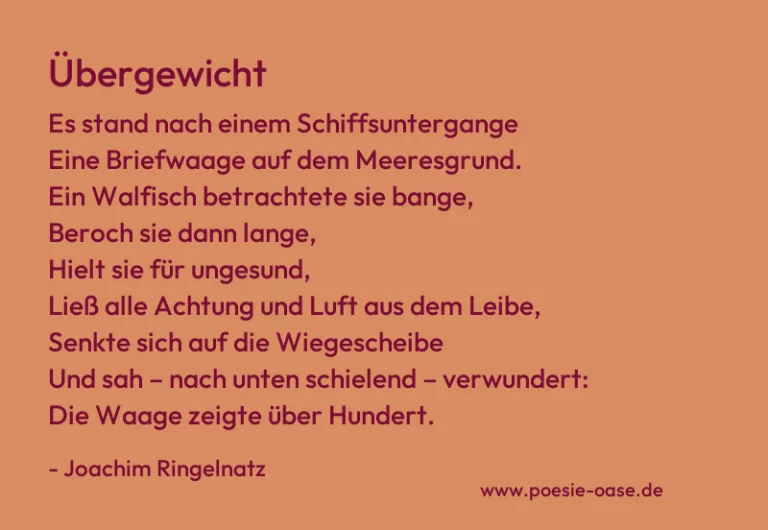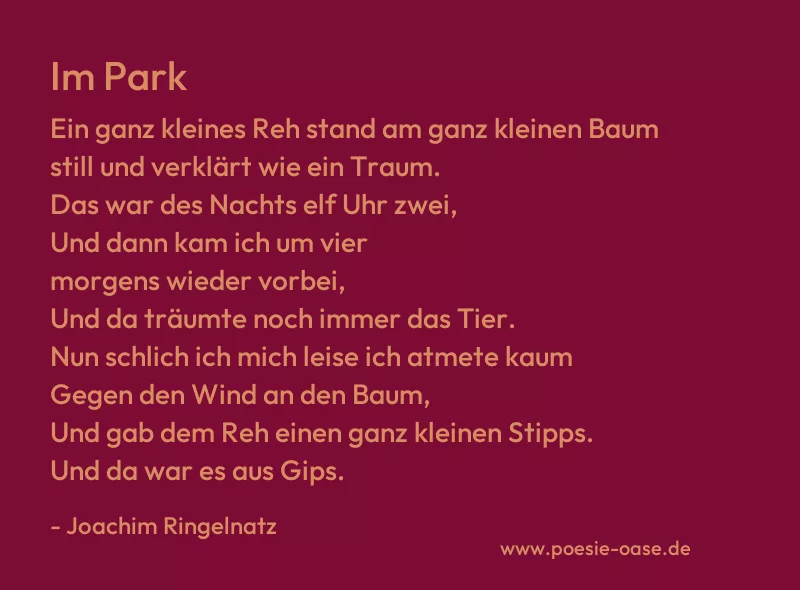Im Park
Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum
still und verklärt wie ein Traum.
Das war des Nachts elf Uhr zwei,
Und dann kam ich um vier
morgens wieder vorbei,
Und da träumte noch immer das Tier.
Nun schlich ich mich leise ich atmete kaum
Gegen den Wind an den Baum,
Und gab dem Reh einen ganz kleinen Stipps.
Und da war es aus Gips.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
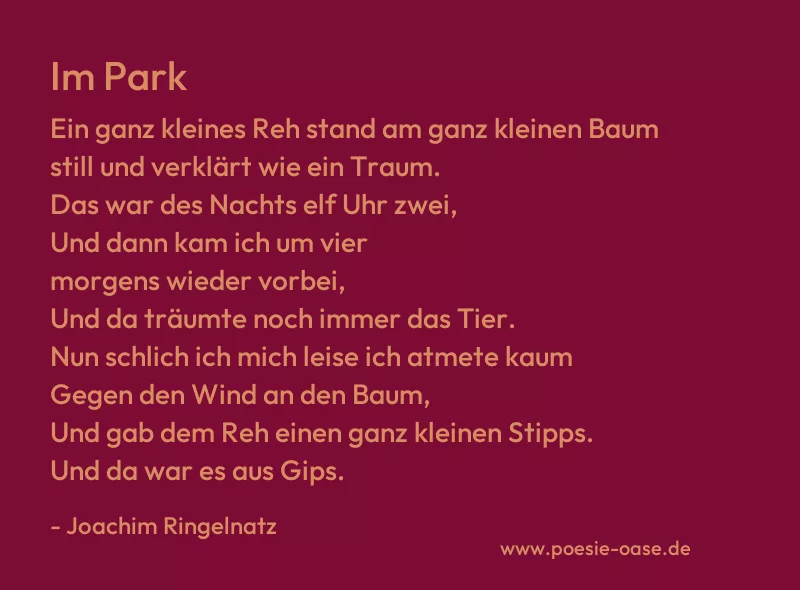
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Im Park“ von Joachim Ringelnatz spielt auf charmante Weise mit der Wahrnehmung und den Erwartungen des lyrischen Ichs. Zunächst wird eine zarte, fast märchenhafte Szene beschrieben: Ein kleines Reh steht in der Nacht still am Baum, als wäre es Teil eines wunderschönen Traums. Die Atmosphäre wirkt magisch und entrückt.
Die Zeit scheint stillzustehen, denn auch Stunden später steht das Tier noch immer regungslos an derselben Stelle. Diese anhaltende Starre weckt beim Sprecher den Wunsch, der Szene näherzukommen und das Wunder zu berühren. Die Spannung wird durch die langsame, vorsichtige Annäherung intensiviert – jede Bewegung wird zur großen Geste, jedes Atemholen zum bewussten Akt.
Die Pointe kommt abrupt und entzaubernd: Das vermeintlich lebendige, traumverlorene Reh entpuppt sich als Gipsfigur. Mit einem kleinen „Stipps“ wird die Illusion zerstört. Ringelnatz setzt damit einen überraschenden, humorvollen Bruch in die zuvor zärtlich aufgebaute Traumstimmung und spielt auf die Diskrepanz zwischen Wunschvorstellung und Wirklichkeit an.
Das Gedicht lebt von seiner leichten, rhythmischen Sprache und der gelungenen Mischung aus Romantik und augenzwinkernder Ironie. Es zeigt, wie menschliche Fantasie die Wirklichkeit verklären kann – und wie schnell diese Verklärung durch einen kleinen Stoß der Realität zum Einsturz gebracht wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.