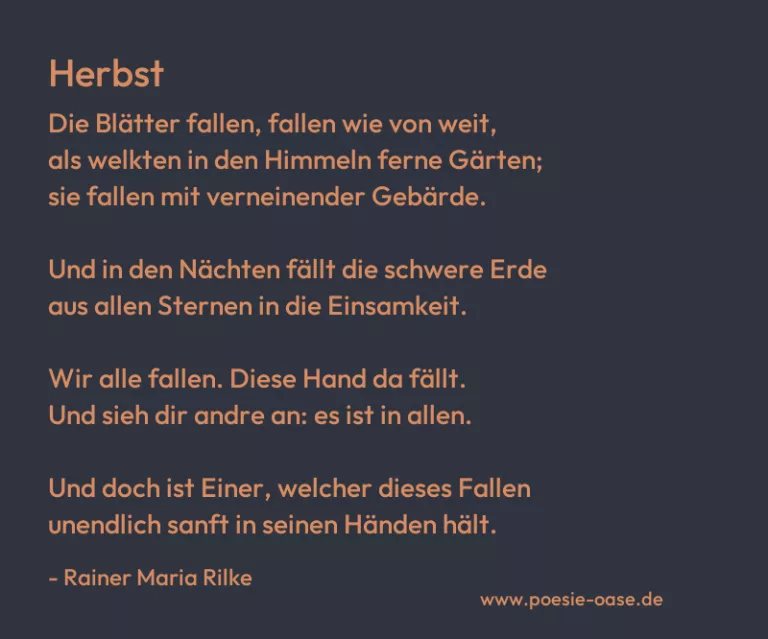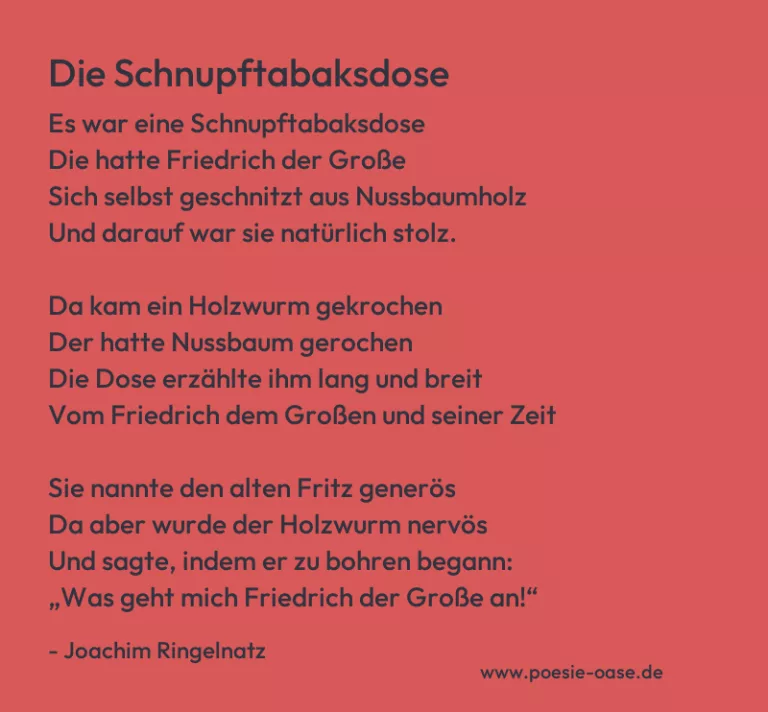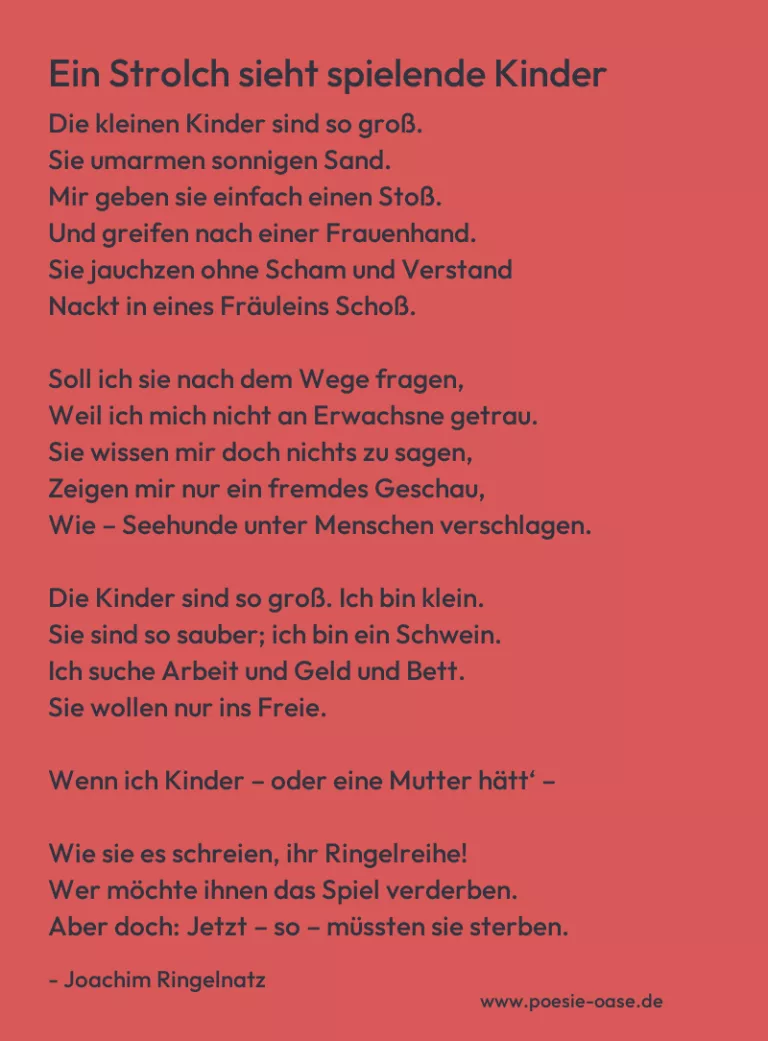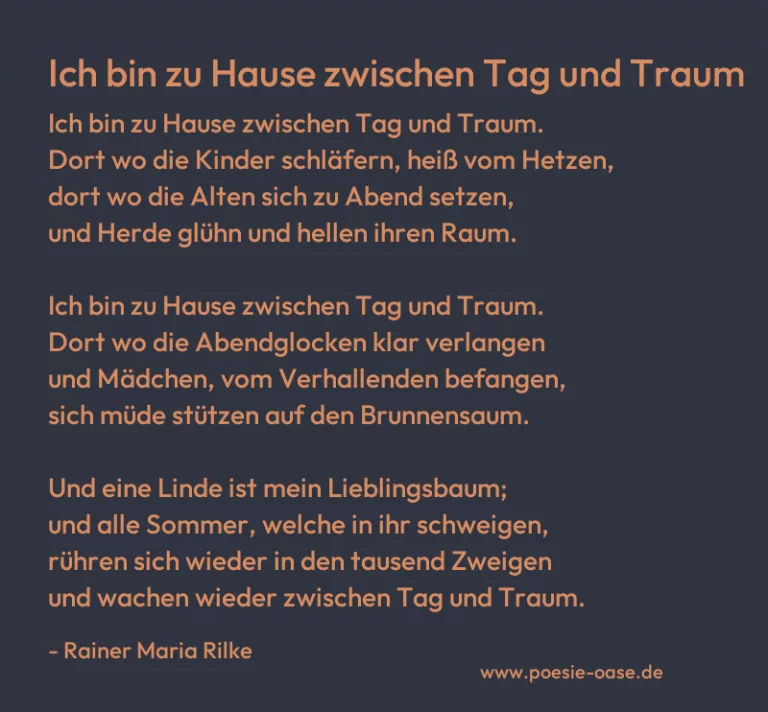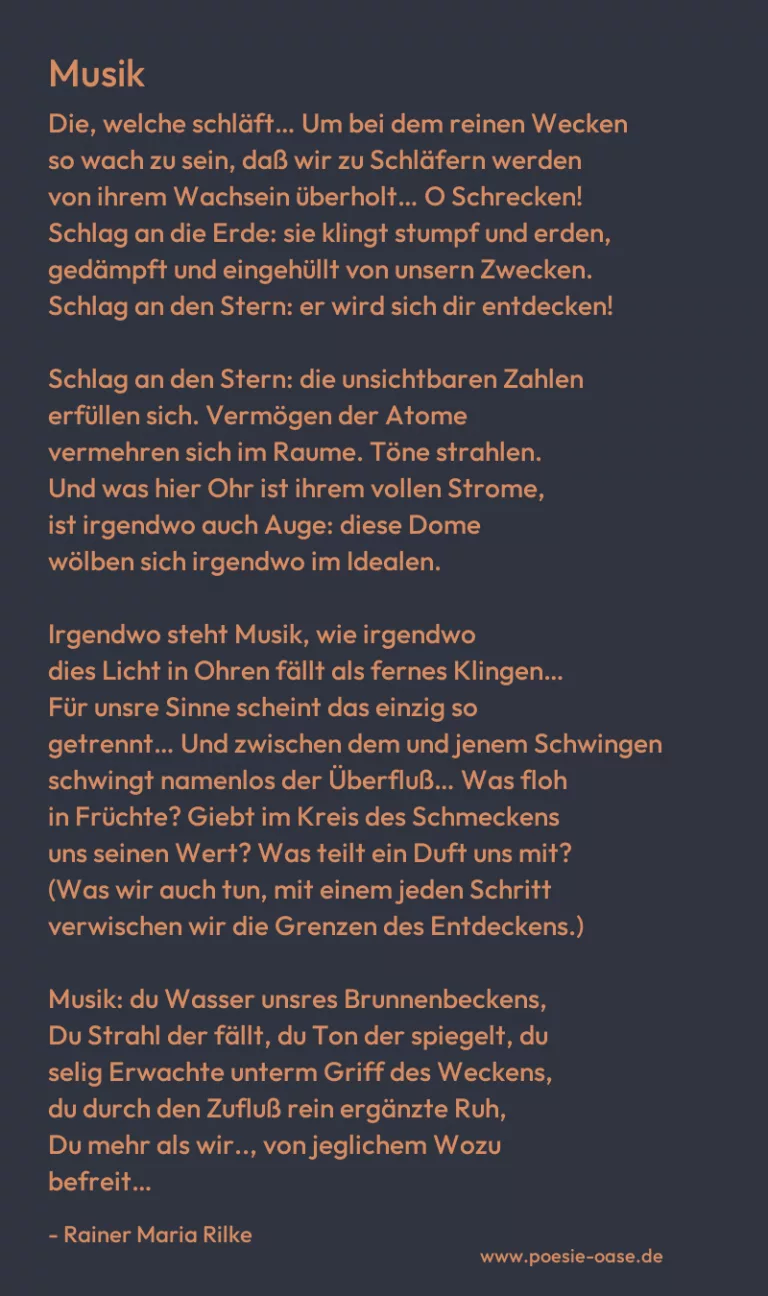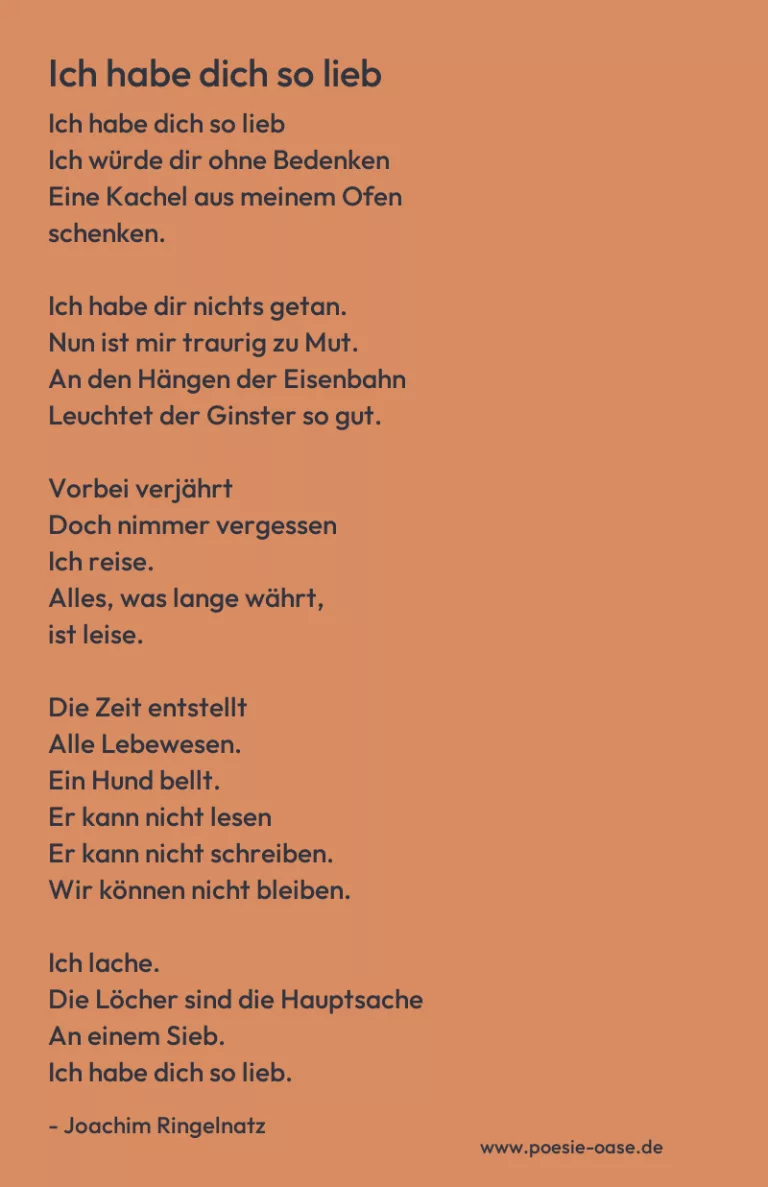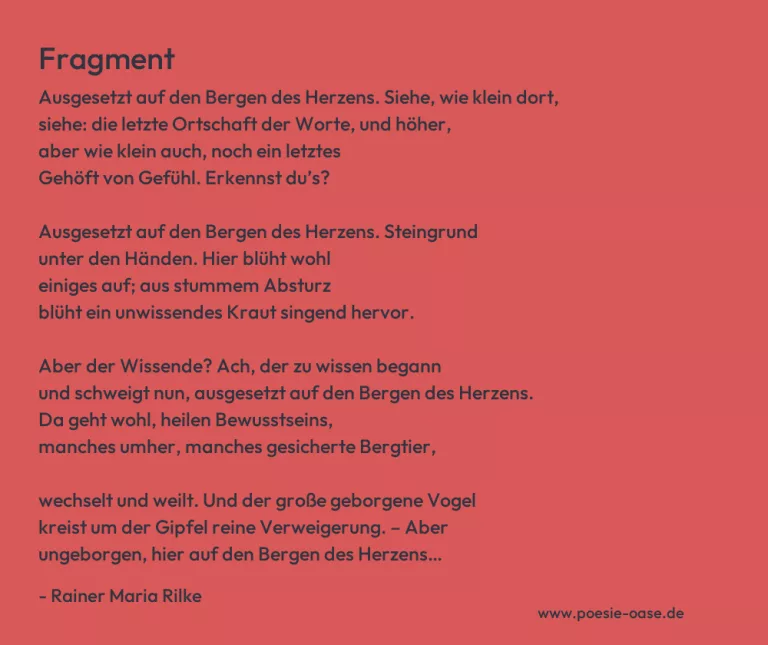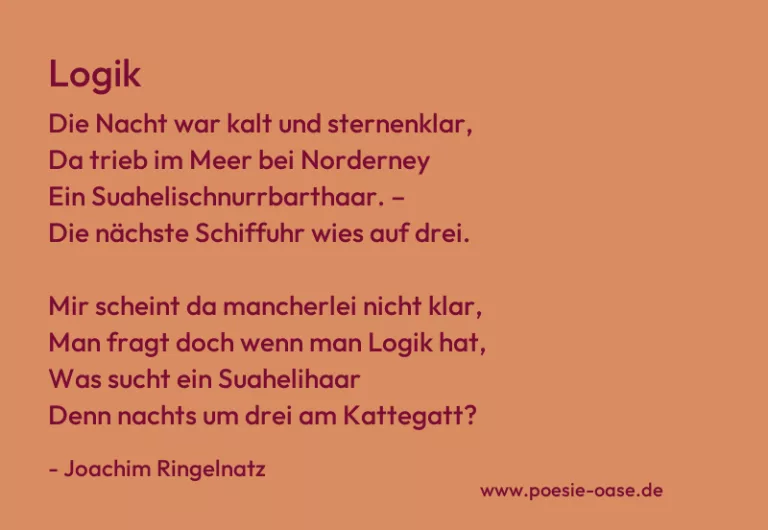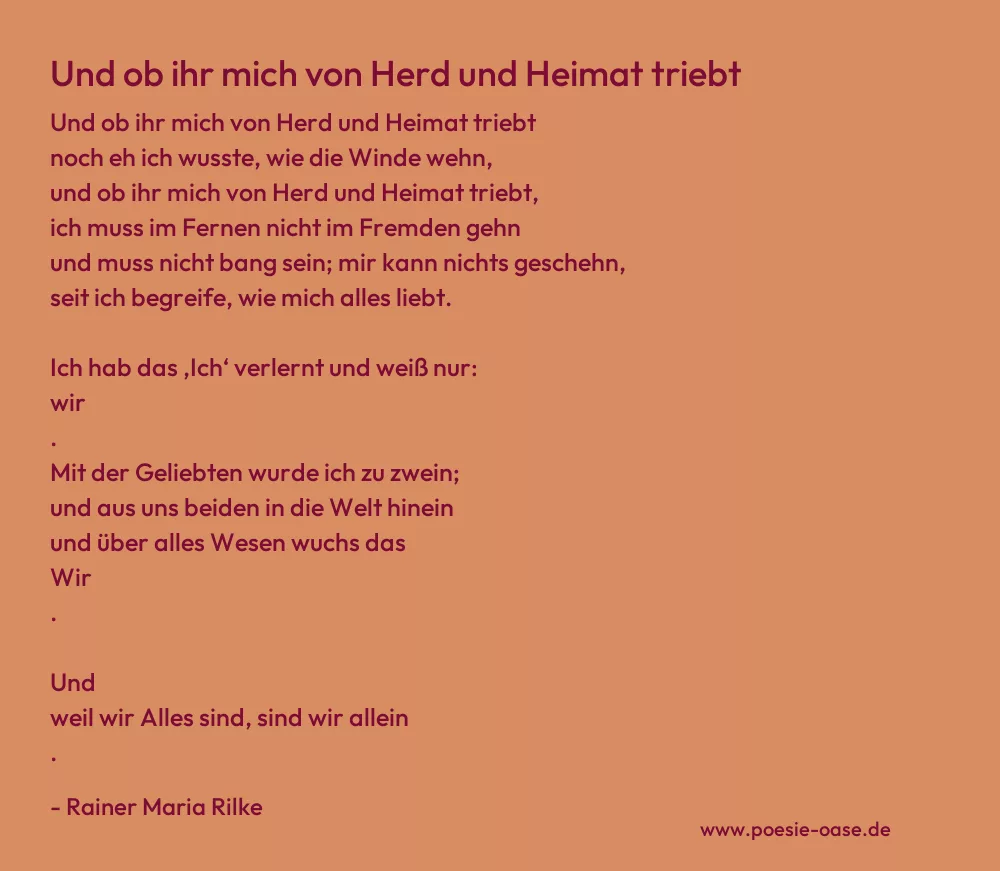Und ob ihr mich von Herd und Heimat triebt
Und ob ihr mich von Herd und Heimat triebt
noch eh ich wusste, wie die Winde wehn,
und ob ihr mich von Herd und Heimat triebt,
ich muss im Fernen nicht im Fremden gehn
und muss nicht bang sein; mir kann nichts geschehn,
seit ich begreife, wie mich alles liebt.
Ich hab das ‚Ich‘ verlernt und weiß nur:
wir
.
Mit der Geliebten wurde ich zu zwein;
und aus uns beiden in die Welt hinein
und über alles Wesen wuchs das
Wir
.
Und
weil wir Alles sind, sind wir allein
.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
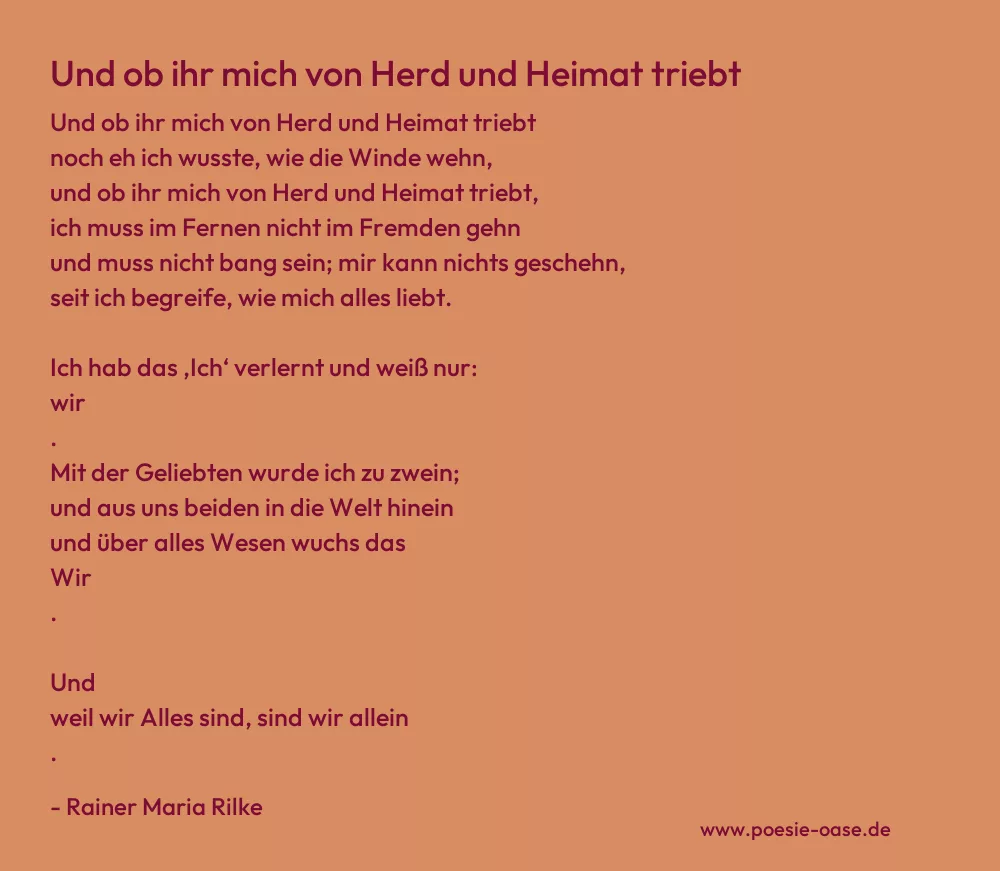
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Und ob ihr mich von Herd und Heimat triebt“ von Rainer Maria Rilke thematisiert die innere Reise und das Streben nach einem höheren, transzendentalen Verständnis von Zugehörigkeit und Identität. Der Sprecher reflektiert darüber, dass er nicht von „Herd und Heimat“ abhängig ist, um zu leben oder zu existieren. Diese Zeilen eröffnen das Bild einer Person, die aus ihrer ursprünglichen Bindung an Ort und Heimat befreit wird, bevor sie überhaupt die „Winde“ der Welt verstanden hat. Der Versuch, ihn zu vertreiben, wird nicht als Verlust oder Bedrohung wahrgenommen, sondern als eine Art Befreiung, weil er in der Lage ist, „im Fernen“ zu leben, ohne sich im „Fremden“ zu verlieren. Dies ist ein Ausdruck der Unabhängigkeit des Ichs, das sich von traditionellen Bindungen oder Grenzen löst.
Im weiteren Verlauf des Gedichts entwickelt der Sprecher eine tiefere, nahezu mystische Erkenntnis: Er hat das „Ich“ verlernt und spricht nur noch im Plural, im „Wir“. Diese Wendung markiert eine spirituelle oder existenzielle Transformation, bei der das individuelle Ego überwunden wird. Der Sprecher fühlt sich nicht mehr als isoliertes Einzelwesen, sondern als Teil eines größeren Ganzen, das über das persönliche Selbst hinausgeht. Die Vereinigung mit der „Geliebten“ führt zu einem gemeinsamen „Wir“, das sich auf die gesamte Welt ausdehnt und sich mit allem Leben verbindet. Diese Verschmelzung von Ich und Du, die zu einem universellen „Wir“ führt, hebt den individuellen Egoismus auf und betont die Verbindung zwischen allen Wesen.
Die Zeile „Und weil wir Alles sind, sind wir allein“ enthält eine tiefgründige Paradoxie. Sie beschreibt die völlige Einheit des „Wir“, das in seiner Allumfassendheit zugleich auch eine gewisse Einsamkeit erfährt. Das „Alles“ zu sein, bedeutet, dass es keine Trennung mehr gibt, keine Abgrenzung zwischen dem Selbst und dem Anderen. Diese totalitäre Einheit führt jedoch paradoxerweise zu einer Art von Einsamkeit, da es keine Distanz oder Differenz mehr gibt, die das Individuum in seiner Existenz bekräftigen könnte. Die „Alleinheit“ ist hier keine Einsamkeit im herkömmlichen Sinne, sondern vielmehr eine existenzielle Erfahrung der völligen Auflösung des Ich in einem unendlichen „Wir“.
Rilke schafft in diesem Gedicht eine Verbindung zwischen der persönlichen, inneren Transformation des Individuums und einer universellen, spirituellen Erkenntnis. Der Sprecher erkennt, dass wahre Zugehörigkeit nicht durch äußere Herkunft oder geografische Bindungen bestimmt wird, sondern durch das Verständnis der tiefen Verbindung mit allem Leben. Die Überwindung des „Ich“ und die Entstehung eines „Wir“ führen zu einem Zustand der All-Einheit, der sowohl befreiend als auch paradoxerweise einsam ist. Es ist ein Gedicht über die spirituelle Suche nach einer tiefen, universellen Wahrheit und das Verstehen der eigenen Existenz als Teil eines größeren Ganzen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.