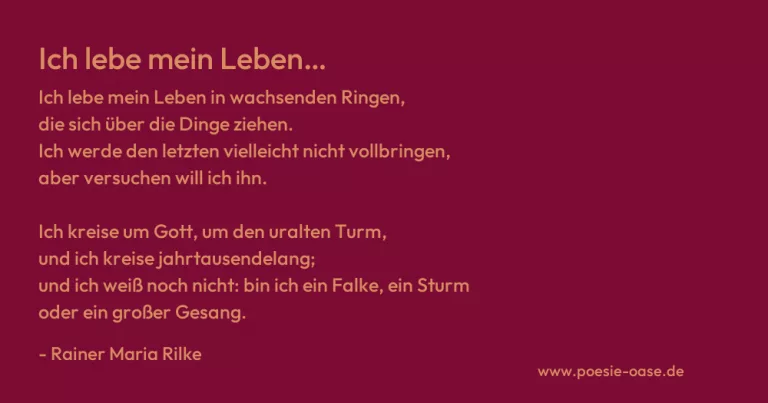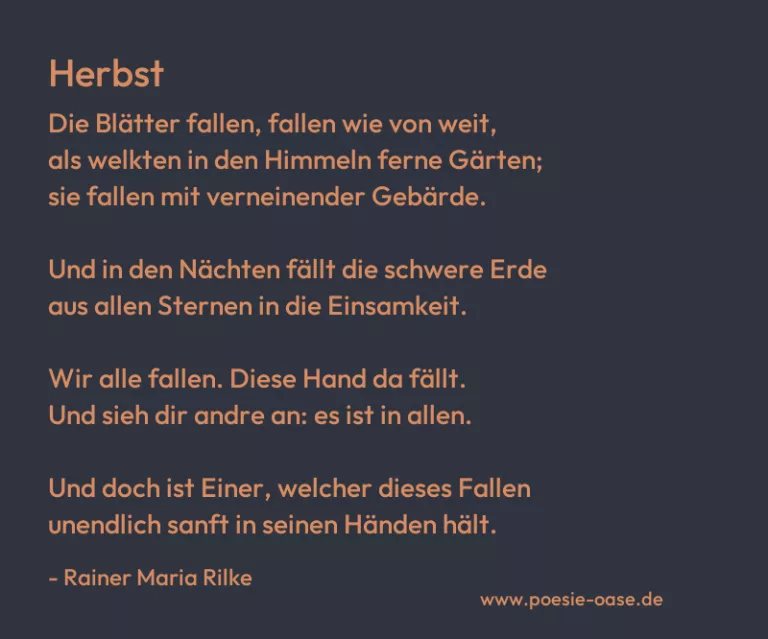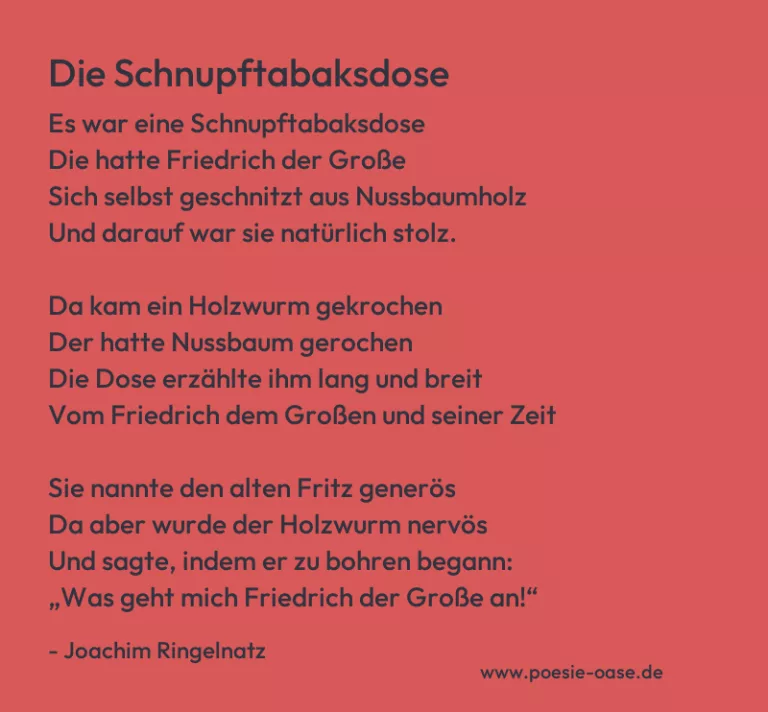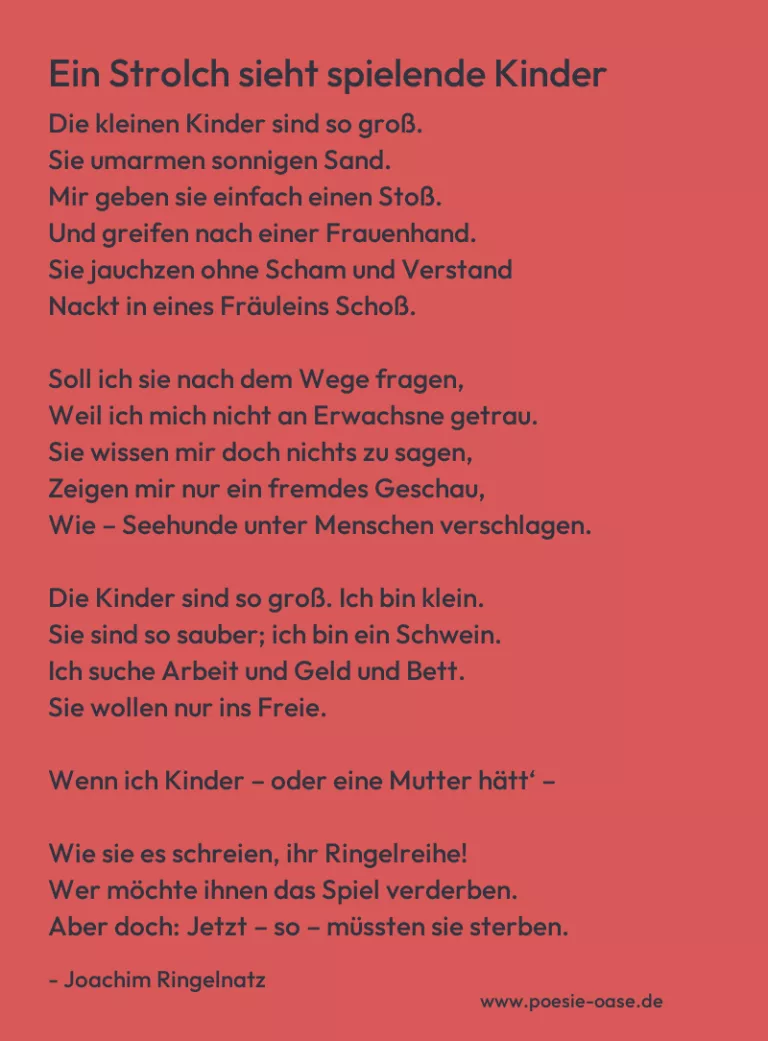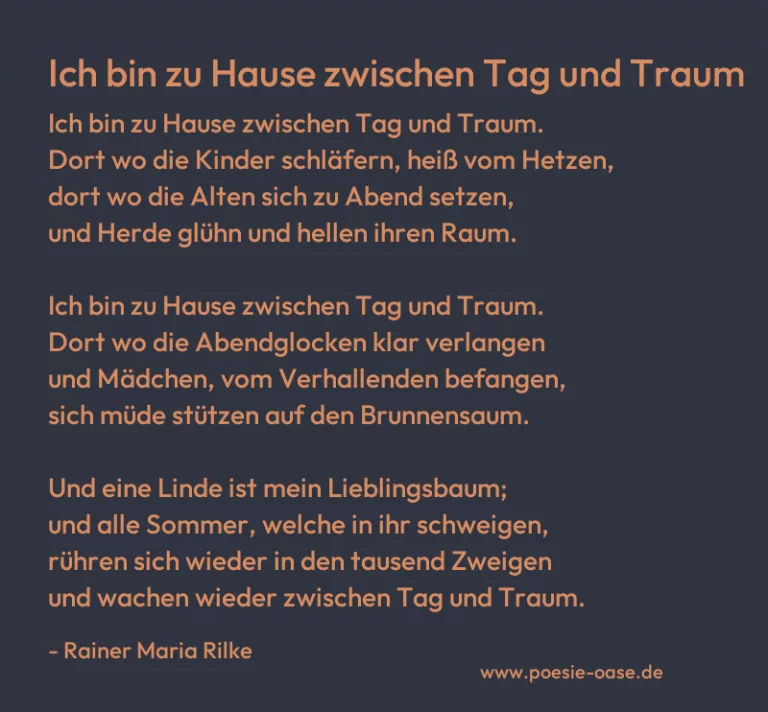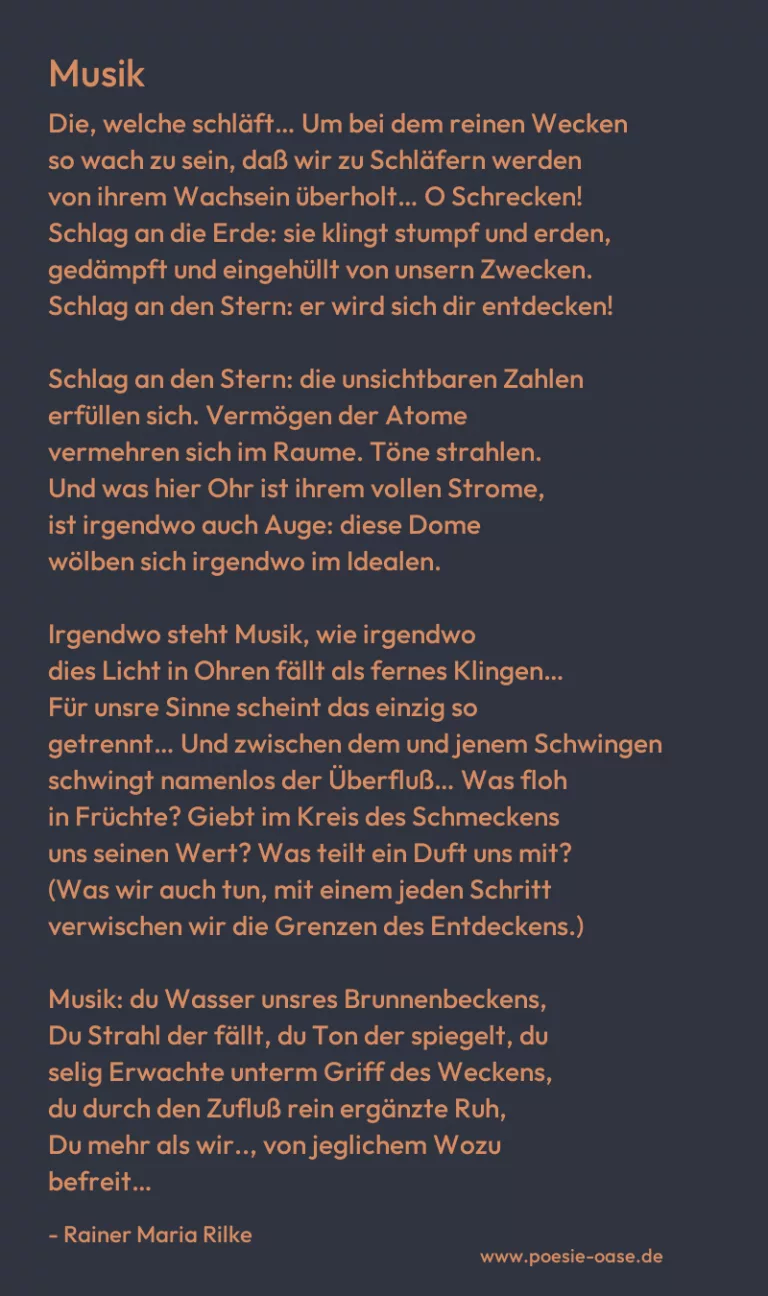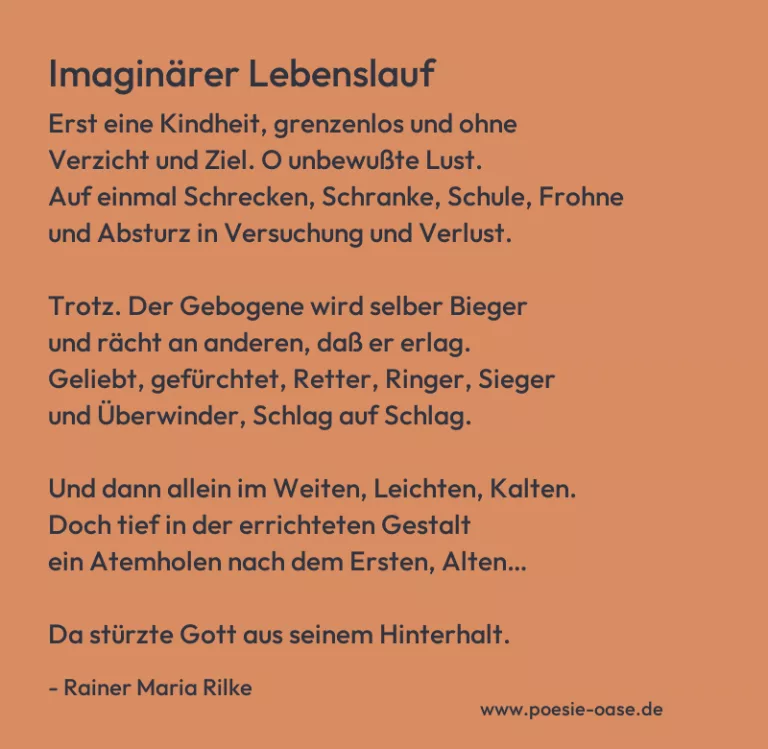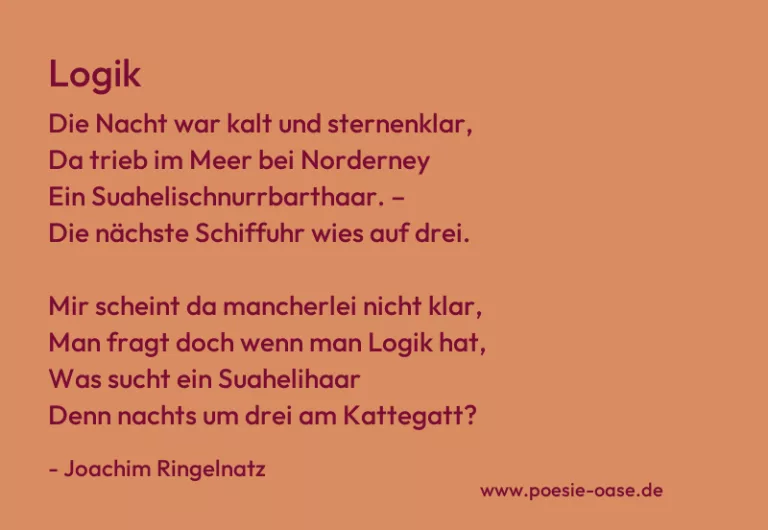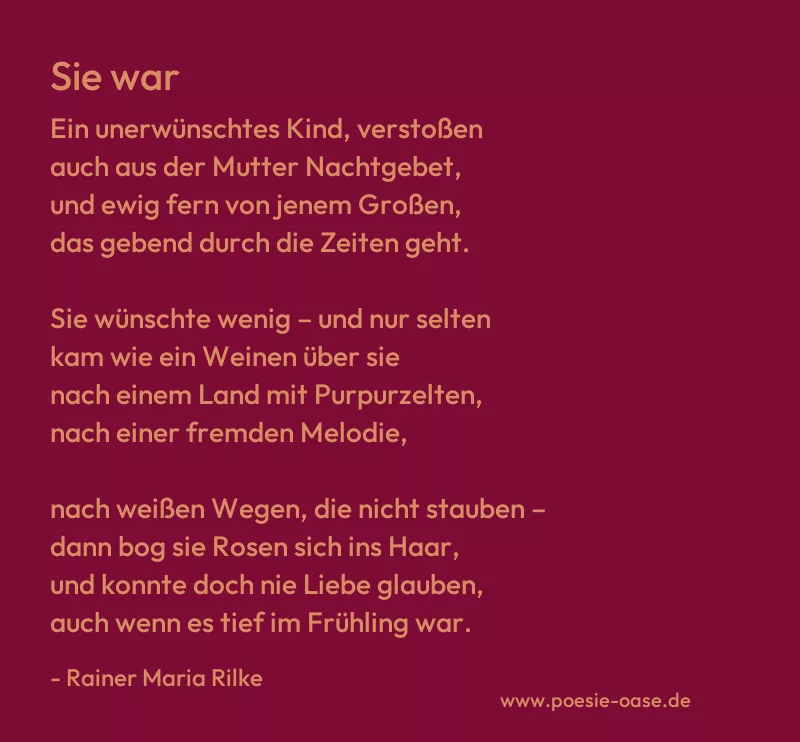Sie war
Ein unerwünschtes Kind, verstoßen
auch aus der Mutter Nachtgebet,
und ewig fern von jenem Großen,
das gebend durch die Zeiten geht.
Sie wünschte wenig – und nur selten
kam wie ein Weinen über sie
nach einem Land mit Purpurzelten,
nach einer fremden Melodie,
nach weißen Wegen, die nicht stauben –
dann bog sie Rosen sich ins Haar,
und konnte doch nie Liebe glauben,
auch wenn es tief im Frühling war.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
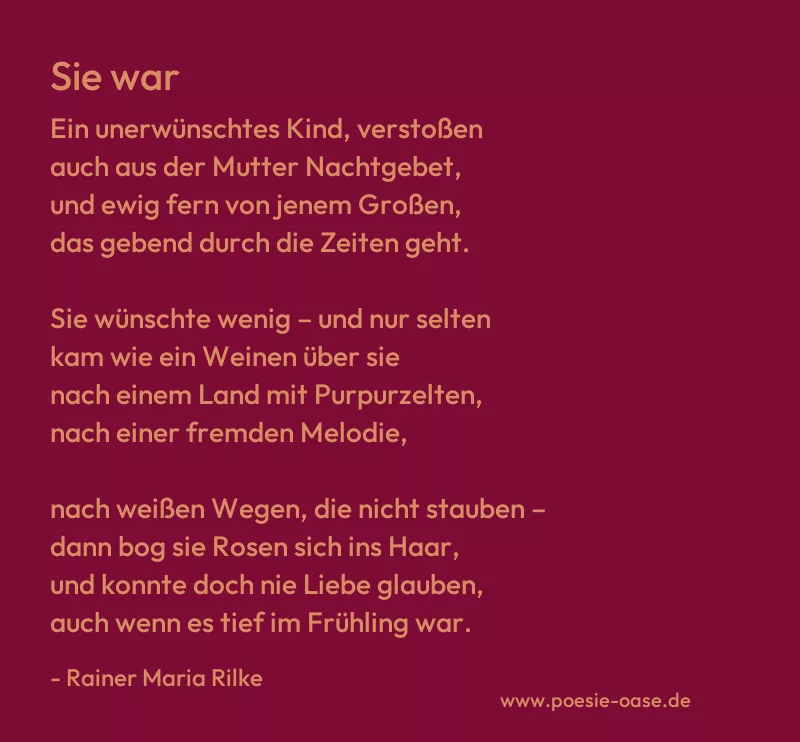
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sie“ von Rainer Maria Rilke beschreibt in knapper, eindringlicher Sprache das Leben einer Frau, die von Anfang an außerhalb aller menschlichen Wärme und Zugehörigkeit steht. Bereits die erste Strophe stellt sie als „unerwünschtes Kind“ dar, das nicht nur körperlich verstoßen, sondern auch aus dem spirituellen Schutz – dem „Nachtgebet“ der Mutter – ausgeschlossen wurde. Diese Ausgrenzung reicht bis in eine metaphysische Dimension, denn sie bleibt „ewig fern von jenem Großen, / das gebend durch die Zeiten geht“, womit Rilke eine universelle Kraft meint, die Leben, Liebe und Sinn schenkt.
In der zweiten Strophe offenbart sich eine tiefe innere Leere, gepaart mit einer leisen Sehnsucht. Die Frau „wünschte wenig“ – ein Hinweis auf Resignation – und selbst die gelegentlichen Regungen der Hoffnung erscheinen nur „wie ein Weinen“. Ihre Träume sind vage, poetisch und fern: ein Land mit „Purpurzelten“, eine „fremde Melodie“. Diese Bilder stehen für eine andere, idealisierte Welt, in der Schönheit und Geborgenheit denkbar wären – doch selbst diese Sehnsüchte bleiben flüchtig und unerreichbar.
Die dritte Strophe zeigt, dass sie gelegentlich versuchte, Schönheit oder Liebe in ihr Leben zu lassen – symbolisiert durch das „Rosen ins Haar“ biegen. Doch selbst in der Zeit des Neubeginns, „tief im Frühling“, war ihr das Vertrauen in die Liebe nicht möglich. Das Unvermögen zu glauben, zu vertrauen und sich zu öffnen ist tief in ihrer Biografie verankert. Liebe bleibt eine Möglichkeit, die außerhalb ihres Erlebens liegt.
Rilkes Sprache ist schlicht, aber von hoher Symbolkraft. Die Motive von Verlassenheit, Entfremdung und unerfüllter Sehnsucht prägen das Gedicht. Dabei bleibt die Figur der Frau namenlos, fast archetypisch, was ihrer Erfahrung eine allgemeingültige Tragik verleiht. Das Gedicht zeichnet so ein bewegendes Porträt eines innerlich verwaisten Menschen, dessen Leben sich im Schatten von Isolation und unerfüllten Hoffnungen vollzieht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.