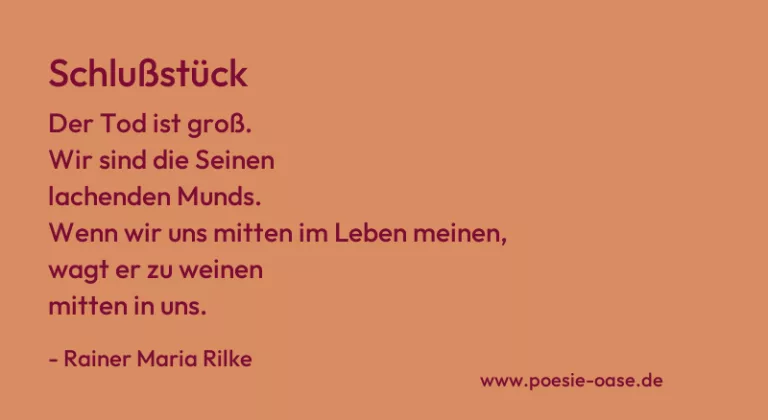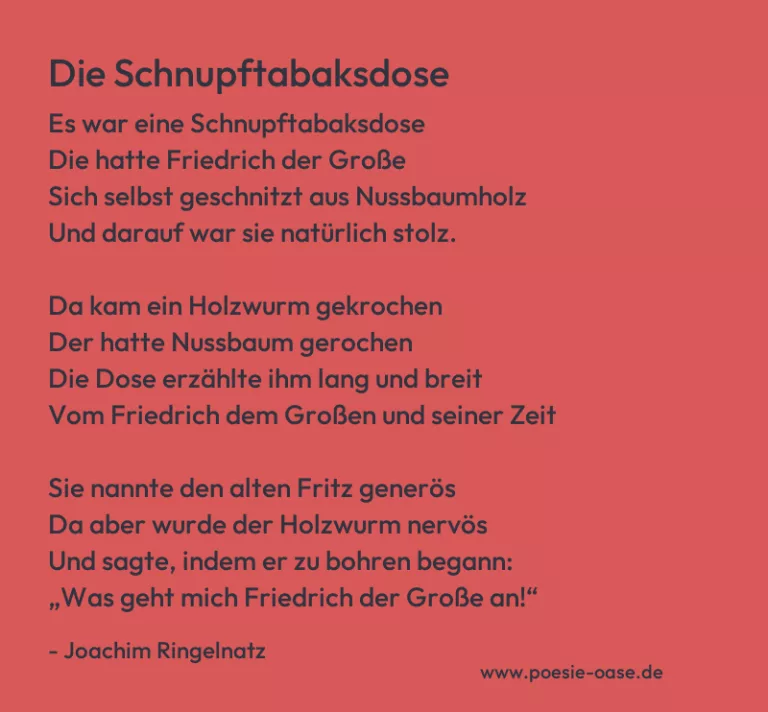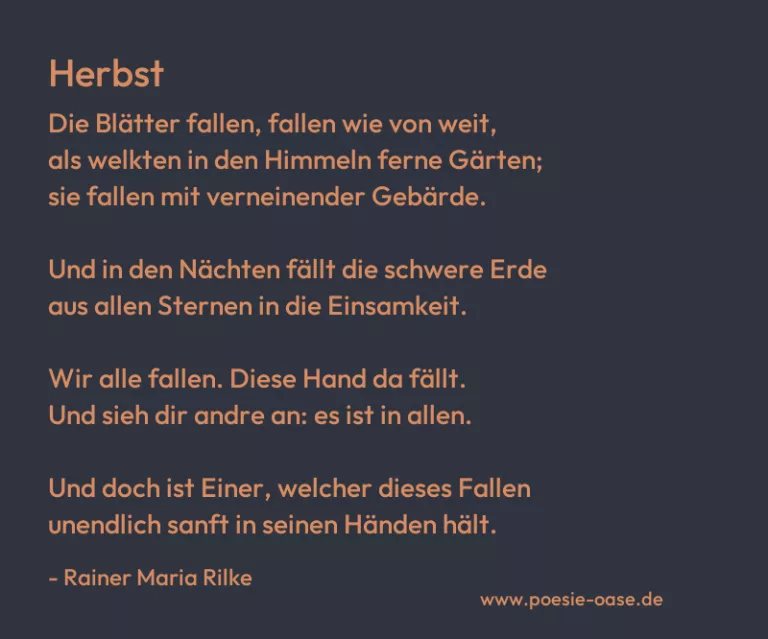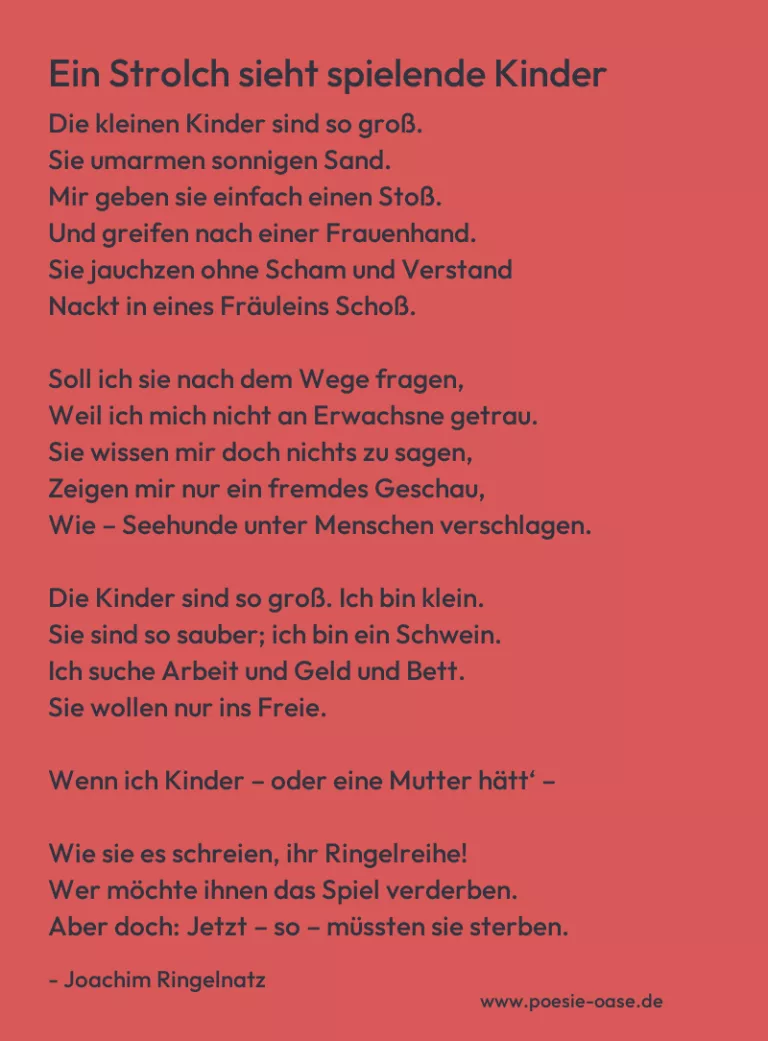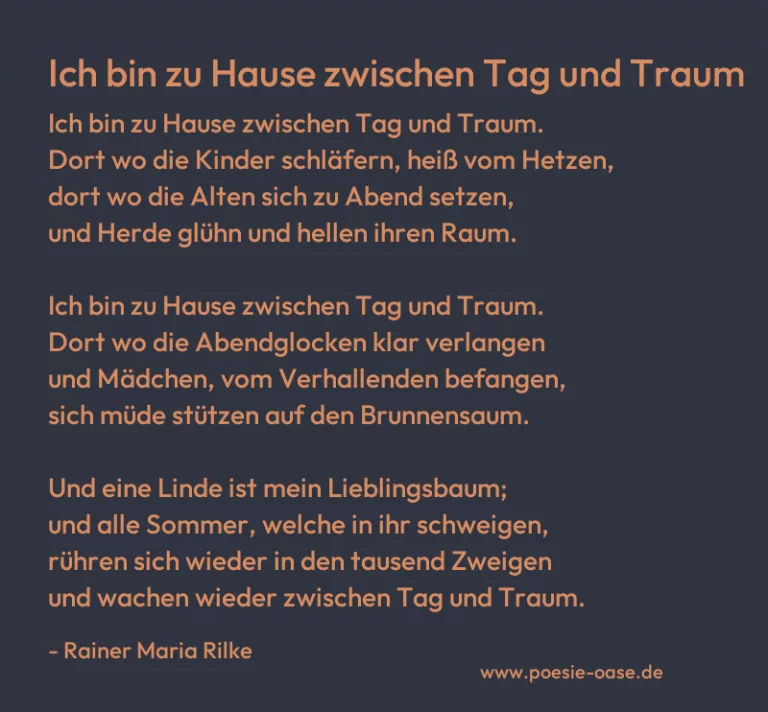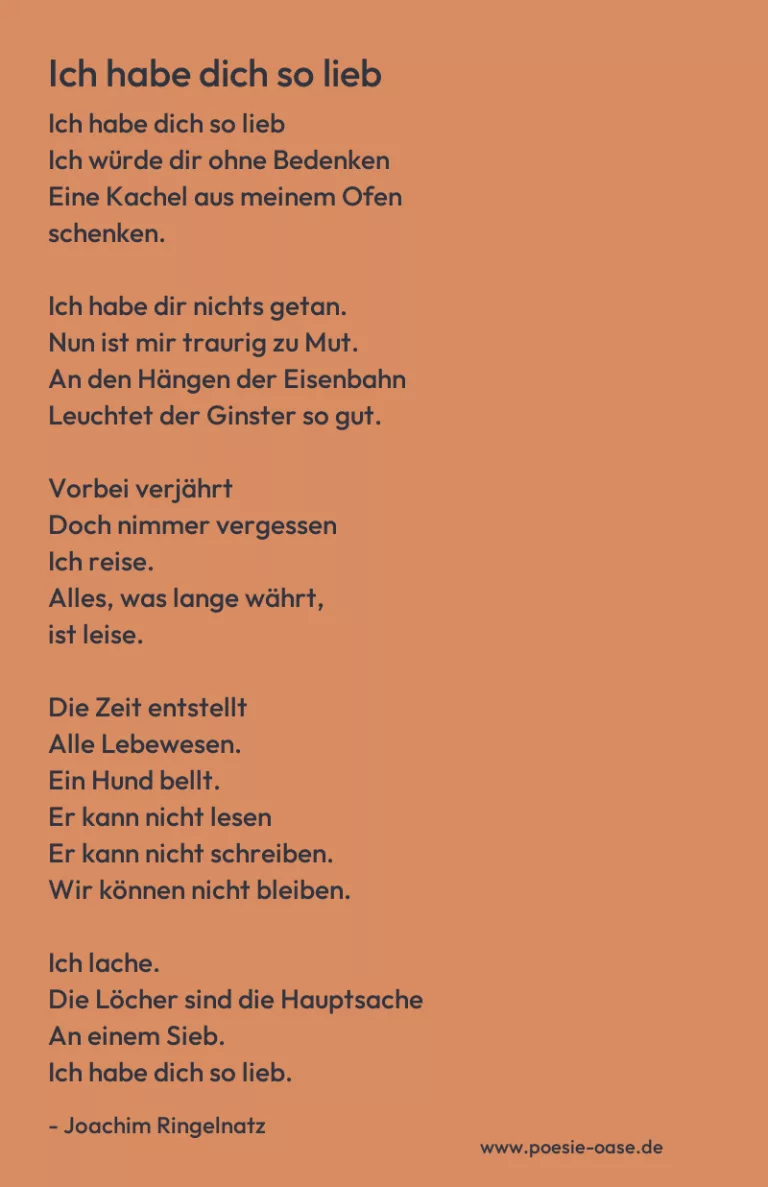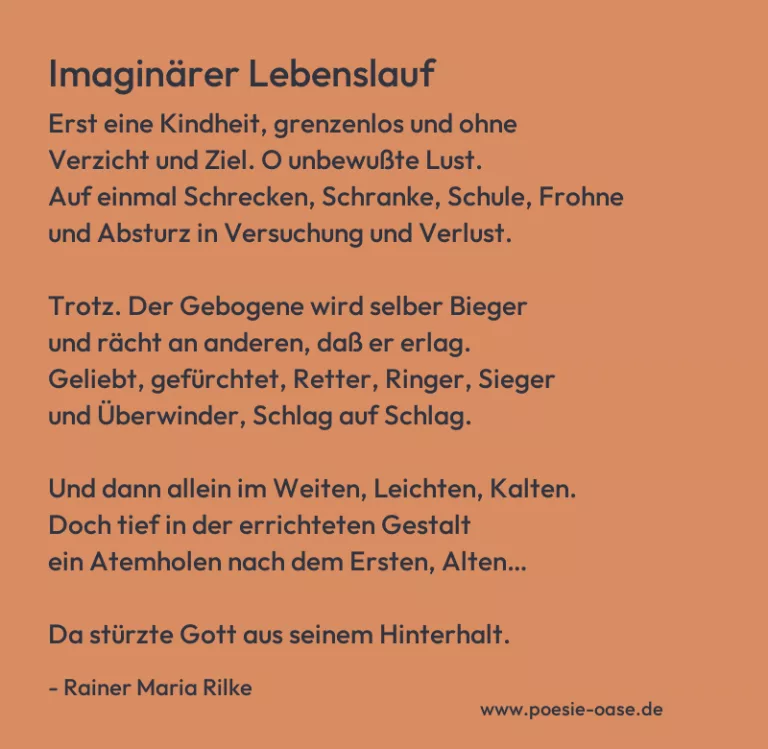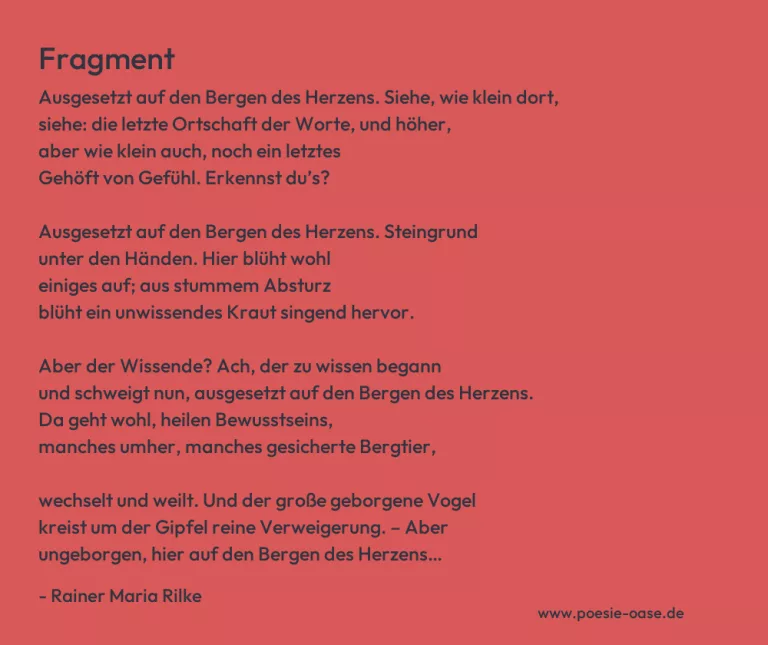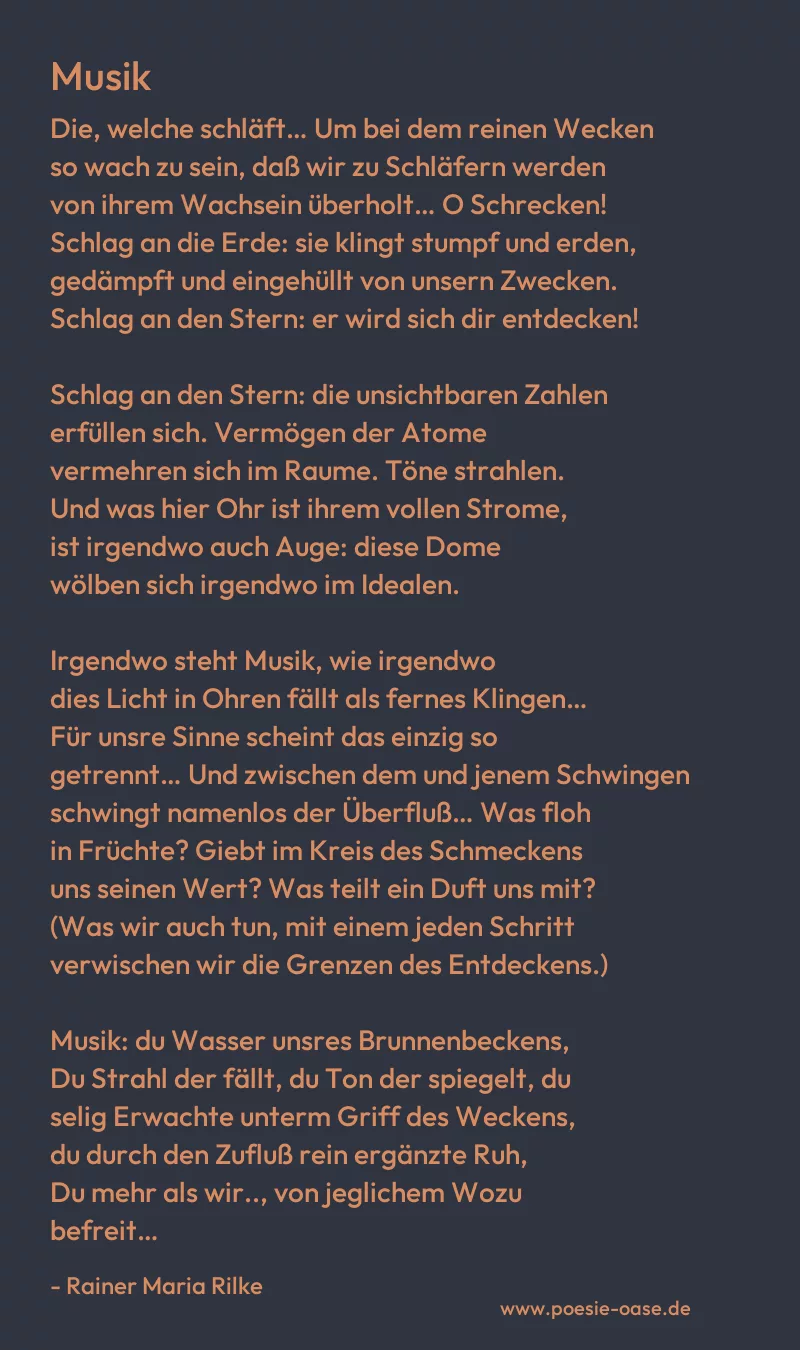Angst, Feiern, Gegenwart, Geld, Gemeinfrei, Hoffnung, Länder, Liebe & Romantik, Natur, Unschuld, Wagnisse
Musik
Die, welche schläft… Um bei dem reinen Wecken
so wach zu sein, daß wir zu Schläfern werden
von ihrem Wachsein überholt… O Schrecken!
Schlag an die Erde: sie klingt stumpf und erden,
gedämpft und eingehüllt von unsern Zwecken.
Schlag an den Stern: er wird sich dir entdecken!
Schlag an den Stern: die unsichtbaren Zahlen
erfüllen sich. Vermögen der Atome
vermehren sich im Raume. Töne strahlen.
Und was hier Ohr ist ihrem vollen Strome,
ist irgendwo auch Auge: diese Dome
wölben sich irgendwo im Idealen.
Irgendwo steht Musik, wie irgendwo
dies Licht in Ohren fällt als fernes Klingen…
Für unsre Sinne scheint das einzig so
getrennt… Und zwischen dem und jenem Schwingen
schwingt namenlos der Überfluß… Was floh
in Früchte? Giebt im Kreis des Schmeckens
uns seinen Wert? Was teilt ein Duft uns mit?
(Was wir auch tun, mit einem jeden Schritt
verwischen wir die Grenzen des Entdeckens.)
Musik: du Wasser unsres Brunnenbeckens,
Du Strahl der fällt, du Ton der spiegelt, du
selig Erwachte unterm Griff des Weckens,
du durch den Zufluß rein ergänzte Ruh,
Du mehr als wir.., von jeglichem Wozu
befreit…
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
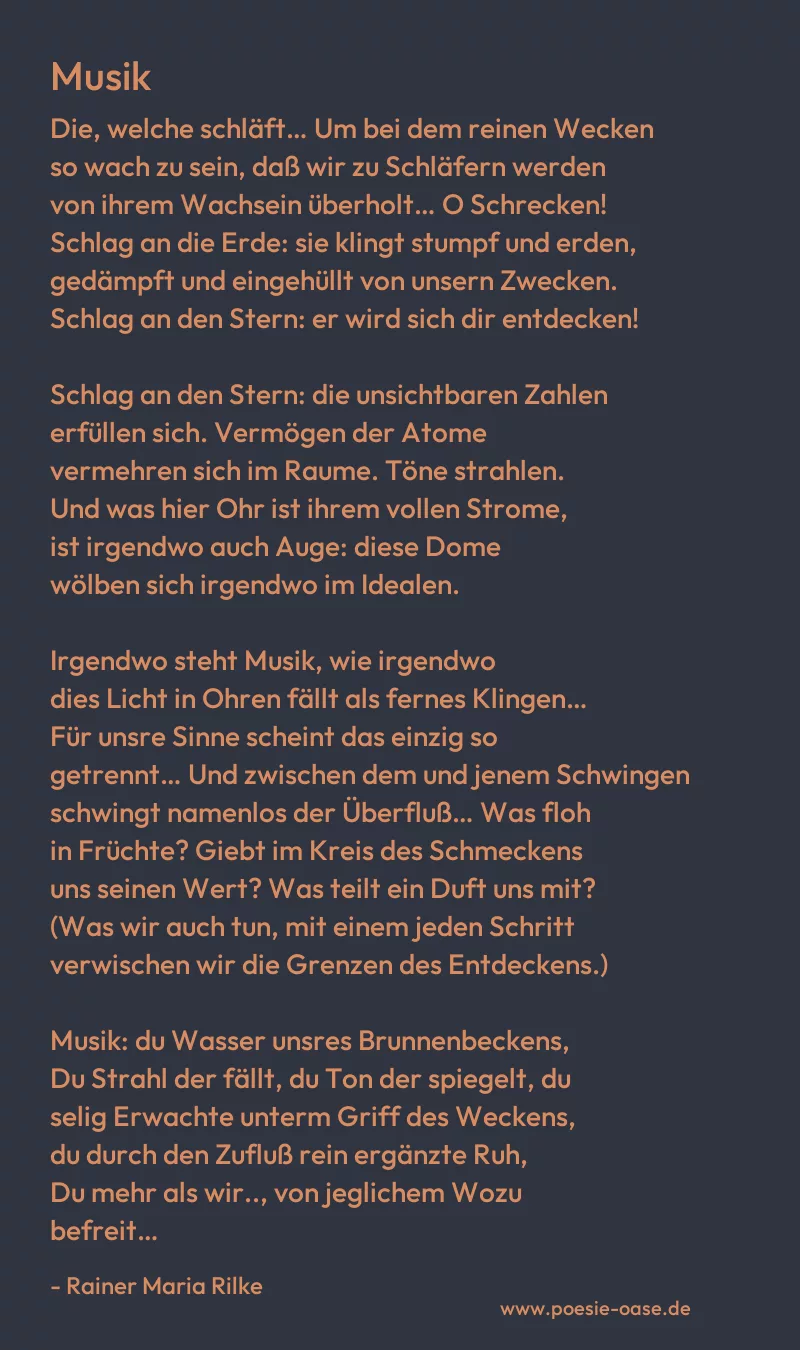
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Musik“ von Rainer Maria Rilke ist eine poetisch-philosophische Reflexion über die transzendente, grenzenüberschreitende Kraft der Musik. In vielschichtiger Symbolik beschreibt Rilke Musik als eine universelle Sprache, die jenseits unserer Sinne wirkt und dabei nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar, fühlbar, fast metaphysisch erfahrbar wird. Die Musik steht dabei für eine tiefere Wirklichkeit, die unser begrenztes Dasein übersteigt und durchdringt.
Bereits der Einstieg thematisiert eine existentielle Spannung: das „reine Wecken“ durch die Musik stellt eine Art spirituelles Erwachen dar, dem das Alltagsbewusstsein nicht standhalten kann. Die Musik ist so wach, dass wir – obwohl scheinbar wach – zu „Schläfern“ werden, überholt von einer tieferen, nicht rational fassbaren Präsenz. Der „Schlag an die Erde“ bleibt dumpf, zweckverhangen, während der „Schlag an den Stern“ eine Öffnung ins Kosmische, ins Unsichtbare erzeugt. Hier zeigt sich Rilkes oft verwendetes Motiv der Gegensätze: Erde und Stern, Diesseits und Jenseits, Zweck und reiner Klang.
In der zweiten Strophe wird Musik als physikalisch-energetisches Phänomen beschrieben, das mit dem Kosmos in Resonanz tritt: „Töne strahlen“ und „unsichtbare Zahlen“ füllen den Raum. Diese Verbindung von Musik und Mathematik – Zahl, Ton, Energie – erinnert an Pythagoras’ Idee der Sphärenharmonie. Musik wird hier nicht nur als Kunst, sondern als eine Art kosmische Ordnung verstanden, in der alle Dinge miteinander verbunden sind.
Rilke geht jedoch noch weiter: Er stellt die Grenzen unserer Wahrnehmung infrage. Was uns getrennt erscheint – Ton, Licht, Geschmack, Duft – ist möglicherweise nur eine Illusion unserer Sinne. Alles hängt im „namenlosen Überfluss“ zusammen. Der Mensch ist ständig dabei, durch seine Bewegungen die feinen Übergänge und Offenbarungen des Daseins zu überdecken, ohne es zu merken. Doch Musik kann diese verlorene Einheit erahnen lassen.
Die abschließende Strophe hebt Musik endgültig auf eine metaphysische Ebene. Sie ist „Wasser unsres Brunnenbeckens“, „Ton der spiegelt“, eine „selig Erwachte“ und zugleich reine Ruhe – ein Paradoxon, das auf ihre zeitlose, überwirkliche Natur verweist. Musik ist für Rilke „mehr als wir“, weil sie keinem Zweck dient, keiner Funktion unterliegt, sondern ein freies, sinnlich-geistiges Ereignis ist, das uns über uns selbst hinausführt.
Insgesamt beschreibt Rilke Musik als ein Medium der Transzendenz, das im Gegensatz zur Zweckhaftigkeit des Alltags eine reine, freie und umfassende Erfahrung des Daseins ermöglicht. Musik wird so zu einer Brücke zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, zwischen Mensch und Kosmos – ein Medium der Erkenntnis, das nicht in Worte zu fassen ist, sondern nur im Hören, Fühlen und Staunen erfahrbar bleibt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.