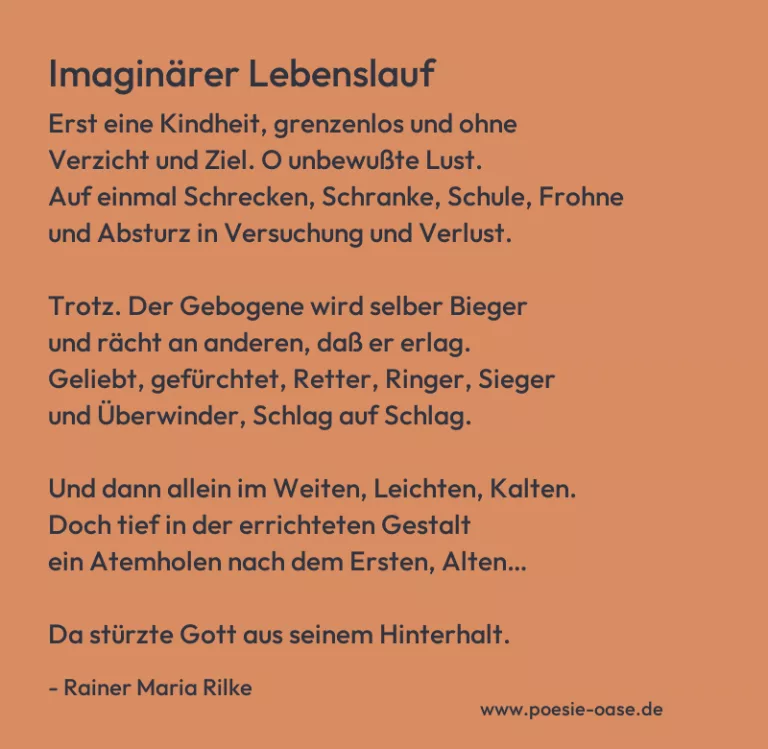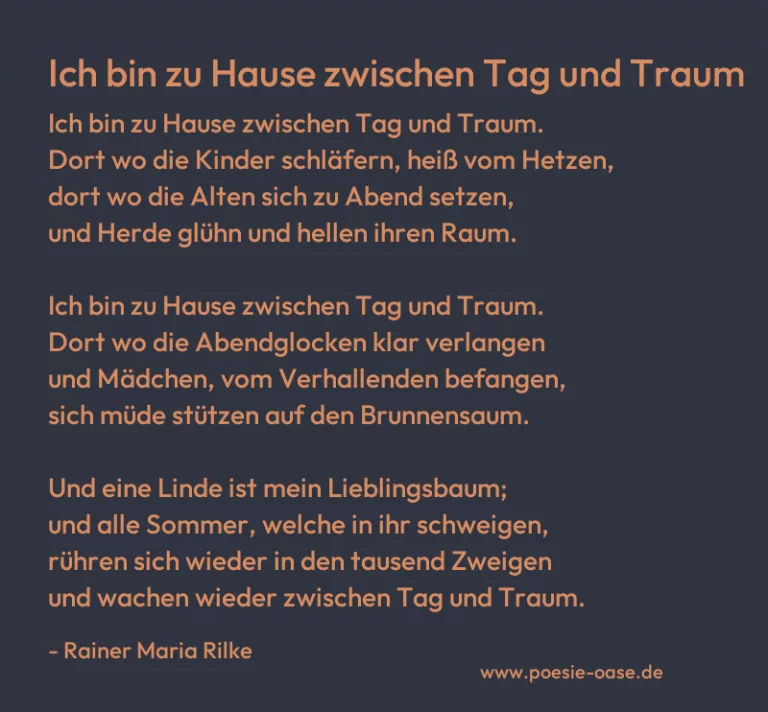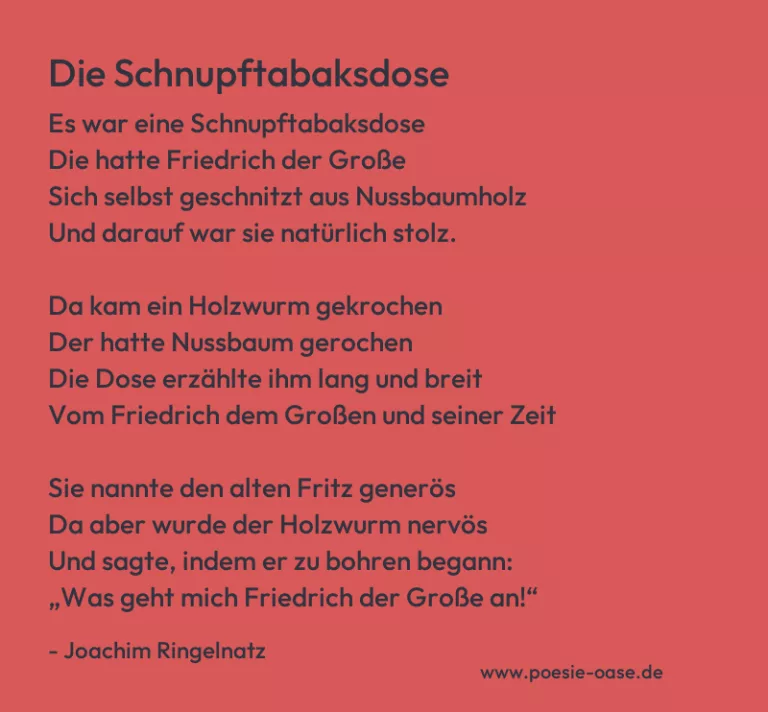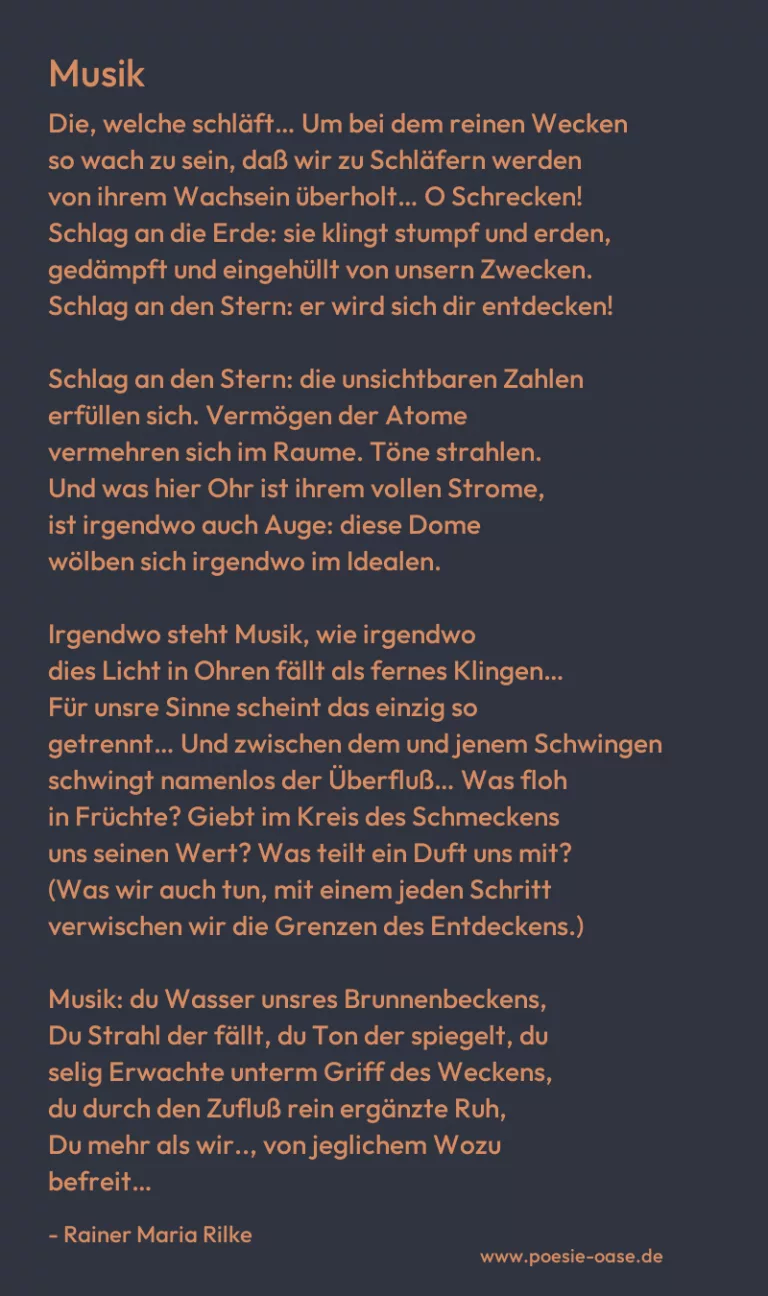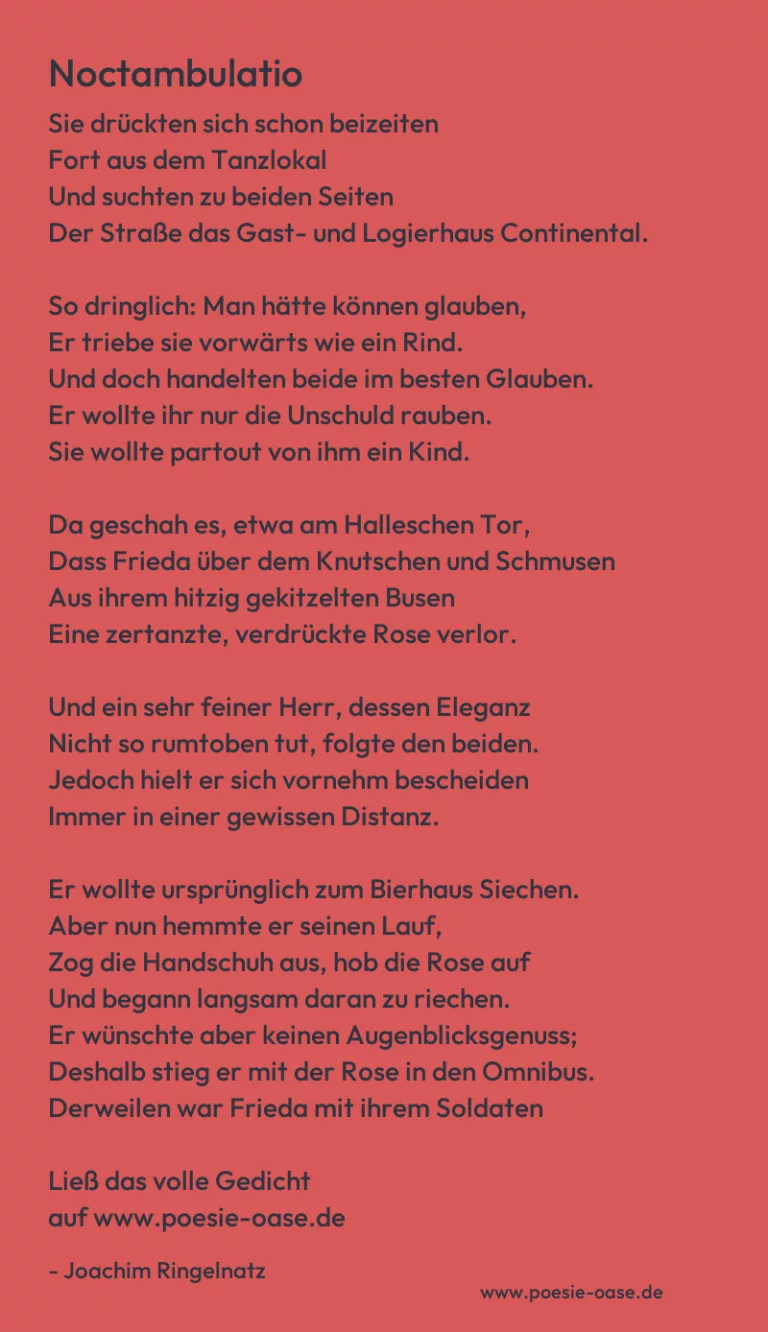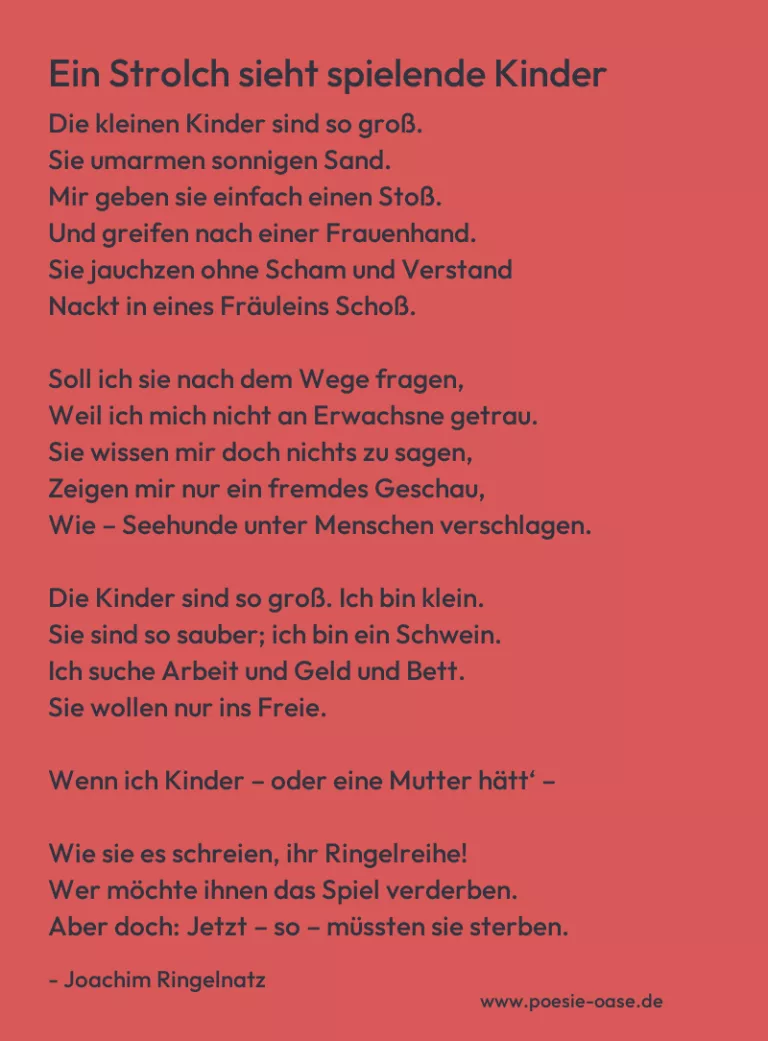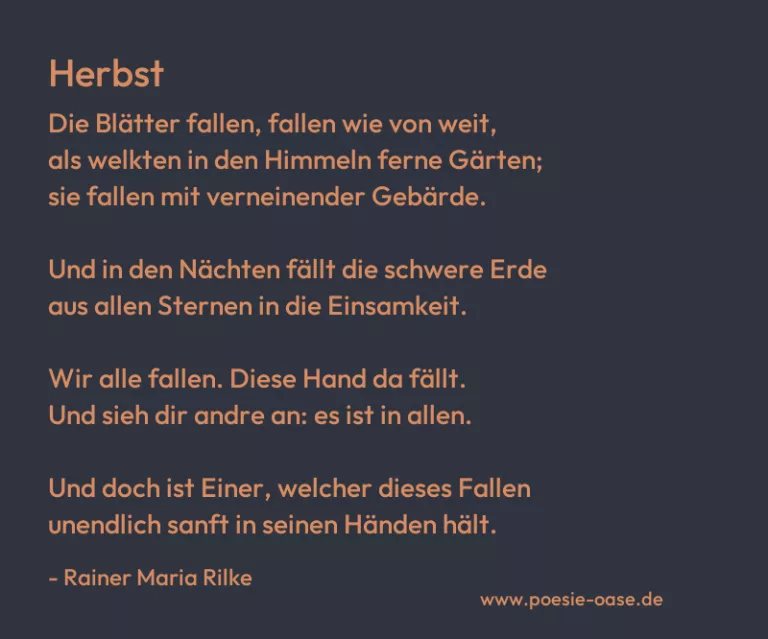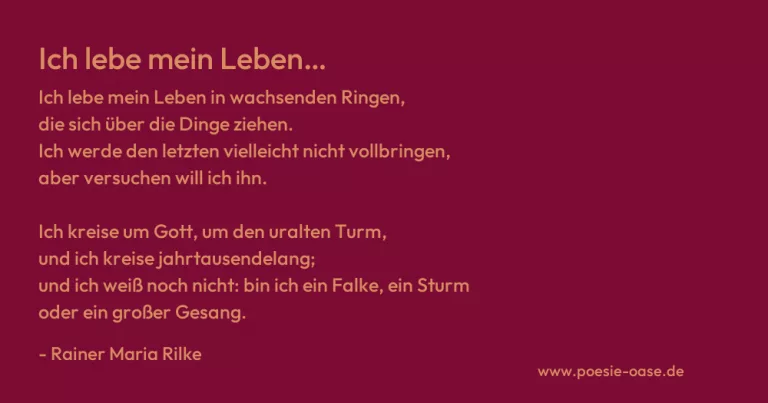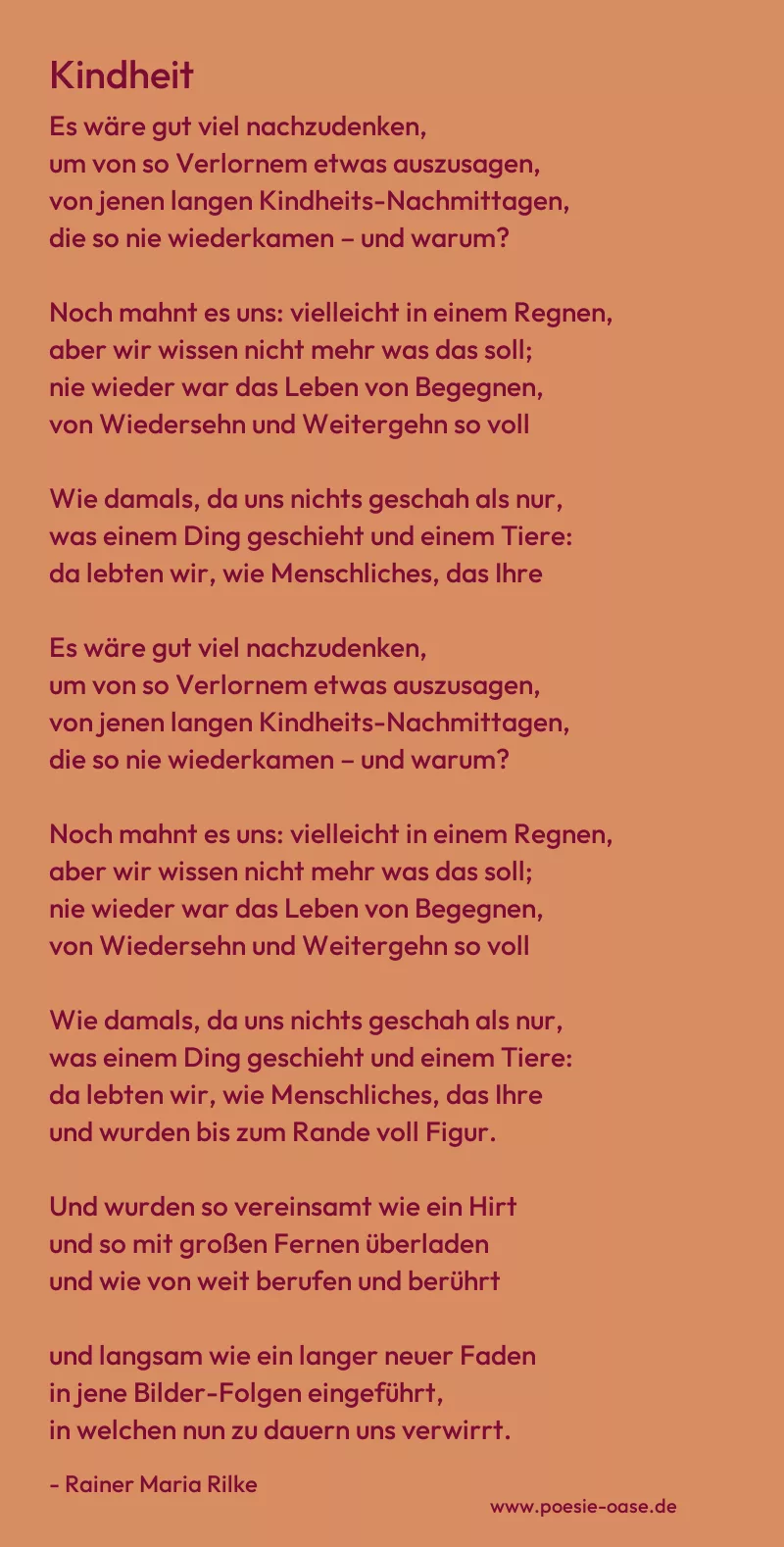Es wäre gut viel nachzudenken,
um von so Verlornem etwas auszusagen,
von jenen langen Kindheits-Nachmittagen,
die so nie wiederkamen – und warum?
Noch mahnt es uns: vielleicht in einem Regnen,
aber wir wissen nicht mehr was das soll;
nie wieder war das Leben von Begegnen,
von Wiedersehn und Weitergehn so voll
Wie damals, da uns nichts geschah als nur,
was einem Ding geschieht und einem Tiere:
da lebten wir, wie Menschliches, das Ihre
Es wäre gut viel nachzudenken,
um von so Verlornem etwas auszusagen,
von jenen langen Kindheits-Nachmittagen,
die so nie wiederkamen – und warum?
Noch mahnt es uns: vielleicht in einem Regnen,
aber wir wissen nicht mehr was das soll;
nie wieder war das Leben von Begegnen,
von Wiedersehn und Weitergehn so voll
Wie damals, da uns nichts geschah als nur,
was einem Ding geschieht und einem Tiere:
da lebten wir, wie Menschliches, das Ihre
und wurden bis zum Rande voll Figur.
Und wurden so vereinsamt wie ein Hirt
und so mit großen Fernen überladen
und wie von weit berufen und berührt
und langsam wie ein langer neuer Faden
in jene Bilder-Folgen eingeführt,
in welchen nun zu dauern uns verwirrt.