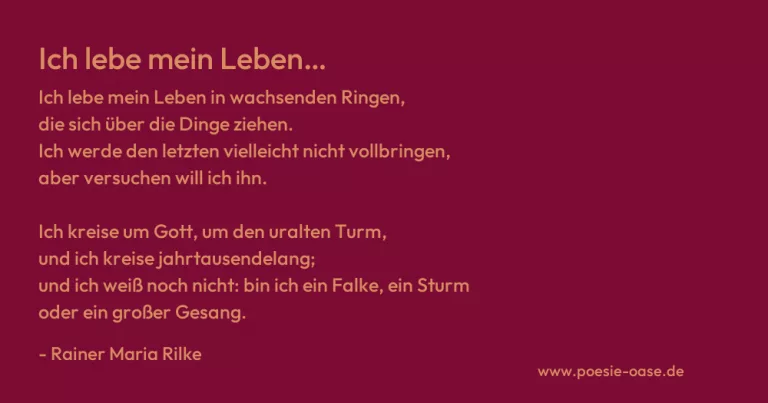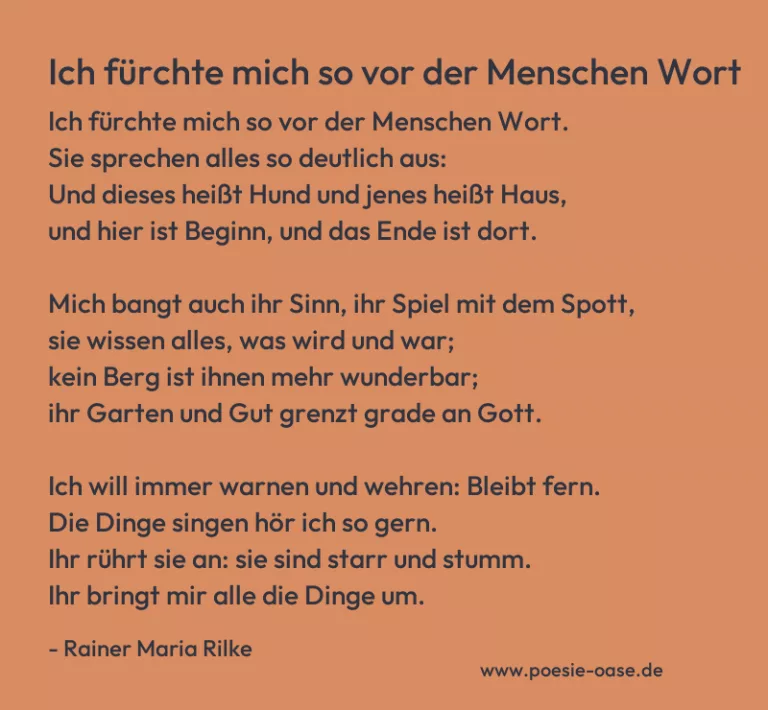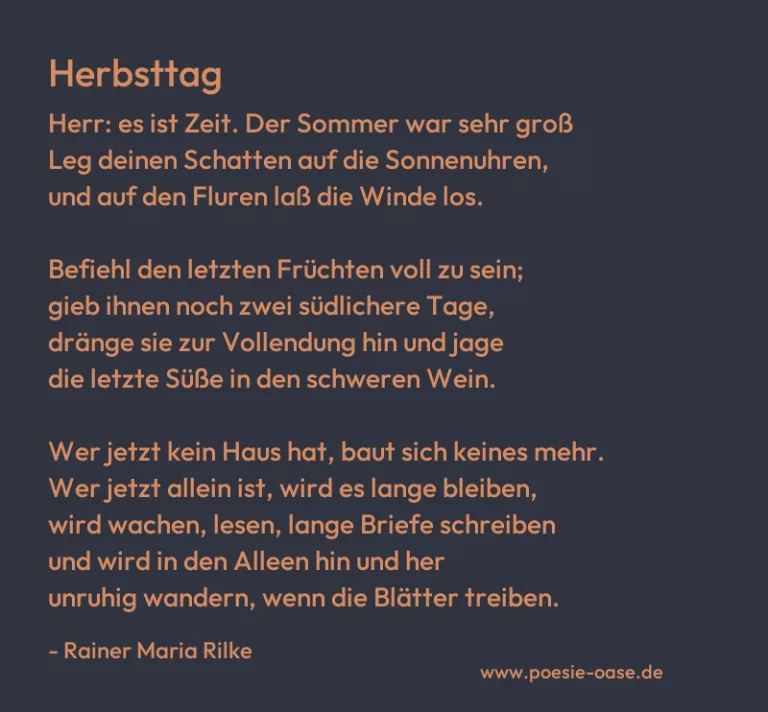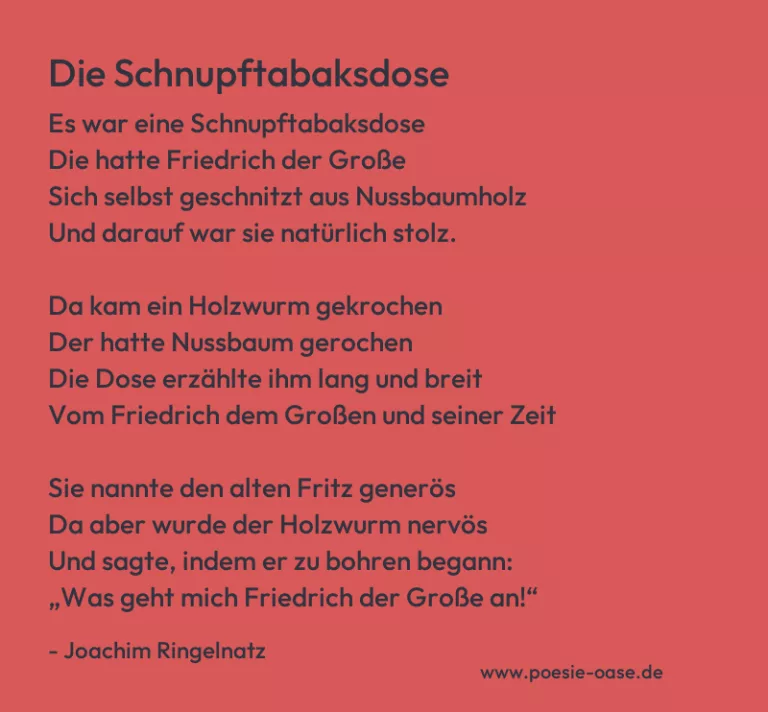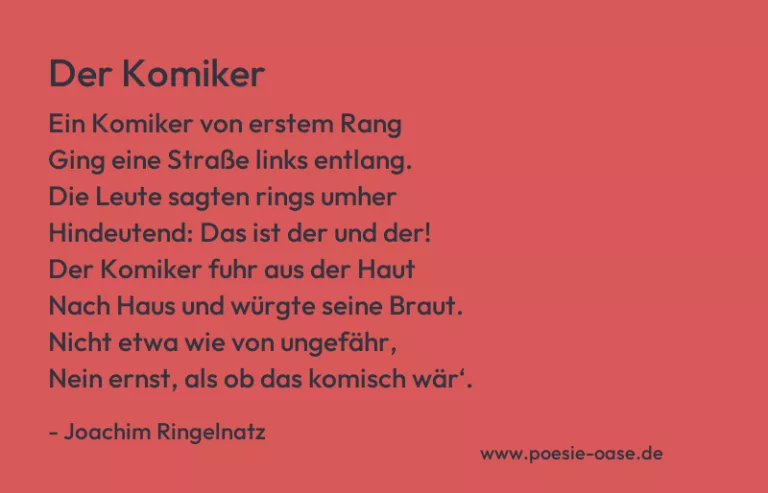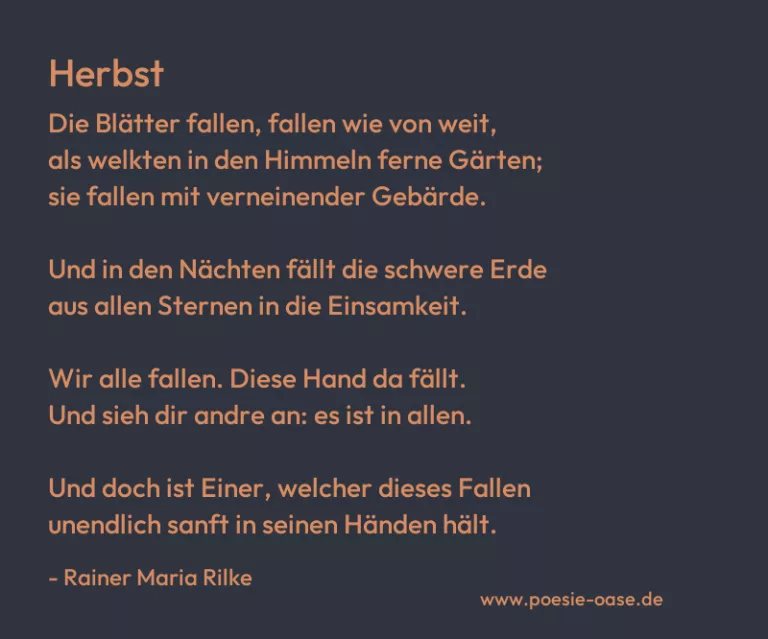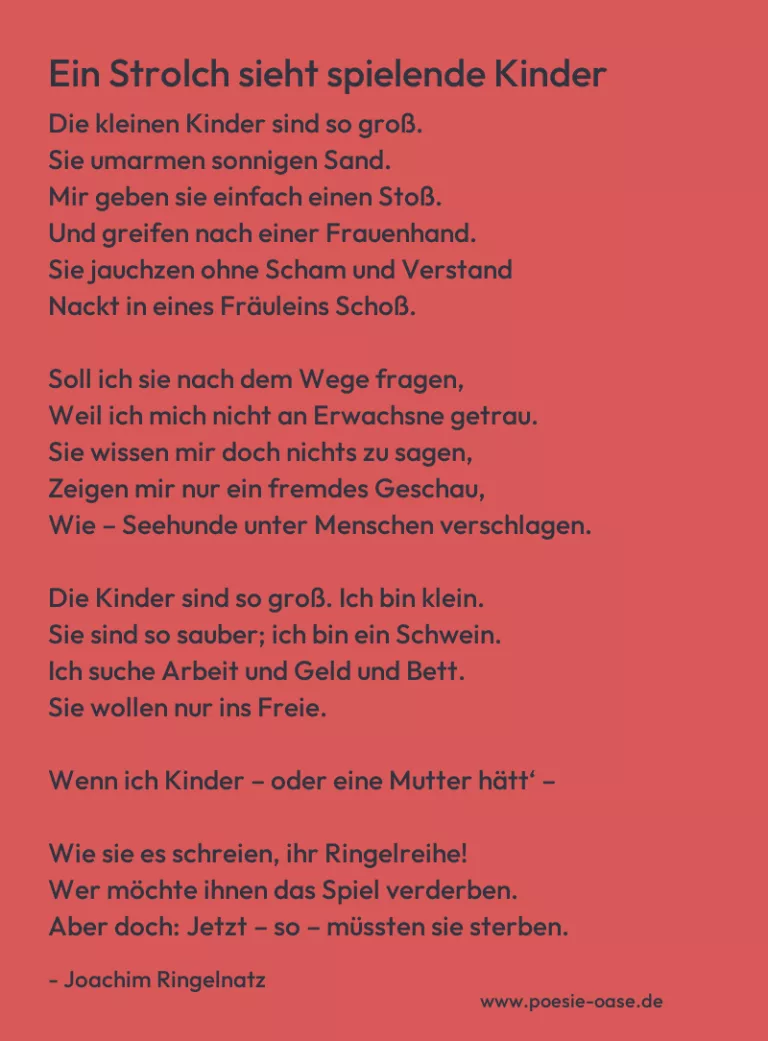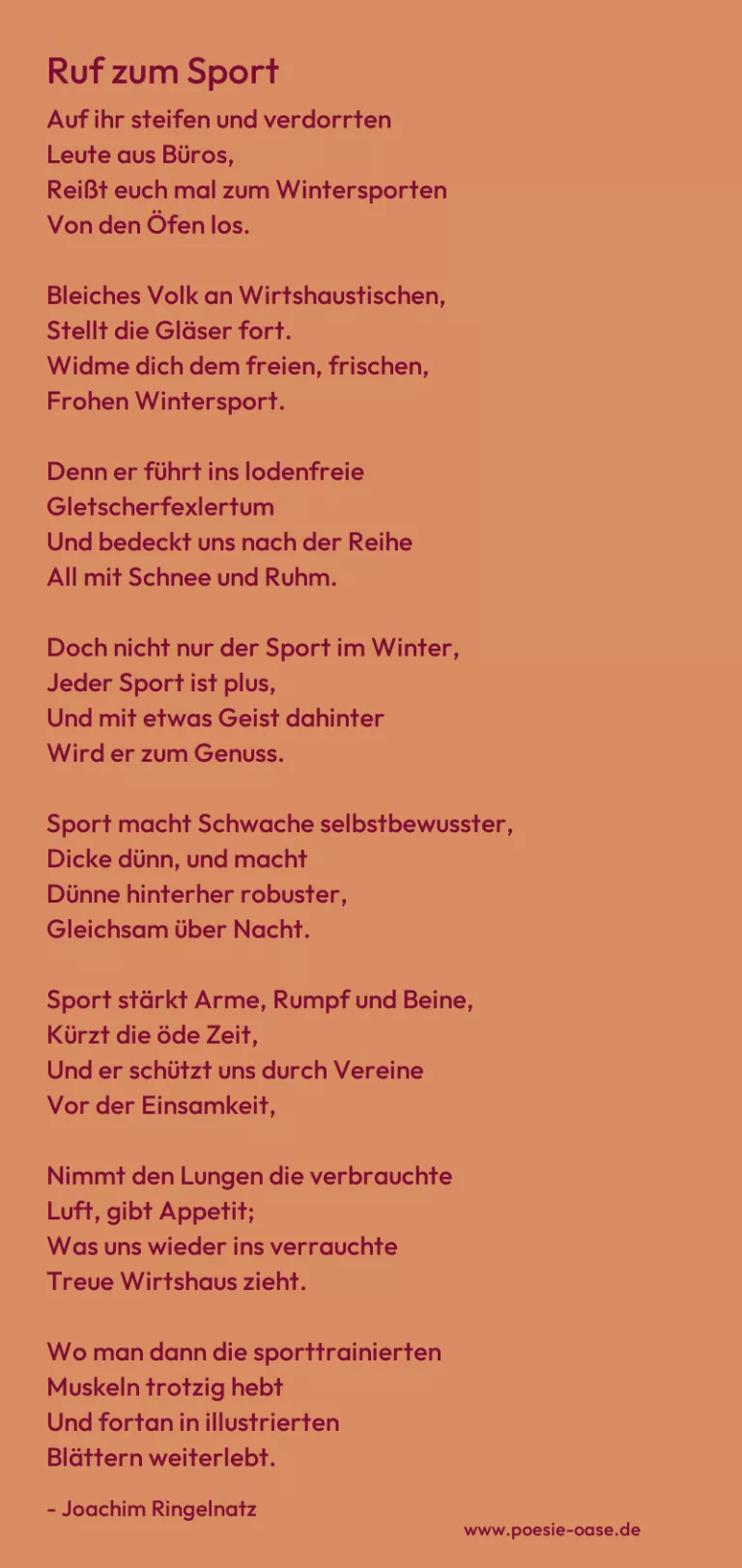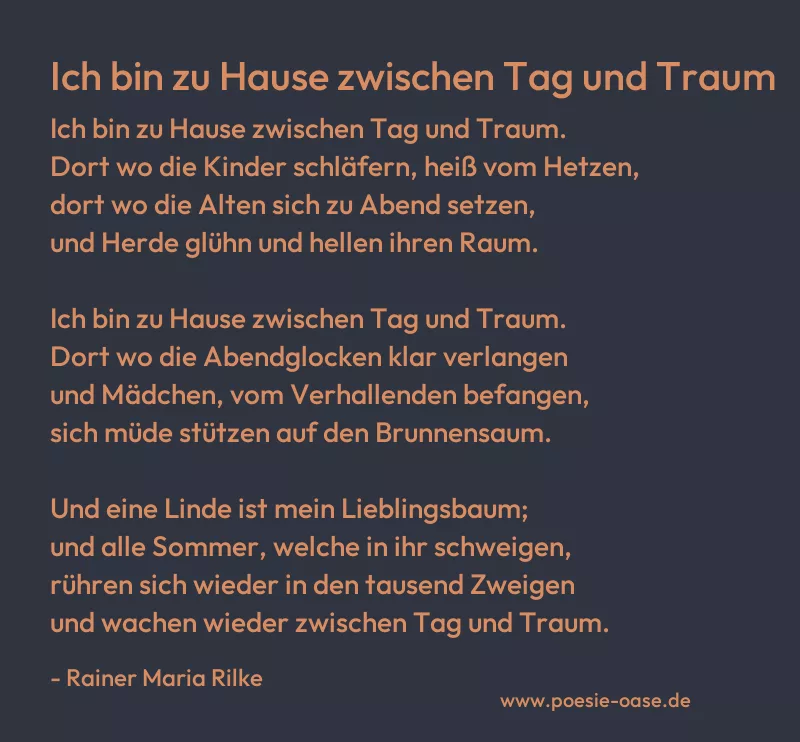Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum
Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum.
Dort wo die Kinder schläfern, heiß vom Hetzen,
dort wo die Alten sich zu Abend setzen,
und Herde glühn und hellen ihren Raum.
Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum.
Dort wo die Abendglocken klar verlangen
und Mädchen, vom Verhallenden befangen,
sich müde stützen auf den Brunnensaum.
Und eine Linde ist mein Lieblingsbaum;
und alle Sommer, welche in ihr schweigen,
rühren sich wieder in den tausend Zweigen
und wachen wieder zwischen Tag und Traum.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
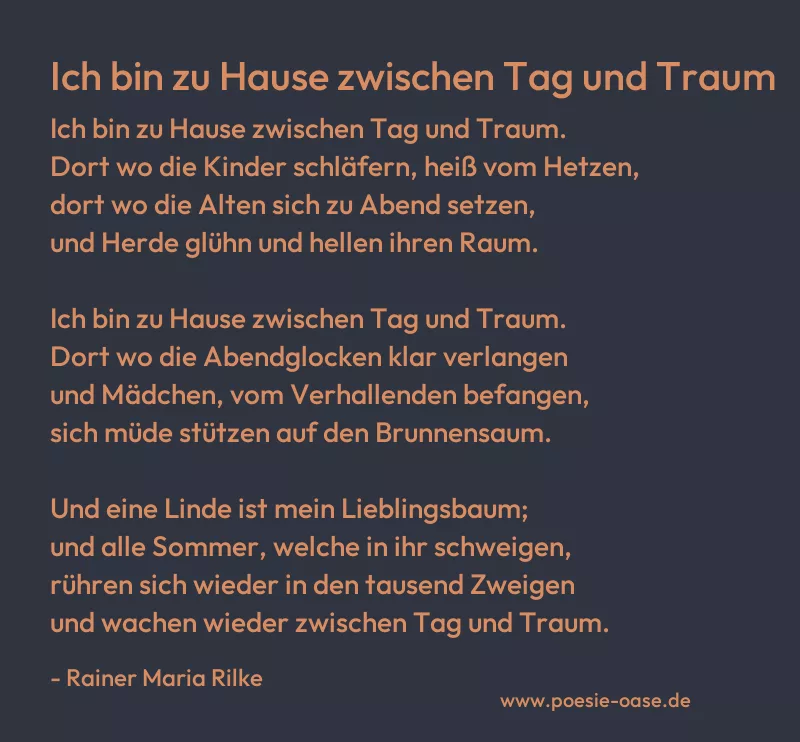
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum“ von Rainer Maria Rilke beschreibt einen Zustand der Zwischenwelt, in dem der Sprecher zwischen der Realität des Tages und der Fantasie des Traums schwebt. Diese „Zwischenwelt“ ist ein Ort der Ruhe und der Besinnung, an dem die gewöhnlichen Tätigkeiten des Lebens in eine Art träumerische Harmonie übergehen. Zu Beginn des Gedichts erklärt der Sprecher, dass er „zu Hause“ ist, „zwischen Tag und Traum“, was eine metaphorische Bedeutung hat. Es ist ein Zustand des Übergangs, an dem sich das reale Leben und die fließenden, oft ungreifbaren Elemente der Träume vereinen. Der Ort, an dem er sich befindet, ist nicht vollständig in der physischen Welt verankert, sondern in einem Zwischenraum, der weder ganz wach noch ganz träumerisch ist.
In der ersten Strophe beschreibt der Sprecher, wie „die Kinder schläfern, heiß vom Hetzen“, was eine Momentaufnahme der Unschuld und des Abschlusses eines Tages darstellt. Die Kinder haben den Tag über verbraucht und ruhen nun, während „die Alten sich zu Abend setzen“. Es ist ein Bild von Besinnung und Ruhe, die den Tag abrunden. Die „Herde glühn“ und erleuchten ihren Raum, was auf die Gemütlichkeit und die Wärme des Hauses hinweist, das ein Rückzugsort für die Seele darstellt.
Die zweite Strophe bringt uns weiter in diese Zwischenwelt, wo die „Abendglocken“ einen klaren, aber sehnsüchtigen Klang von sich geben. Der Klang hat eine Wirkung auf die Mädchen, die „vom Verhallenden befangen“ sind und sich „müde stützen auf den Brunnensaum“. Der Abend ist hier ein Moment der Erschöpfung, aber auch der Kontemplation und des Übergangs in die Nacht, die für die Mädchen wie eine Beruhigung des Geistes und des Körpers wirkt. Die Linde als „Lieblingsbaum“ des Sprechers erscheint als Symbol für Beständigkeit und natürliche Ruhe, die sowohl im Sommer als auch in den Erinnerungen des Sprechers fortbesteht.
In der letzten Strophe verweist Rilke auf die Linde als ein Symbol der Natur und der Zeit. Die Sommer, die in der Linde „schweigen“, finden ihren Ausdruck in den „tausend Zweigen“, die sich immer wieder in den „Zwischenraum von Tag und Traum“ hineinbewegen. Diese Wiederholung von Sommern und die Erweckung der Erinnerungen an vergangene Tage sind ein poetisches Bild für die Zyklen des Lebens, die immer wieder zwischen der Realität und der Traumwelt hin und her schwingen. Die Linde symbolisiert somit sowohl die Beständigkeit als auch die ständige Erneuerung von Momenten, die uns zu Hause fühlen lassen.
Das Gedicht ist eine Hymne auf das Gefühl des Zuhauses und des inneren Friedens, das im Übergang zwischen den Welten von Tag und Traum zu finden ist. Es zeigt, wie der Mensch in der Natur und in den alltäglichen Rhythmen des Lebens Ruhe finden kann – jenseits der äußeren Anforderungen und im Einklang mit den eigenen inneren Zyklen. Rilke schafft einen Raum, in dem der Sprecher die Verschmelzung von Erinnerung, Gegenwart und Traum erlebt, was eine poetische Reflexion über das Zuhause als Ort der ständigen Transformation ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.