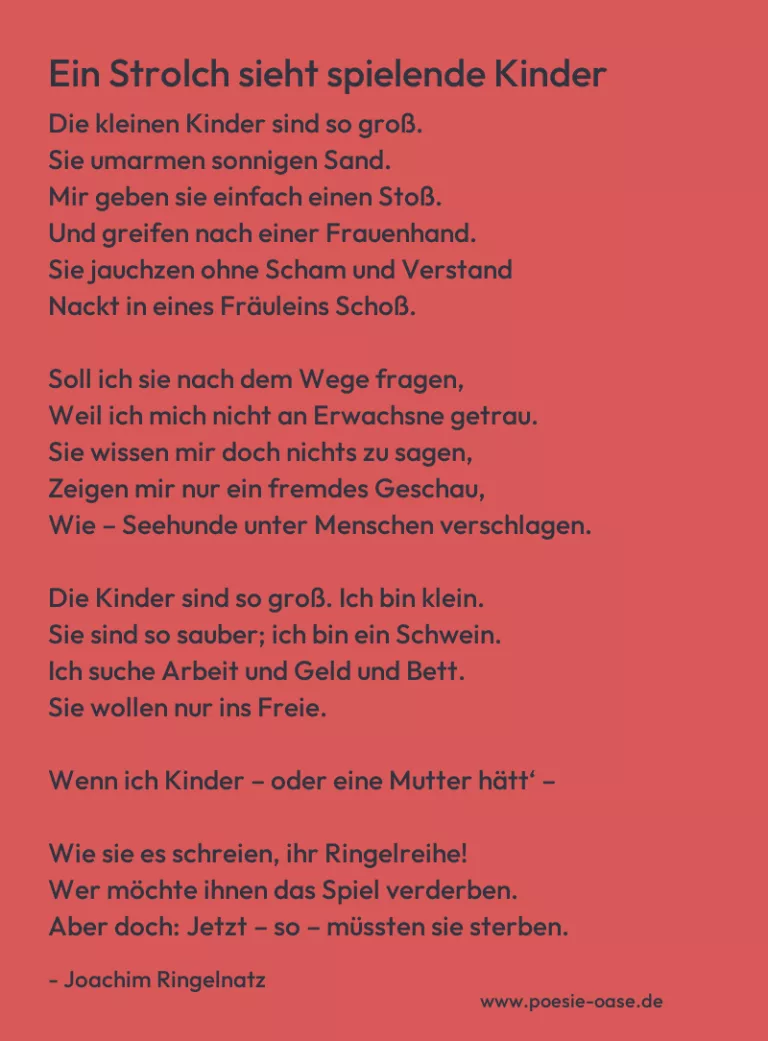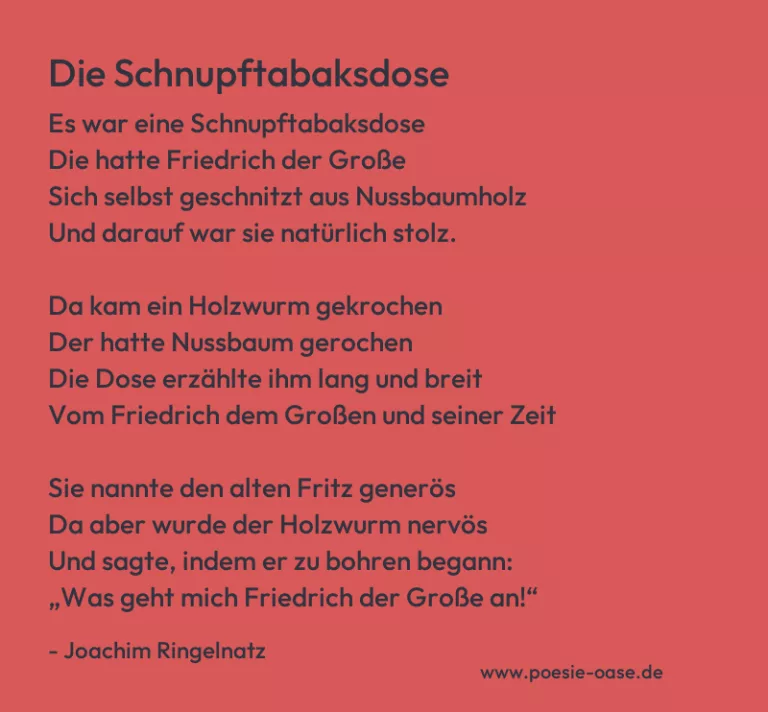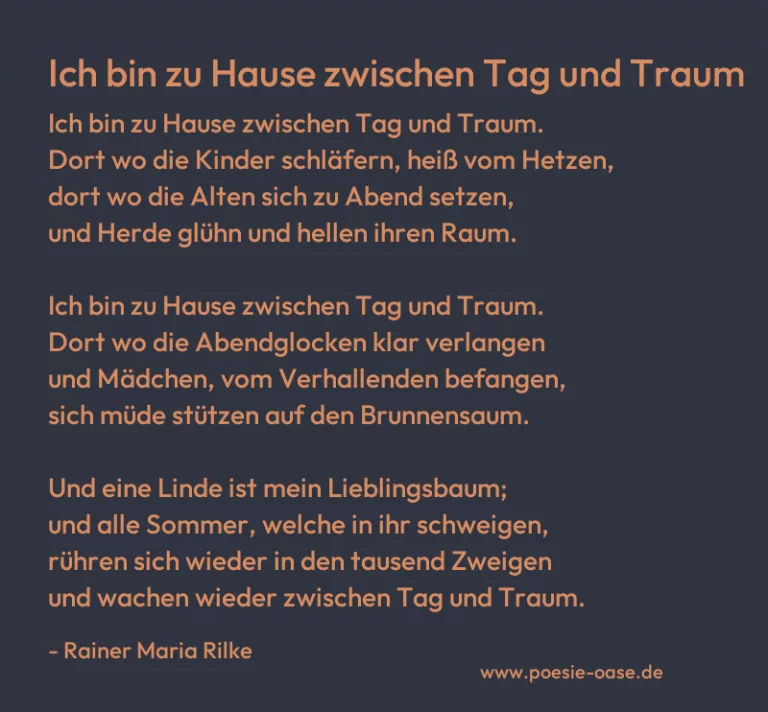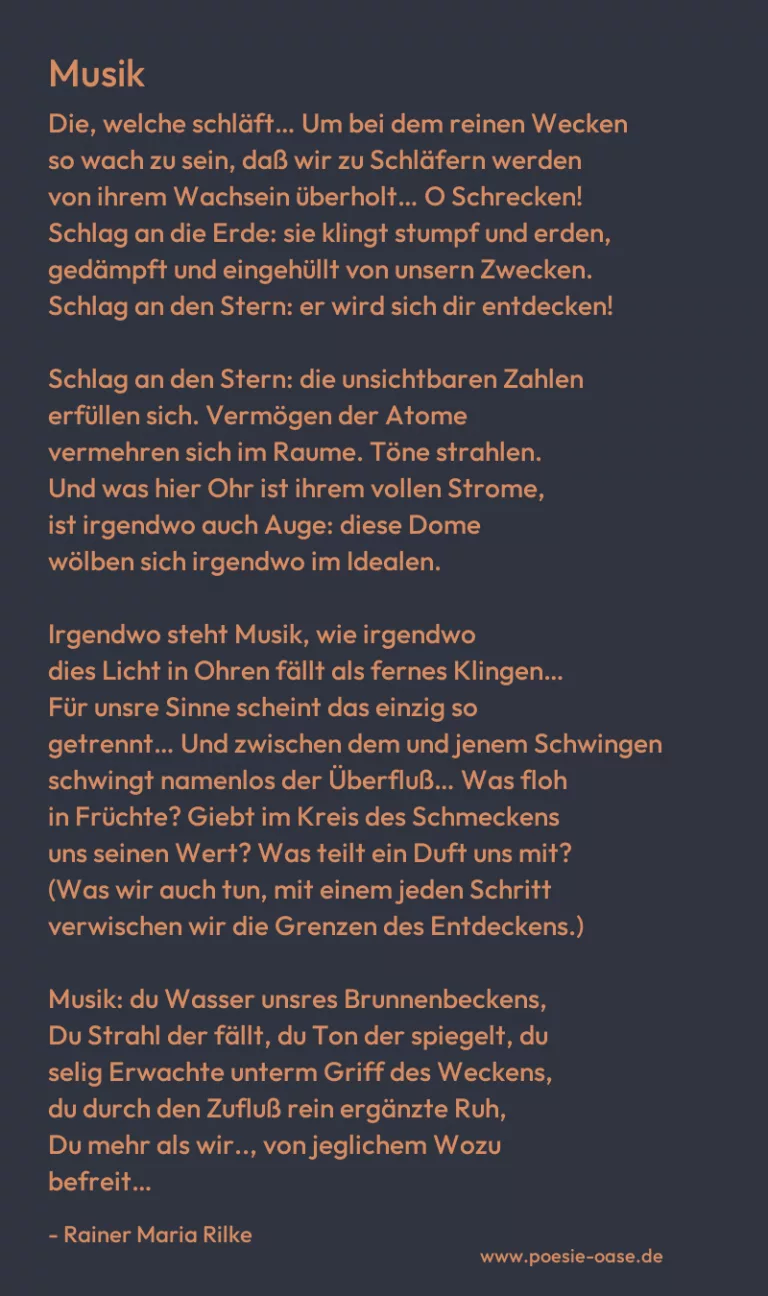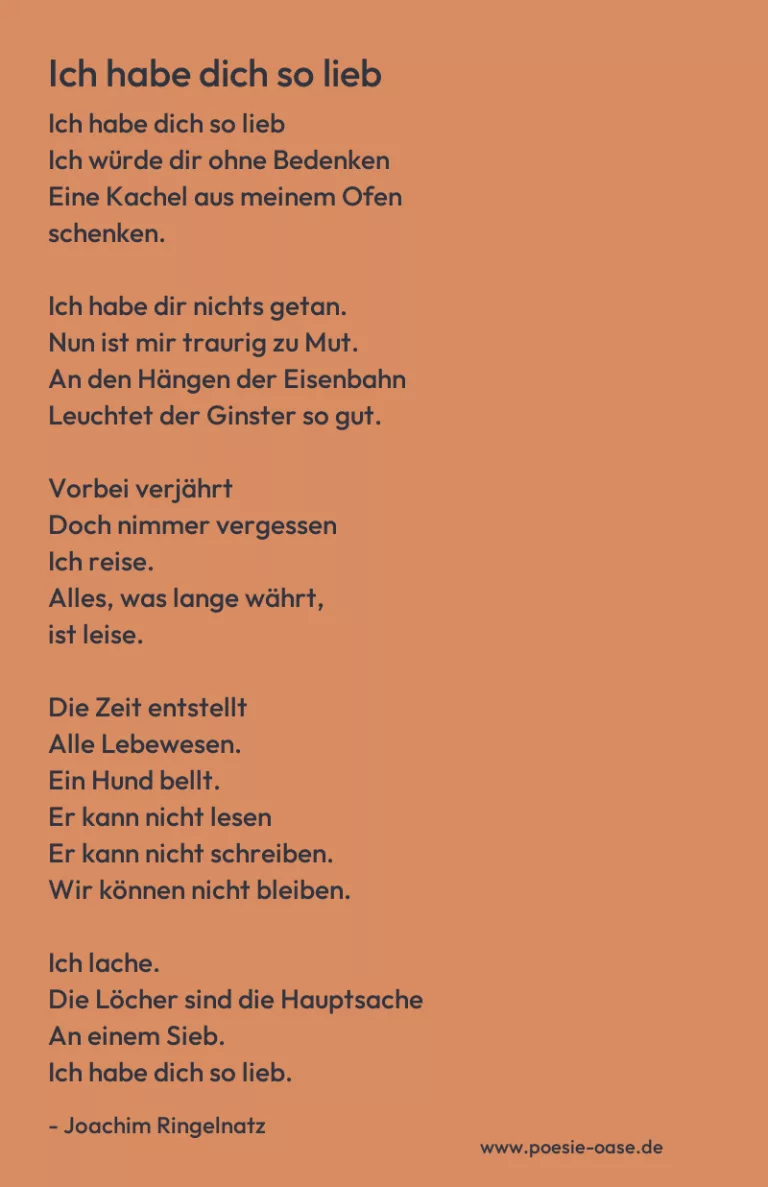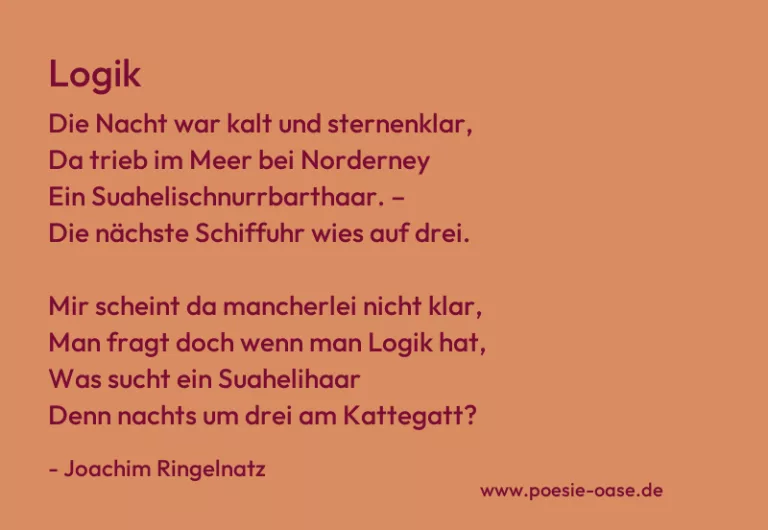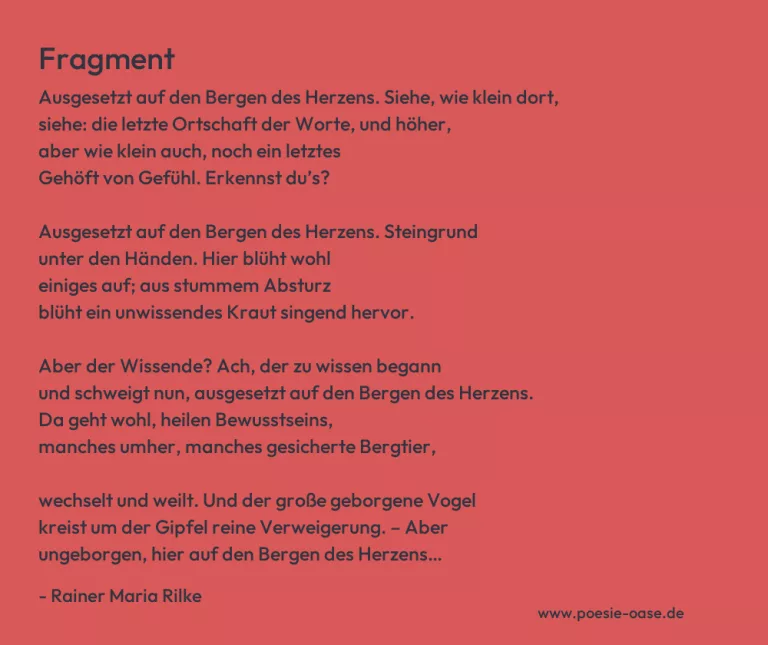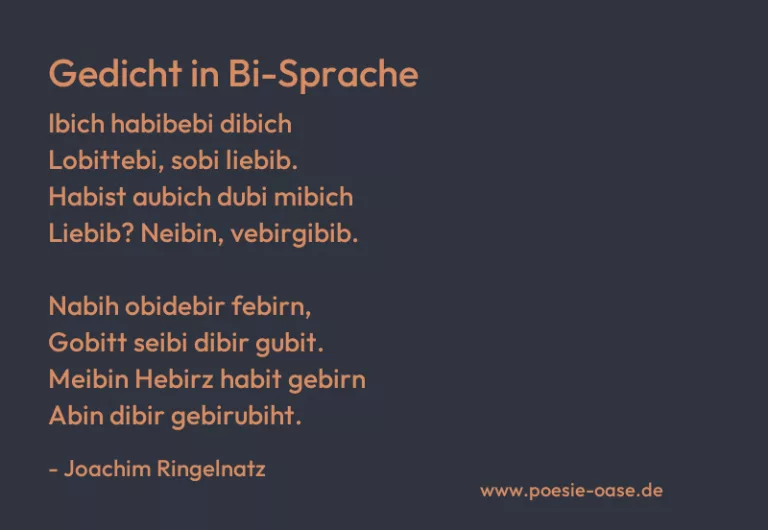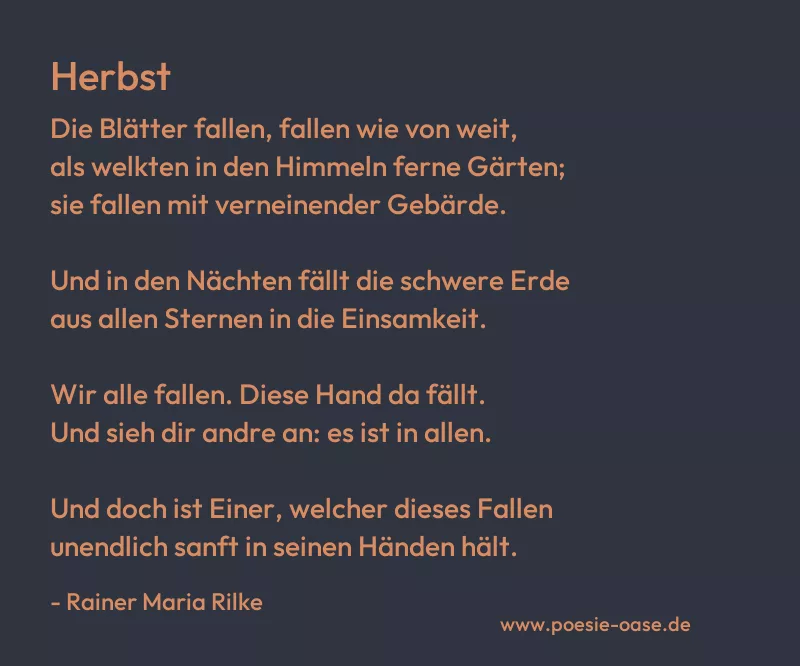Herbst
Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
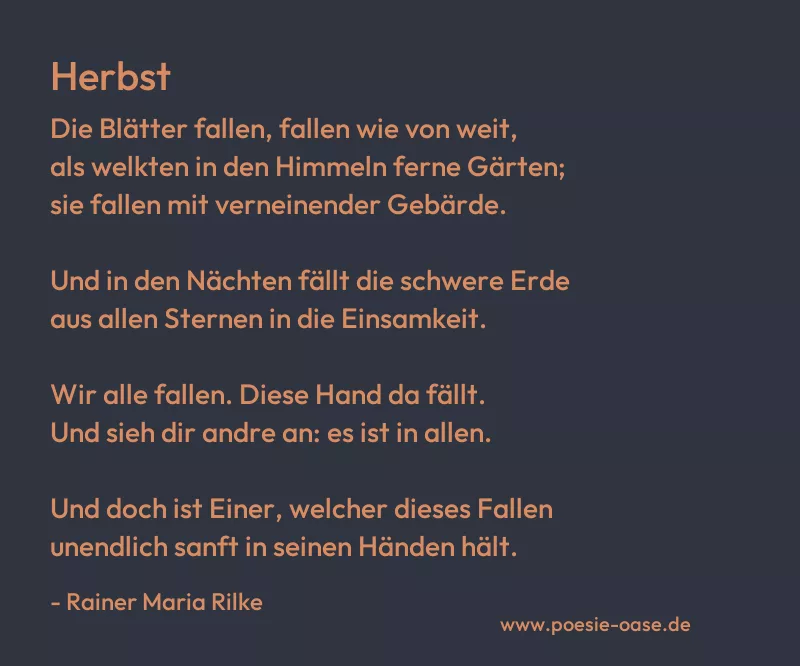
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Herbst“ von Rainer Maria Rilke thematisiert die Vergänglichkeit und den natürlichen Zyklus von Leben und Tod, der in der Jahreszeit des Herbstes besonders symbolträchtig wird. Zu Beginn beschreibt der Sprecher, wie die Blätter „fallen, fallen wie von weit“, was auf eine tiefe, fast unerreichbare Distanz hinweist. Das Bild des fallenden Laubs verweist auf das unvermeidliche Ende des Lebenszyklus und den Übergang in die Dunkelheit des Winters. Die Blätter fallen „mit verneinender Gebärde“, was bedeutet, dass der Herbst, symbolisch für das Ende, eine ablehnende Haltung gegenüber dem Leben und dem Wachstum einnimmt – eine Aufforderung, den natürlichen Verlauf der Dinge zu akzeptieren.
Die zweite Strophe bringt eine düstere, fast kosmische Perspektive ins Gedicht, wenn Rilke beschreibt, wie „die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit fällt“. Hier wird der Herbst zu einem existenziellen Bild für das Fallen und Vergehen von allem, was lebt. Die „schwere Erde“ kann als Metapher für die Last des Lebens und die Schwere des Endes verstanden werden, die aus den Weiten des Universums in die Einsamkeit der Existenz sinkt. Dieser Moment des „Falles“ ist nicht nur ein irdischer, sondern ein kosmischer Vorgang, der uns alle betrifft und in die Leere führt.
In der dritten Strophe wird das „Fallen“ zum universellen Prinzip erhoben. Der Sprecher sagt: „Wir alle fallen“, was die Vergänglichkeit des Menschen und seiner Existenz betont. Der Fall der „Hand“ und der Hinweis auf „andere“, die ebenfalls fallen, verdeutlichen, dass jeder Mensch, jede Lebensform diesem unvermeidlichen Prozess unterworfen ist. Es gibt keinen Ausweg vor der Vergänglichkeit, sie betrifft alles und jeden. Die Allgegenwart des Falls in allen Lebensbereichen wird durch den wiederholten Gebrauch des Verbs „fallen“ verstärkt.
Trotz der Schwere des Themas schließt das Gedicht mit einer tröstlichen Perspektive: „Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält“. Diese Zeile führt eine metaphysische Dimension ein, in der der „Eine“, der „sanft“ das Fallen hält, als Symbol für das Göttliche oder das Universelle interpretiert werden kann. Hier wird das Bild eines höheren Wesens, das das Unvermeidliche mit Güte und Sanftmut aufnimmt, geschaffen. Diese Präsenz bietet Trost und Akzeptanz für die Vergänglichkeit und den Fall, der das Leben prägt. Rilke zeigt uns, dass, obwohl alles fällt und vergeht, es eine höhere Kraft gibt, die das Fallen mit einer liebevollen Umarmung aufnimmt – ein Symbol für das Vertrauen in den natürlichen Verlauf des Lebens.
Insgesamt ist „Herbst“ ein Gedicht über die Unausweichlichkeit der Vergänglichkeit, das uns auffordert, das Fallen als Teil eines größeren, von einer sanften Hand getragenen Prozesses zu akzeptieren. Rilkes Sprache bietet sowohl eine Meditation über den Tod als auch eine tröstliche Vision von Geborgenheit im Angesicht des Vergehens.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.