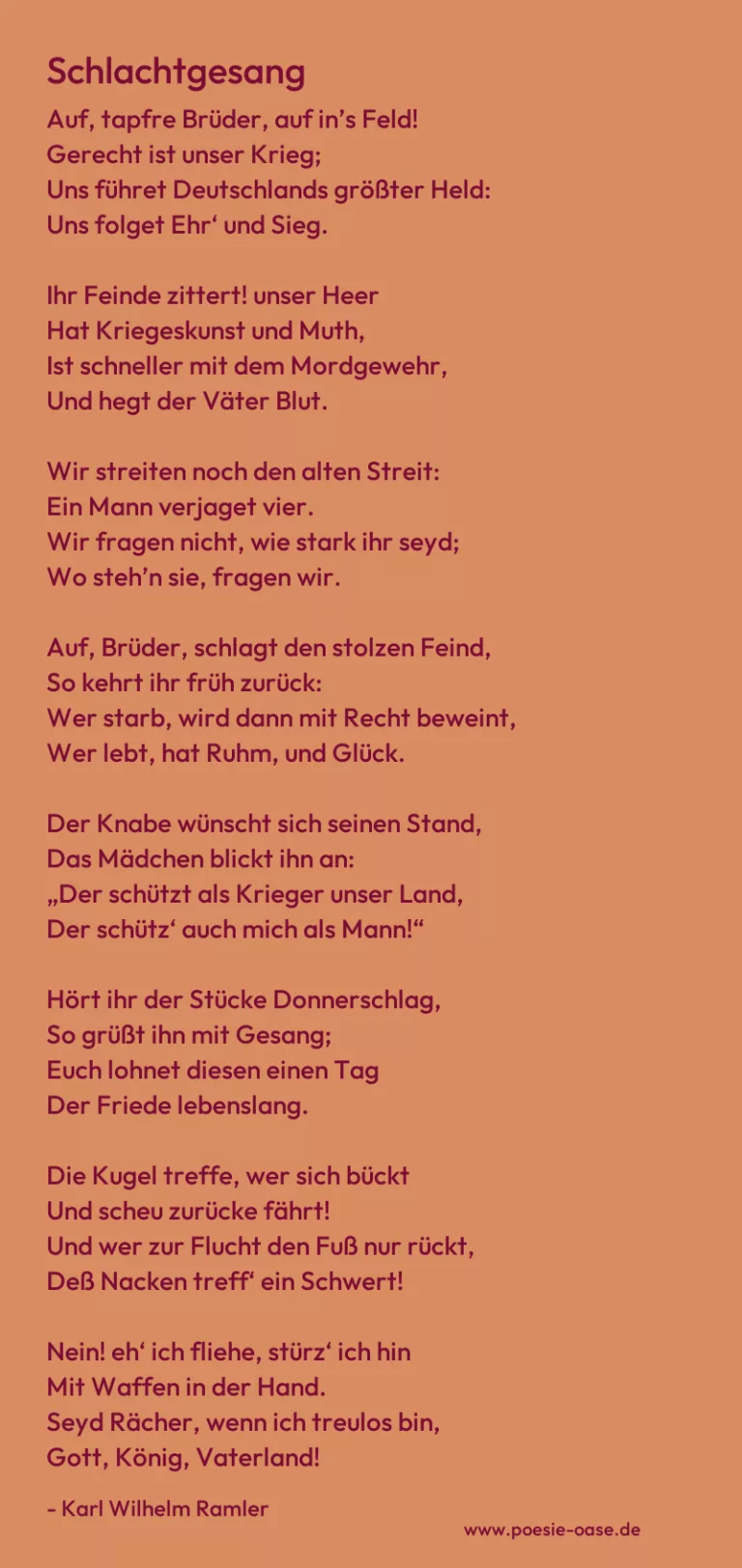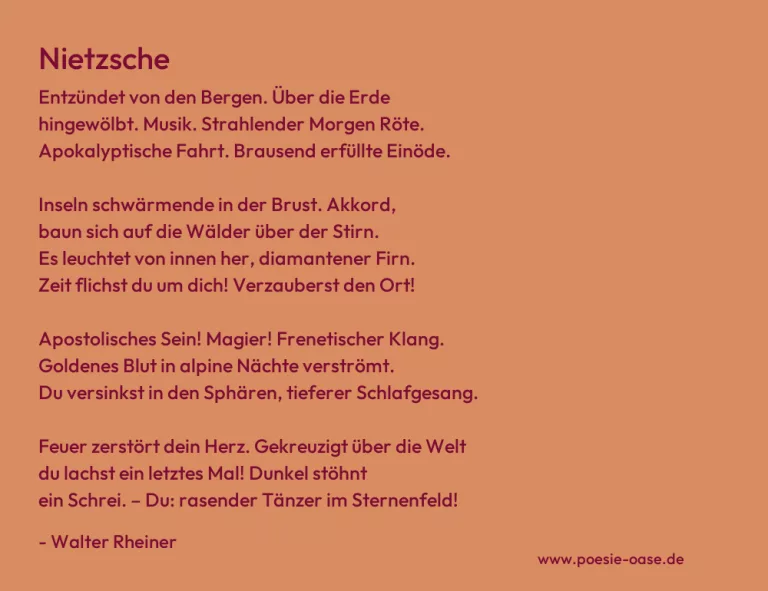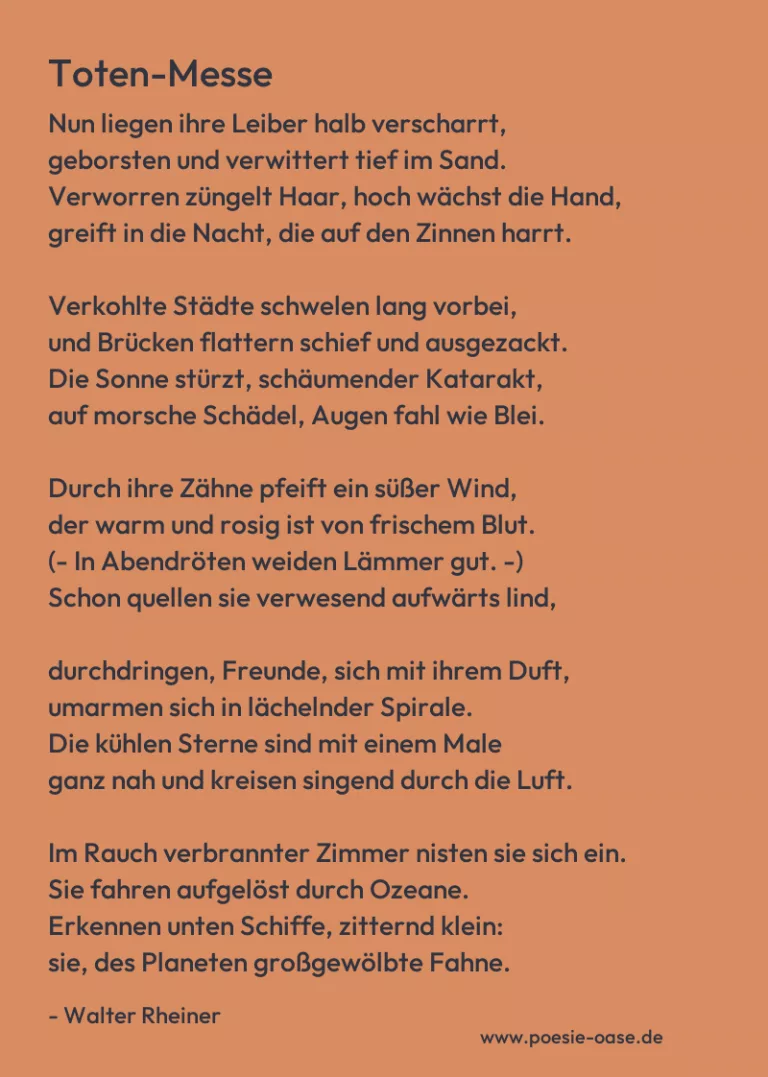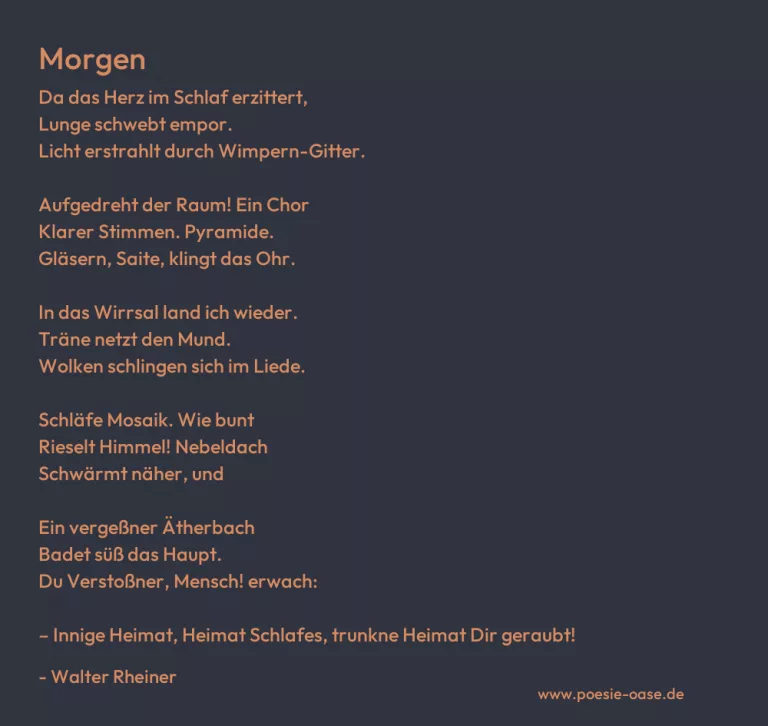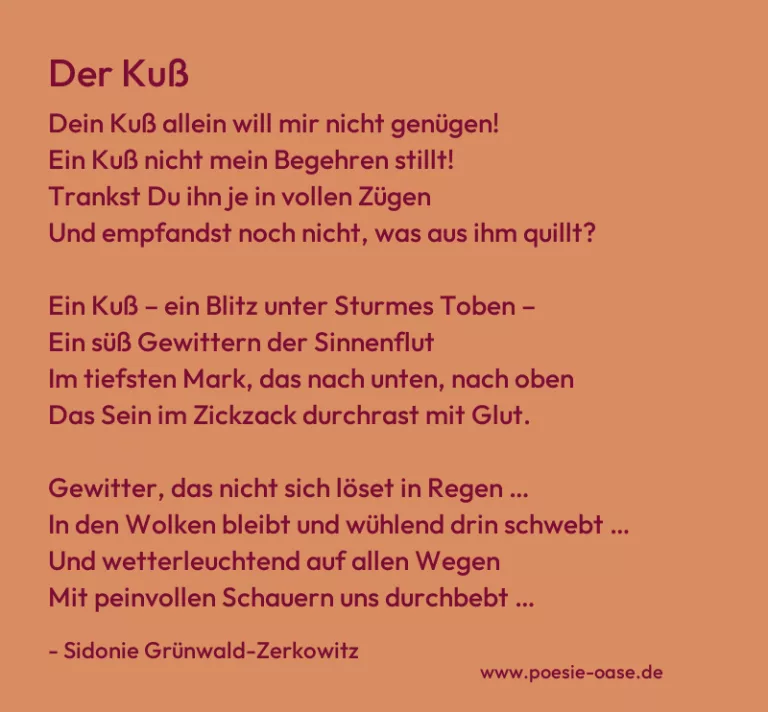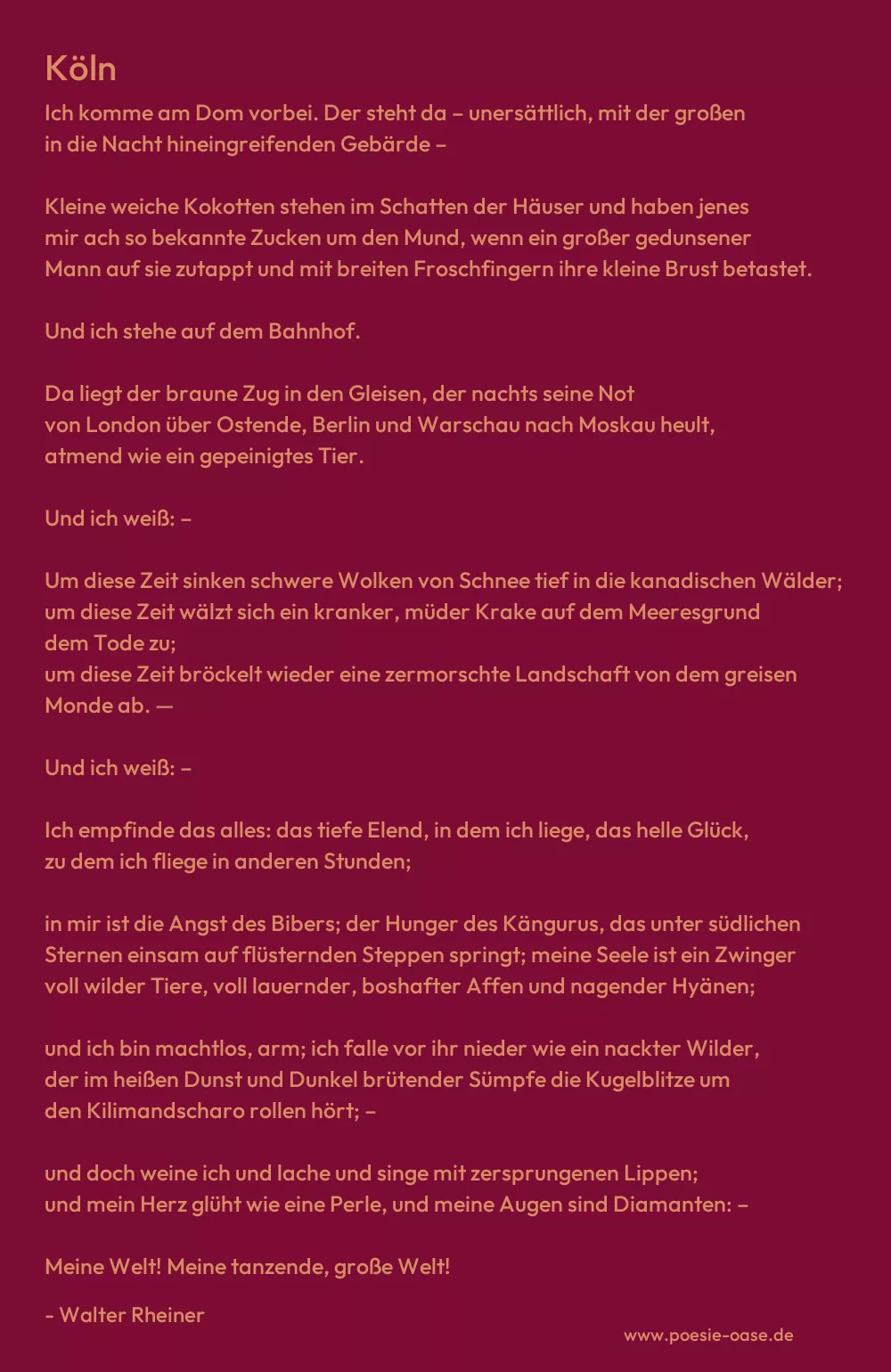Ich komme am Dom vorbei. Der steht da – unersättlich, mit der großen
in die Nacht hineingreifenden Gebärde –
Kleine weiche Kokotten stehen im Schatten der Häuser und haben jenes
mir ach so bekannte Zucken um den Mund, wenn ein großer gedunsener
Mann auf sie zutappt und mit breiten Froschfingern ihre kleine Brust betastet.
Und ich stehe auf dem Bahnhof.
Da liegt der braune Zug in den Gleisen, der nachts seine Not
von London über Ostende, Berlin und Warschau nach Moskau heult,
atmend wie ein gepeinigtes Tier.
Und ich weiß: –
Um diese Zeit sinken schwere Wolken von Schnee tief in die kanadischen Wälder;
um diese Zeit wälzt sich ein kranker, müder Krake auf dem Meeresgrund
dem Tode zu;
um diese Zeit bröckelt wieder eine zermorschte Landschaft von dem greisen
Monde ab. —
Und ich weiß: –
Ich empfinde das alles: das tiefe Elend, in dem ich liege, das helle Glück,
zu dem ich fliege in anderen Stunden;
in mir ist die Angst des Bibers; der Hunger des Kängurus, das unter südlichen
Sternen einsam auf flüsternden Steppen springt; meine Seele ist ein Zwinger
voll wilder Tiere, voll lauernder, boshafter Affen und nagender Hyänen;
und ich bin machtlos, arm; ich falle vor ihr nieder wie ein nackter Wilder,
der im heißen Dunst und Dunkel brütender Sümpfe die Kugelblitze um
den Kilimandscharo rollen hört; –
und doch weine ich und lache und singe mit zersprungenen Lippen;
und mein Herz glüht wie eine Perle, und meine Augen sind Diamanten: –
Meine Welt! Meine tanzende, große Welt!