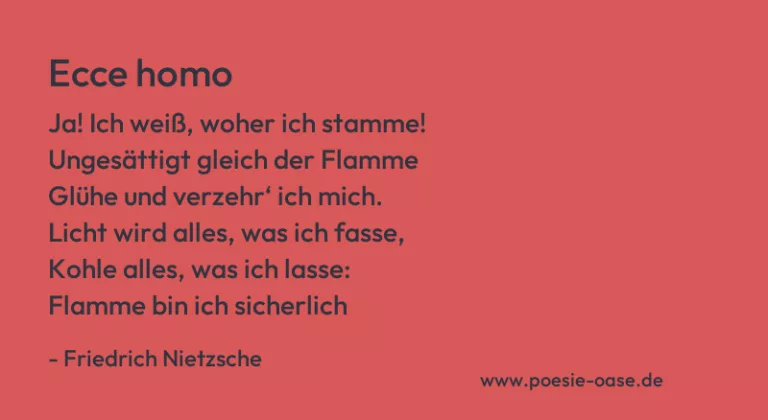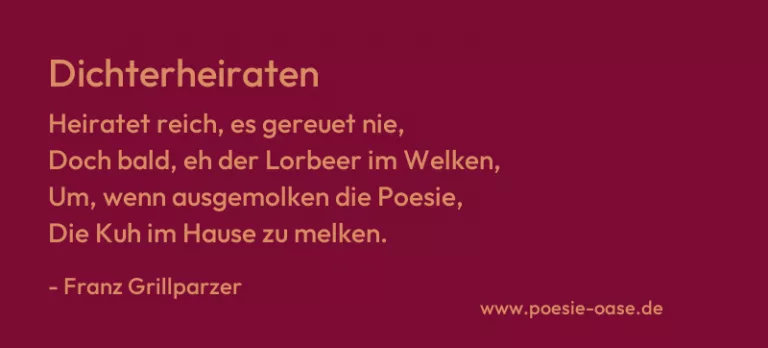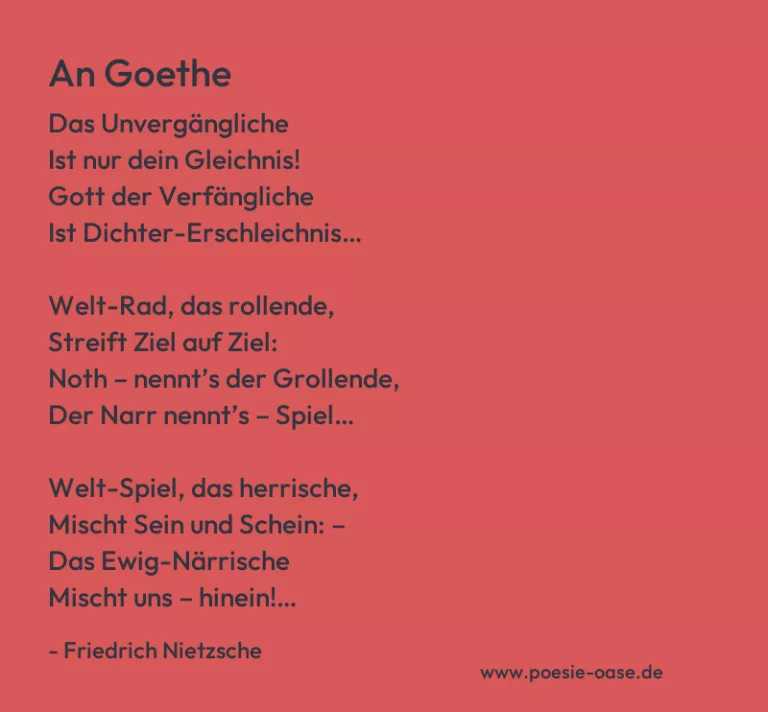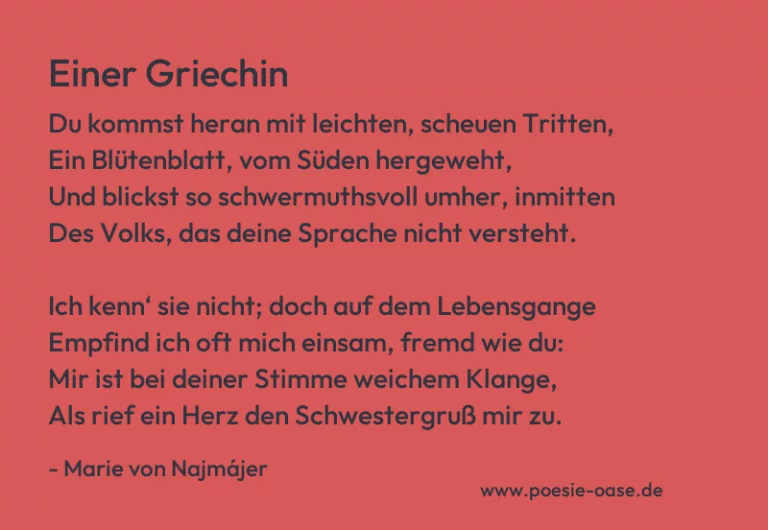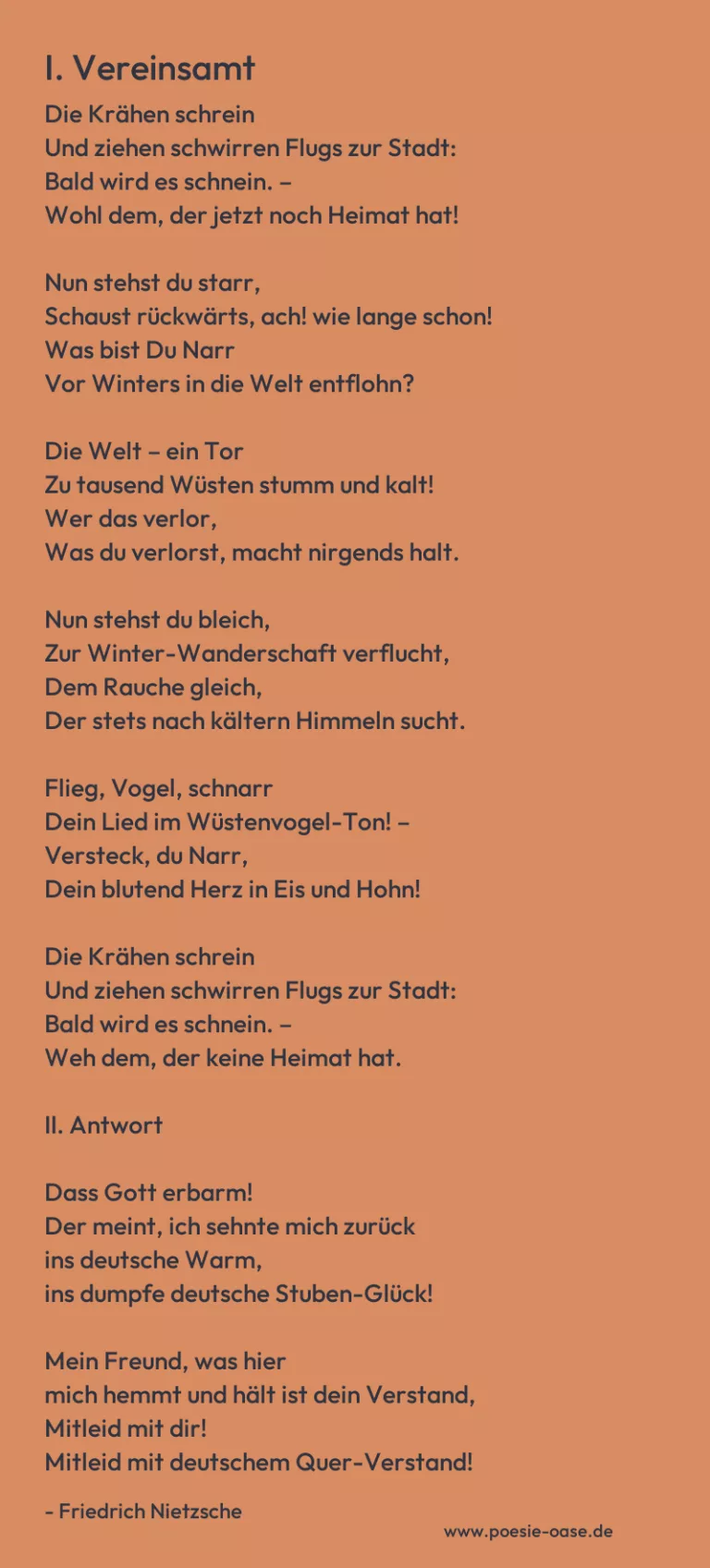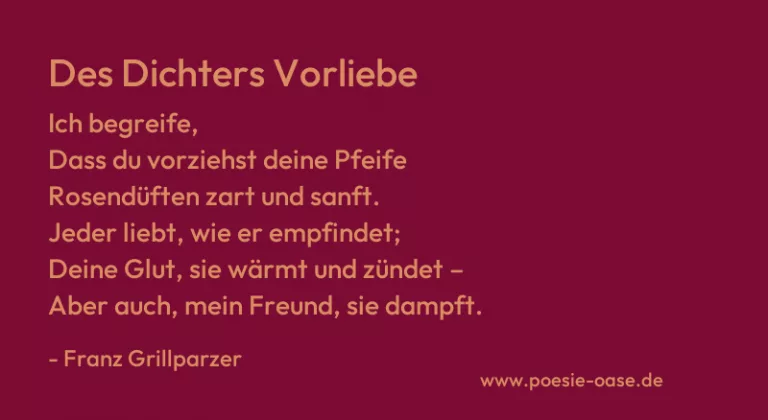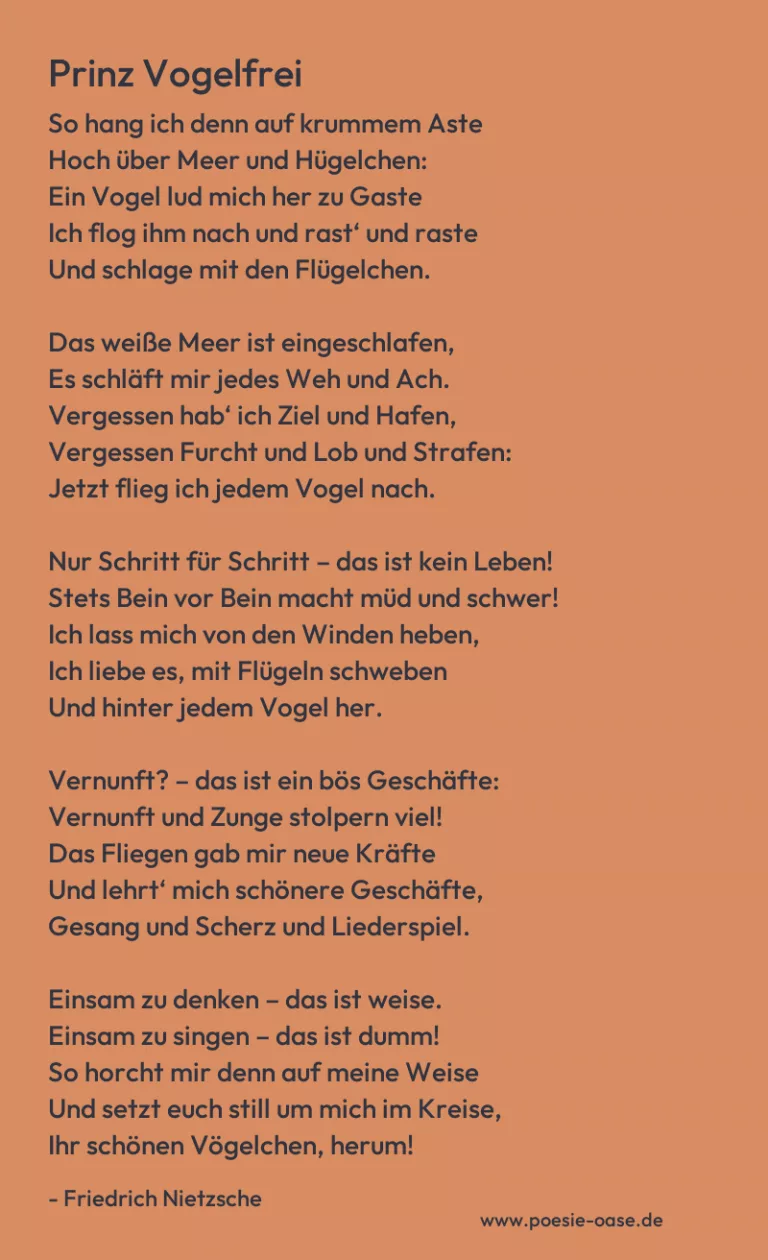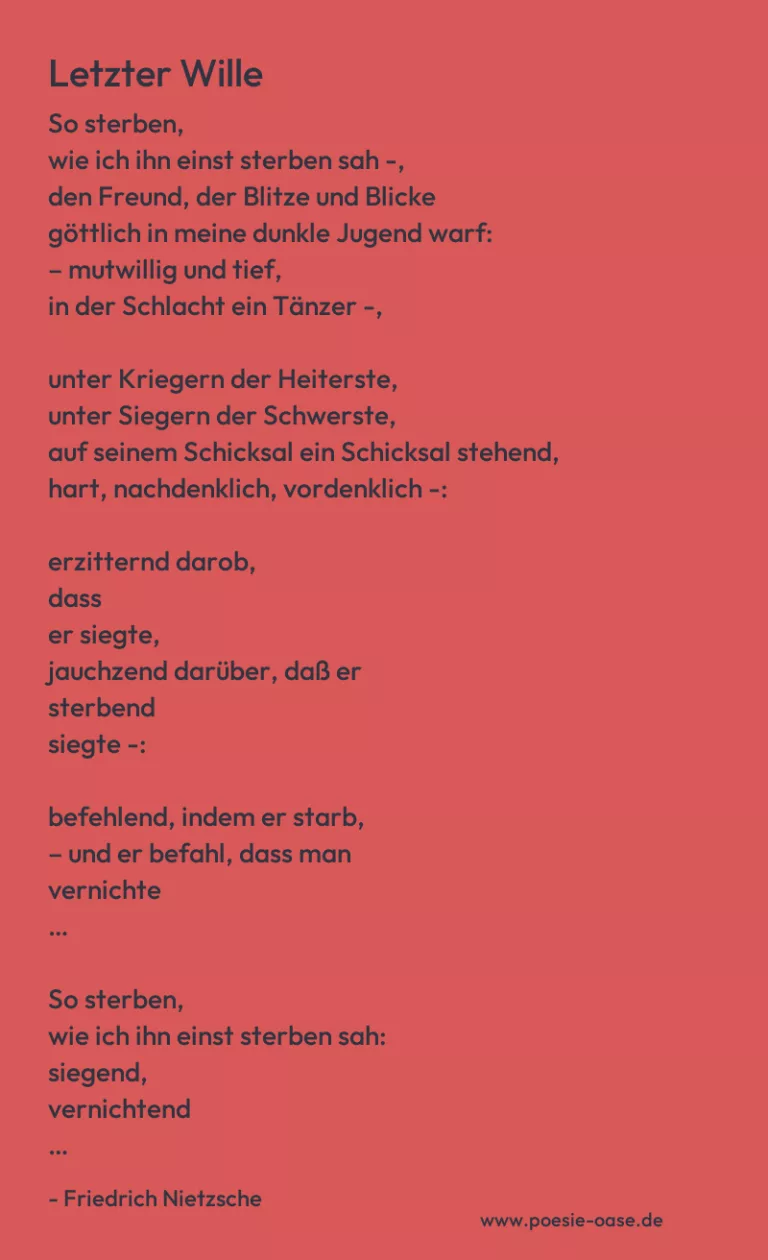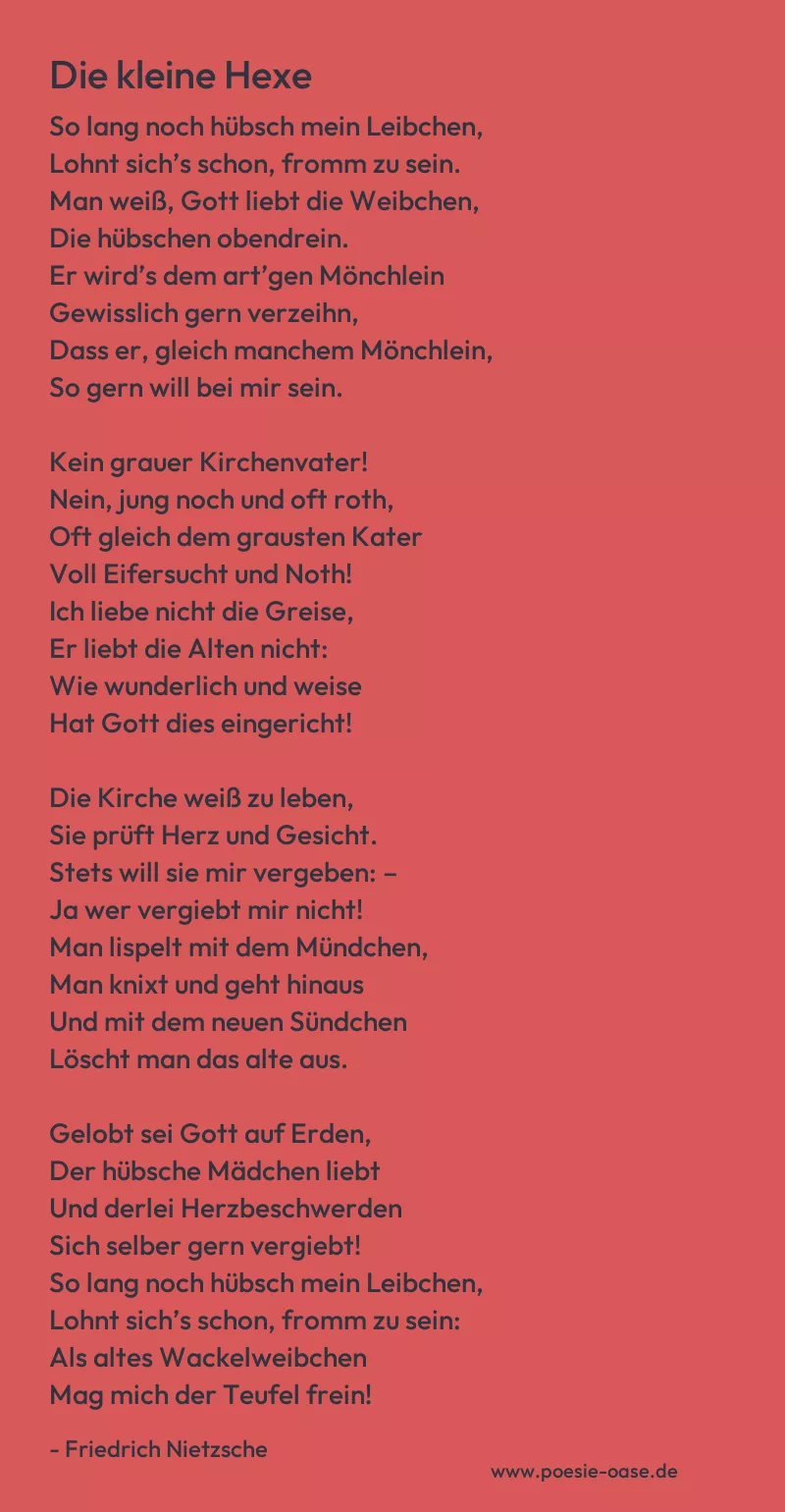So lang noch hübsch mein Leibchen,
Lohnt sich’s schon, fromm zu sein.
Man weiß, Gott liebt die Weibchen,
Die hübschen obendrein.
Er wird’s dem art’gen Mönchlein
Gewisslich gern verzeihn,
Dass er, gleich manchem Mönchlein,
So gern will bei mir sein.
Kein grauer Kirchenvater!
Nein, jung noch und oft roth,
Oft gleich dem grausten Kater
Voll Eifersucht und Noth!
Ich liebe nicht die Greise,
Er liebt die Alten nicht:
Wie wunderlich und weise
Hat Gott dies eingericht!
Die Kirche weiß zu leben,
Sie prüft Herz und Gesicht.
Stets will sie mir vergeben: –
Ja wer vergiebt mir nicht!
Man lispelt mit dem Mündchen,
Man knixt und geht hinaus
Und mit dem neuen Sündchen
Löscht man das alte aus.
Gelobt sei Gott auf Erden,
Der hübsche Mädchen liebt
Und derlei Herzbeschwerden
Sich selber gern vergiebt!
So lang noch hübsch mein Leibchen,
Lohnt sich’s schon, fromm zu sein:
Als altes Wackelweibchen
Mag mich der Teufel frein!