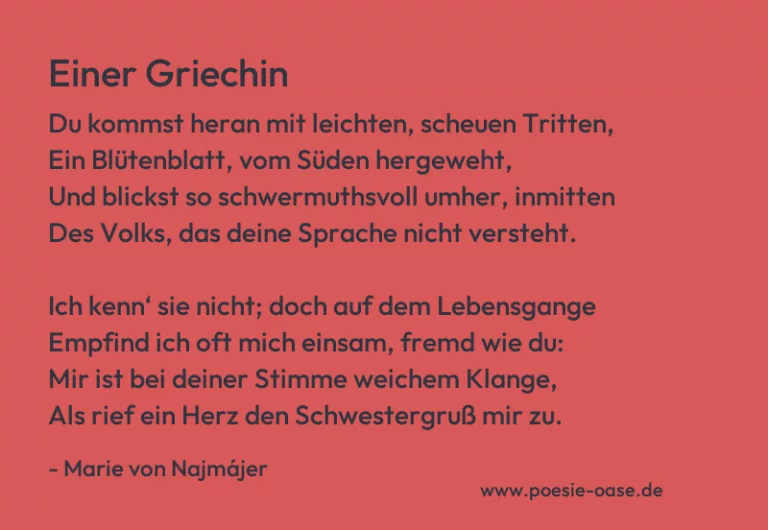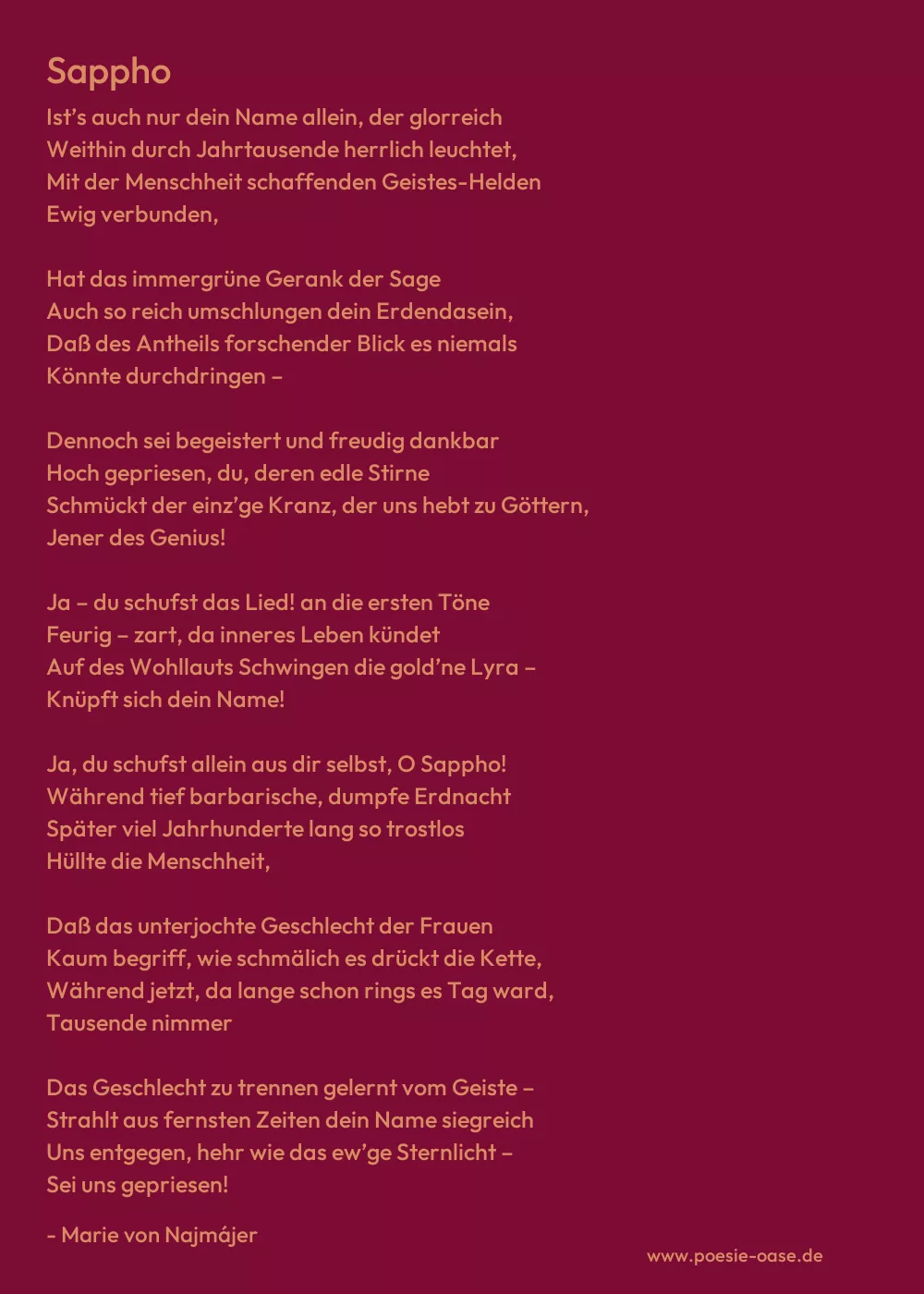Sappho
Ist’s auch nur dein Name allein, der glorreich
Weithin durch Jahrtausende herrlich leuchtet,
Mit der Menschheit schaffenden Geistes-Helden
Ewig verbunden,
Hat das immergrüne Gerank der Sage
Auch so reich umschlungen dein Erdendasein,
Daß des Antheils forschender Blick es niemals
Könnte durchdringen –
Dennoch sei begeistert und freudig dankbar
Hoch gepriesen, du, deren edle Stirne
Schmückt der einz’ge Kranz, der uns hebt zu Göttern,
Jener des Genius!
Ja – du schufst das Lied! an die ersten Töne
Feurig – zart, da inneres Leben kündet
Auf des Wohllauts Schwingen die gold’ne Lyra –
Knüpft sich dein Name!
Ja, du schufst allein aus dir selbst, O Sappho!
Während tief barbarische, dumpfe Erdnacht
Später viel Jahrhunderte lang so trostlos
Hüllte die Menschheit,
Daß das unterjochte Geschlecht der Frauen
Kaum begriff, wie schmälich es drückt die Kette,
Während jetzt, da lange schon rings es Tag ward,
Tausende nimmer
Das Geschlecht zu trennen gelernt vom Geiste –
Strahlt aus fernsten Zeiten dein Name siegreich
Uns entgegen, hehr wie das ew’ge Sternlicht –
Sei uns gepriesen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
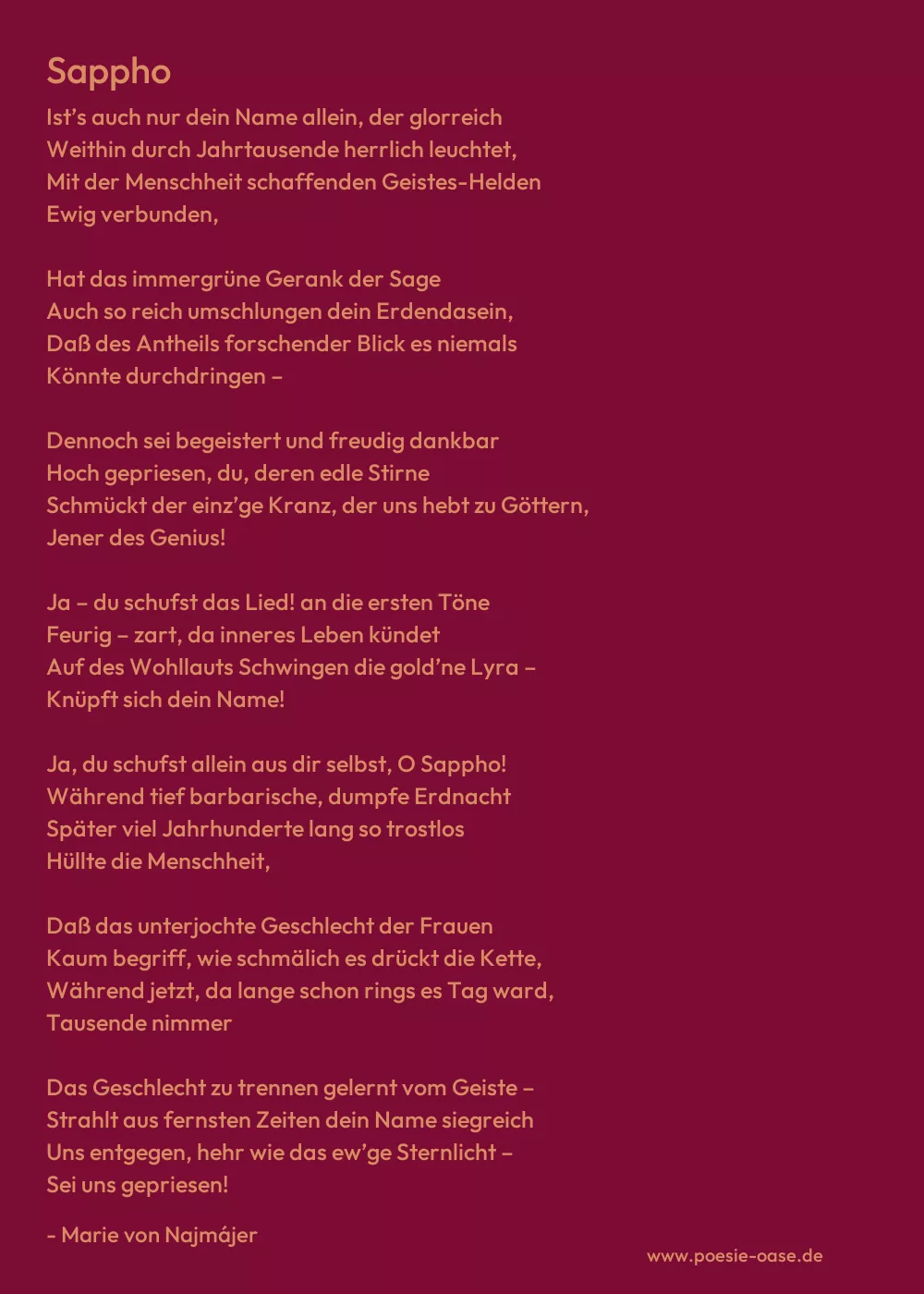
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sappho“ von Marie von Najmájer ist eine hymnische Würdigung der antiken Dichterin Sappho, deren Name und Bedeutung die Jahrtausende überdauert haben. Im Zentrum steht die Verehrung für eine weibliche Gestalt, die durch ihre schöpferische Kraft – insbesondere durch die Erfindung oder Veredelung des Liedes – als leuchtende Figur aus einer dunklen, patriarchal geprägten Vergangenheit herausragt. Die Dichtung verbindet dabei persönliche Bewunderung mit einer feministischen Botschaft.
Schon zu Beginn hebt Najmájer hervor, dass selbst dann, wenn nur der Name Sapphos überliefert wäre, dieser in einem Atemzug mit den großen „Geistes-Helden“ der Menschheit genannt werden müsste. Der Mythos um Sappho, in dichterischem Bild als „immergrünes Gerank der Sage“ beschrieben, verdeckt zwar ihr reales Leben, doch mindert dies in keiner Weise ihren geistigen Rang. Die Dichterin erkennt in Sappho eine Inspirationsquelle, deren Wirken – trotz mangelnder historischer Klarheit – unbestritten leuchtende Spuren hinterlässt.
Im Mittelpunkt steht der schöpferische Genius: Sappho wird als Urheberin des Liedes gepriesen, als jemand, der „allein aus sich selbst“ Kunst geschaffen hat – feurig und zart zugleich. Diese Zeilen feiern das kreative Selbstbewusstsein einer Frau, das sich gegen eine „dumpfe Erdnacht“ und die geistige Barbarei späterer Jahrhunderte behauptet. Besonders betont wird, dass Sapphos Werk in einer Zeit entstand, in der Frauen ansonsten kaum als geistige Schöpferinnen anerkannt oder gar unterdrückt wurden.
In den letzten Strophen weitet sich das Thema zur Kritik an der fortdauernden Geschlechtertrennung in geistigen Fragen. Obwohl die Welt „rings schon lange Tag“ geworden sei, also Aufklärung und Fortschritt erreicht wurden, hätten viele immer noch nicht verinnerlicht, dass Geist und Geschlecht untrennbar sind. Vor diesem Hintergrund erscheint Sapphos Name als Licht aus ferner Zeit, das noch immer Orientierung gibt und Mut macht. Die letzte Zeile schließt mit einem Aufruf zur Ehrung – „Sei uns gepriesen!“ – und verleiht dem Gedicht den Charakter einer poetischen Huldigung.
Marie von Najmájer gelingt mit „Sappho“ eine eindrucksvolle Verbindung von Mythos, persönlicher Bewunderung und kulturkritischem Impuls. Das Gedicht würdigt Sappho nicht nur als Dichterin, sondern als Symbol weiblicher Schöpfungskraft, die über Zeiten und Schranken hinweg ihre Wirkung entfaltet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.