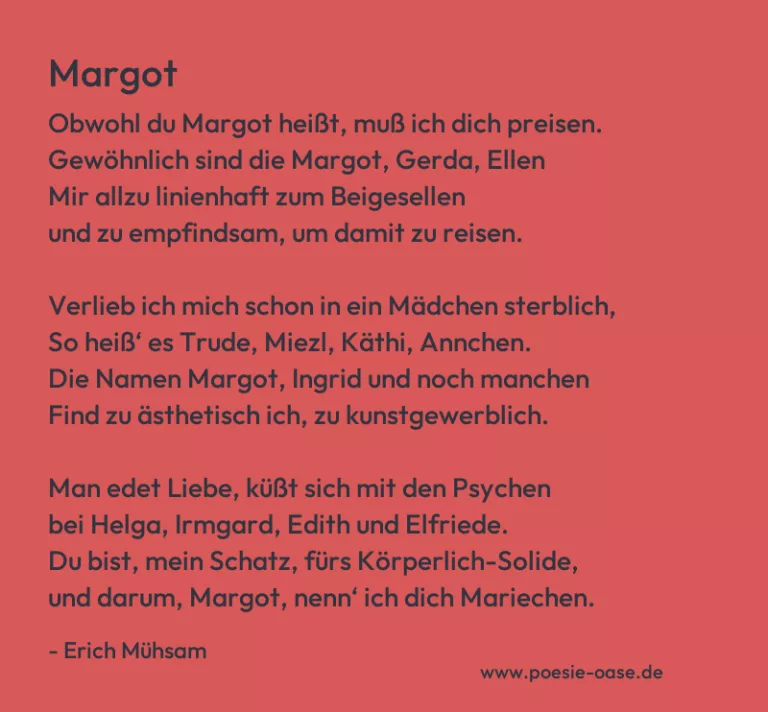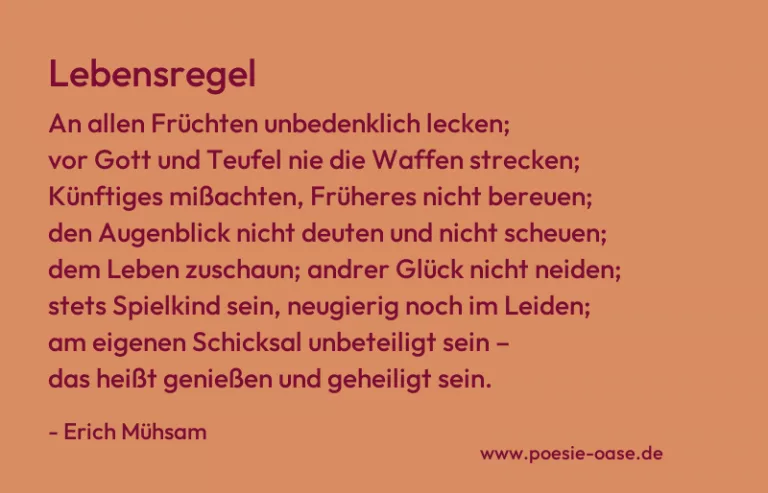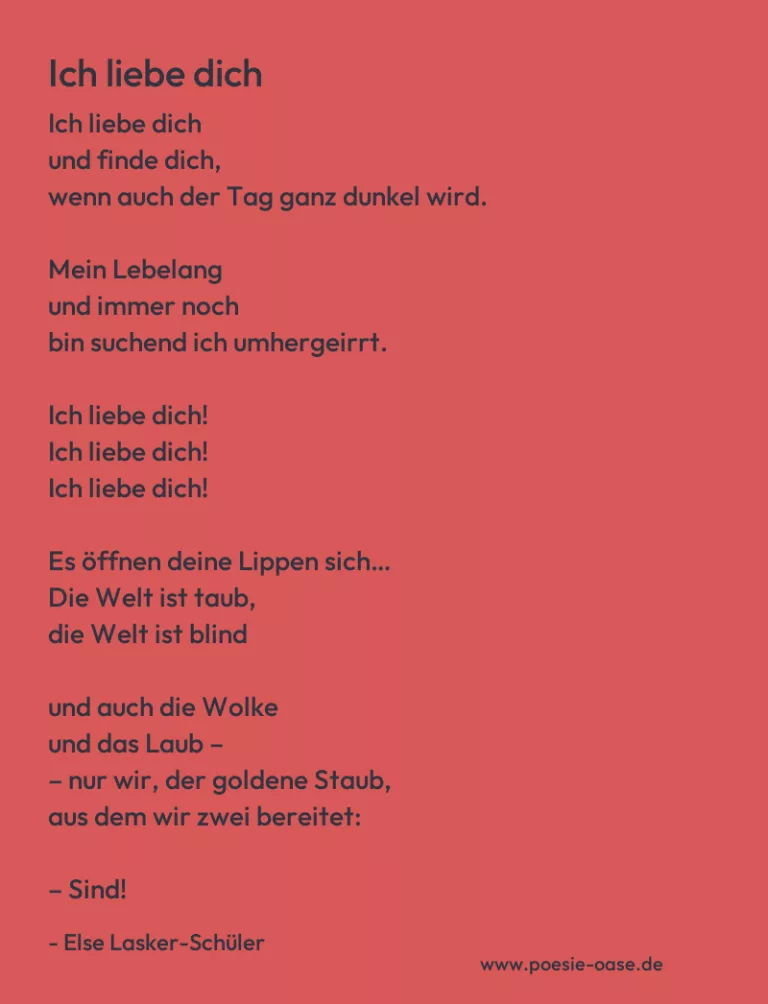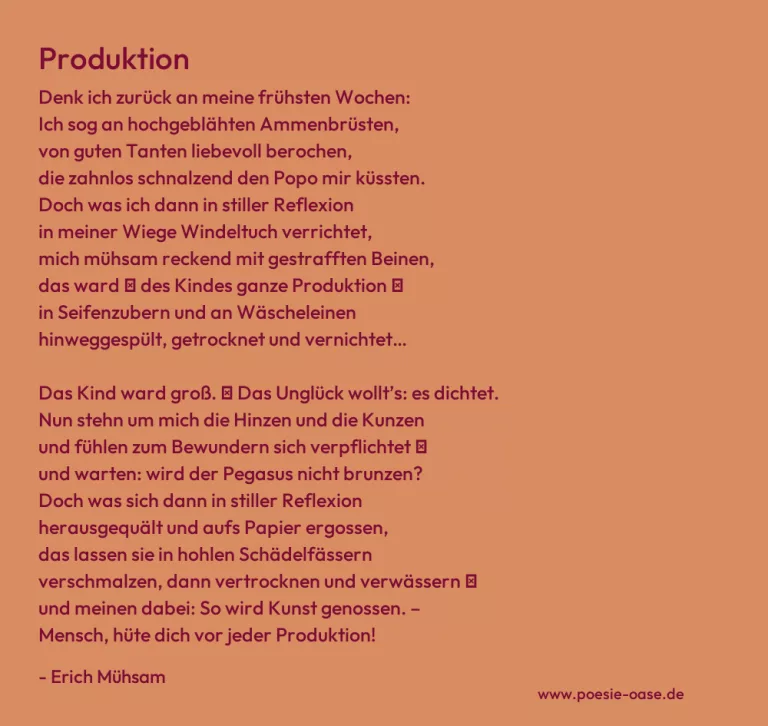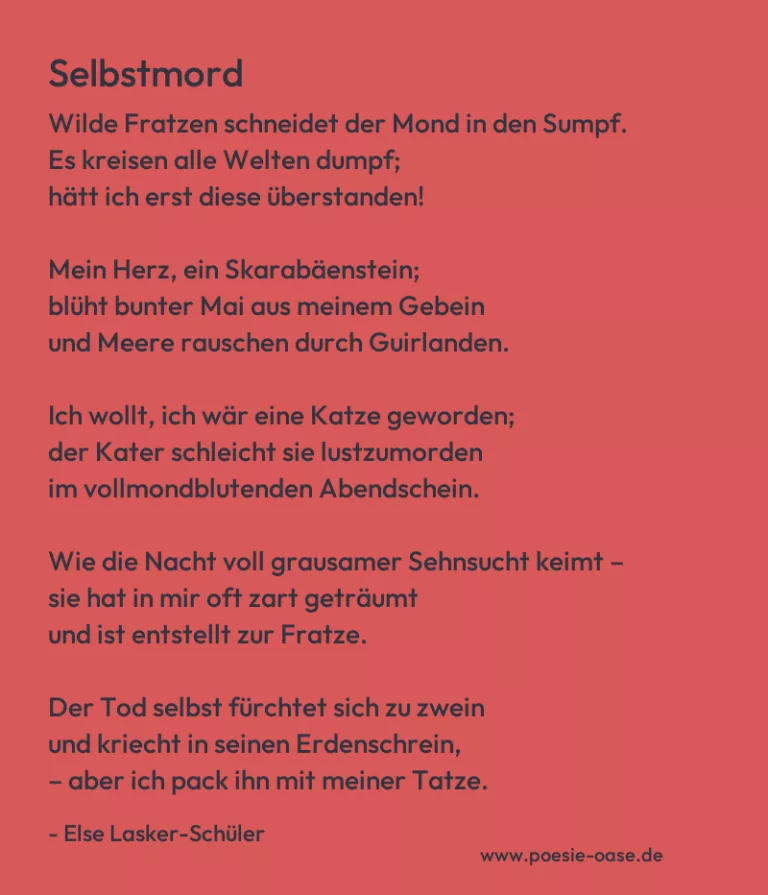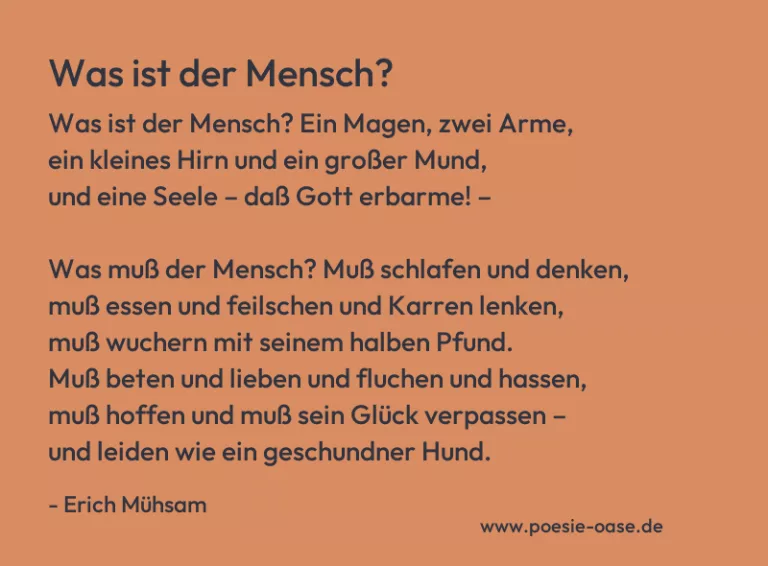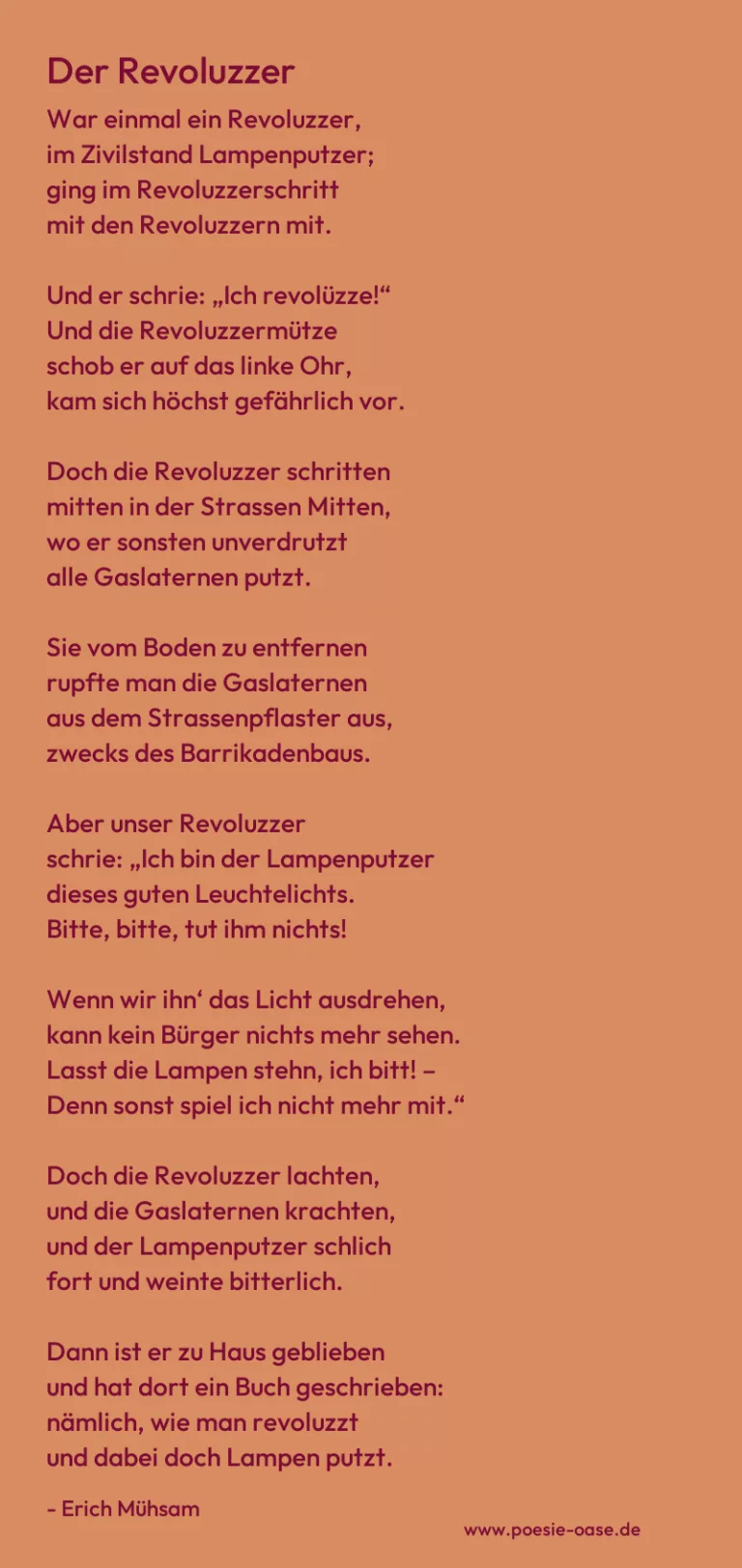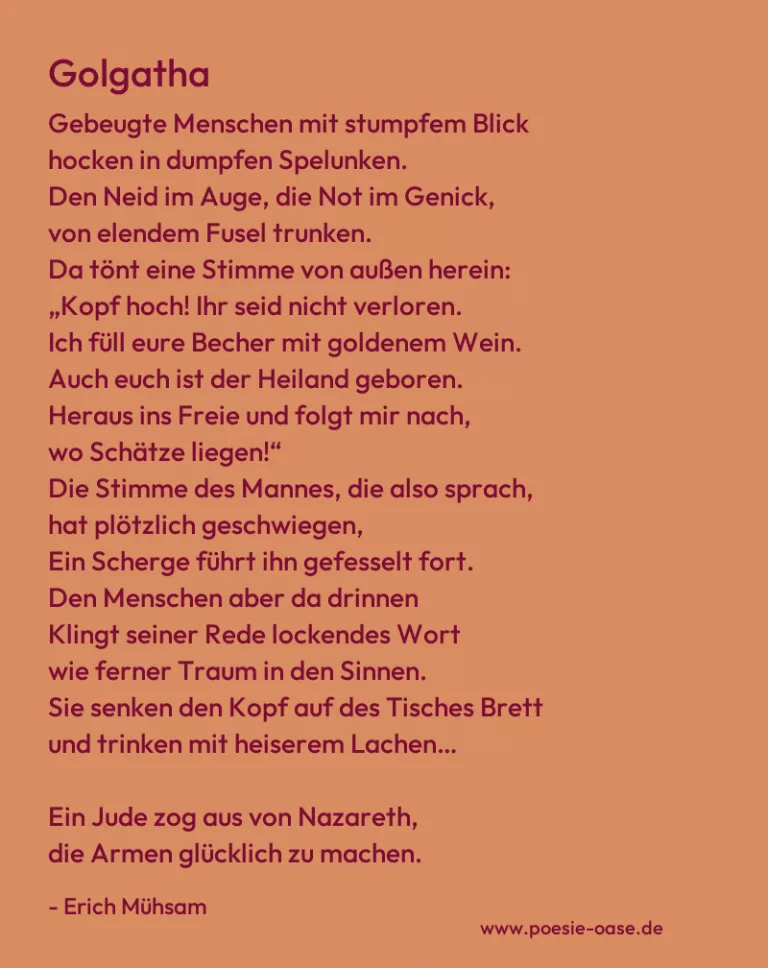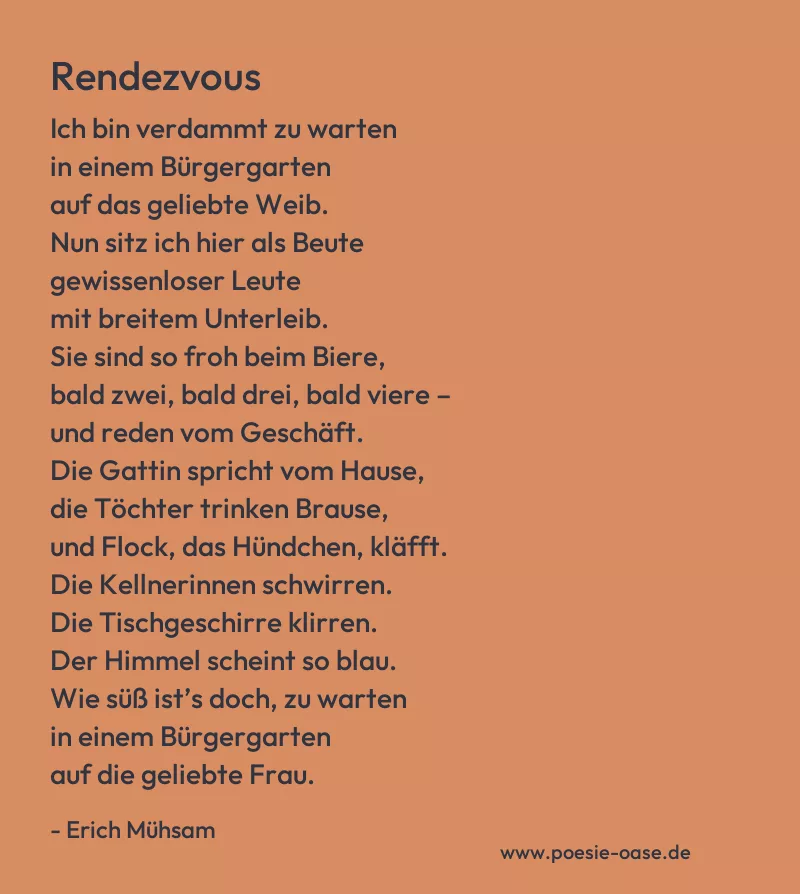Rendezvous
Ich bin verdammt zu warten
in einem Bürgergarten
auf das geliebte Weib.
Nun sitz ich hier als Beute
gewissenloser Leute
mit breitem Unterleib.
Sie sind so froh beim Biere,
bald zwei, bald drei, bald viere –
und reden vom Geschäft.
Die Gattin spricht vom Hause,
die Töchter trinken Brause,
und Flock, das Hündchen, kläfft.
Die Kellnerinnen schwirren.
Die Tischgeschirre klirren.
Der Himmel scheint so blau.
Wie süß ist’s doch, zu warten
in einem Bürgergarten
auf die geliebte Frau.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
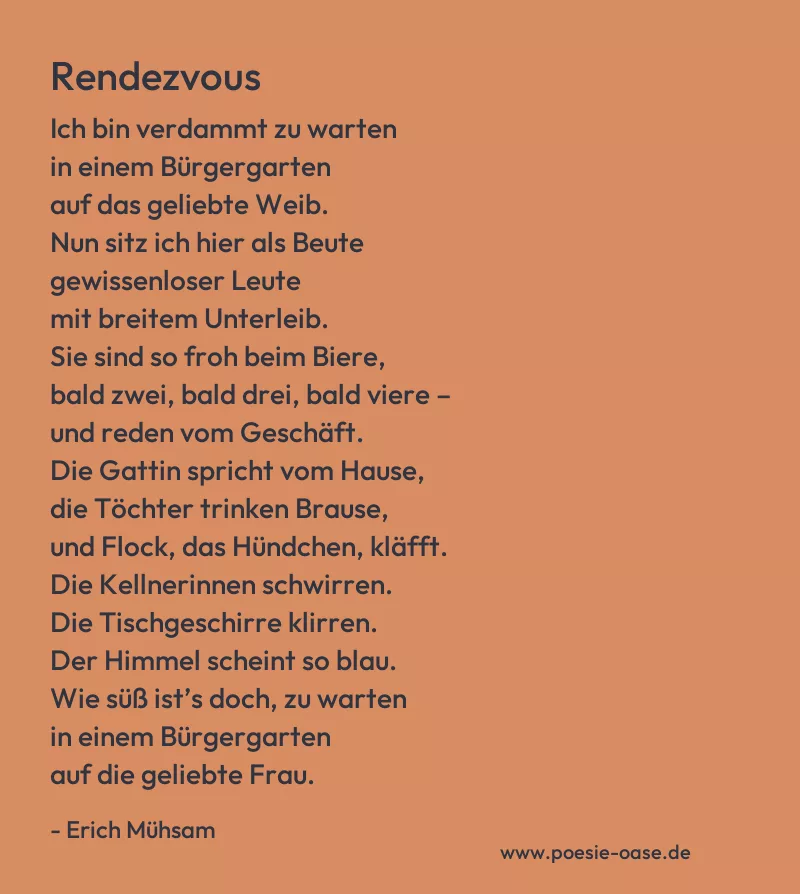
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Rendezvous“ von Erich Mühsam vermittelt auf humorvolle und leicht ironische Weise die Frustration und das Warten des lyrischen Ichs auf seine geliebte Frau. Zu Beginn des Gedichts beschreibt der Sprecher seine Position als „verdammte[r]“ Wartende, der in einem „Bürgergarten“ sitzt, einem Ort, der von Alltäglichkeit und Normalität geprägt ist. Der Garten, ein öffentlicher Raum, ist ein Kontrast zu den hohen Erwartungen und Sehnsüchten, die der Sprecher bezüglich seiner Frau hat. Das Bild des Wartens wird durch die Beschreibung der Umgebung verstärkt: Er fühlt sich als „Beute gewissenloser Leute“ – eine Metapher, die das Gefühl von Ausgesetztheit und Unverstandensein widerspiegelt, während er auf seine Partnerin wartet.
Die Szenerie, die der Sprecher beschreibt, ist von banalen, fast trivialen Ereignissen geprägt: Männer trinken Bier, unterhalten sich über das Geschäft, während Frauen sich über das Haus und die Kinder austauschen, und das Hundchen „Flock“ kläfft. Diese scheinbar alltäglichen Gespräche und Handlungen kontrastieren mit der inneren Erwartung des Sprechers, der auf etwas Bedeutungsvolles und Liebesvolles wartet. Die Schilderung der Umgebung ist von einer gewissen Gleichgültigkeit und Trivialität durchzogen, was den Sprecher in seiner Rolle als geduldiger, aber enttäuschter Wartender noch hilfloser erscheinen lässt.
Trotz der Hektik und Oberflächlichkeit der Szene hält der Sprecher fest an seiner Erwartung. Das Bild des „blauen Himmels“ am Ende der Strophe wirkt wie eine ironische Überhöhung der Situation. Der Himmel, der normalerweise ein Symbol für Freiheit und Weite ist, wird hier mit einer etwas süßlichen, fast sarkastischen Tonalität verbunden – als würde der Sprecher die Situation in ihrer Unbeholfenheit akzeptieren, aber dennoch eine gewisse Resignation darüber empfinden.
Am Ende des Gedichts bringt der Sprecher das paradoxe Gefühl des Wartens auf den Punkt: „Wie süß ist’s doch, zu warten / in einem Bürgergarten / auf die geliebte Frau.“ Diese letzten Zeilen enthalten eine tiefe Ironie, da das Warten in der scheinbar belanglosen Umgebung nicht als Quelle von Erfüllung und Freude dargestellt wird, sondern als ein süß-sauer empfundener Zustand der Erwartung. Das Warten wird hier als bittersüß und fast selbstquälerisch beschrieben, was auf die Komplexität der Beziehung und die Disparität zwischen den eigenen Erwartungen und der Realität hinweist.
Erich Mühsam schafft es in diesem Gedicht, das scheinbar banale Motiv des Wartens mit einer tiefen Ironie und einem subtilen Humor zu versehen. Die Darstellung des Wartens als fast schon quälenden Zustand in einem „Bürgergarten“, umgeben von Trivialitäten, zeigt die Entfremdung und die Uneindeutigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen, insbesondere in der Liebe.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.