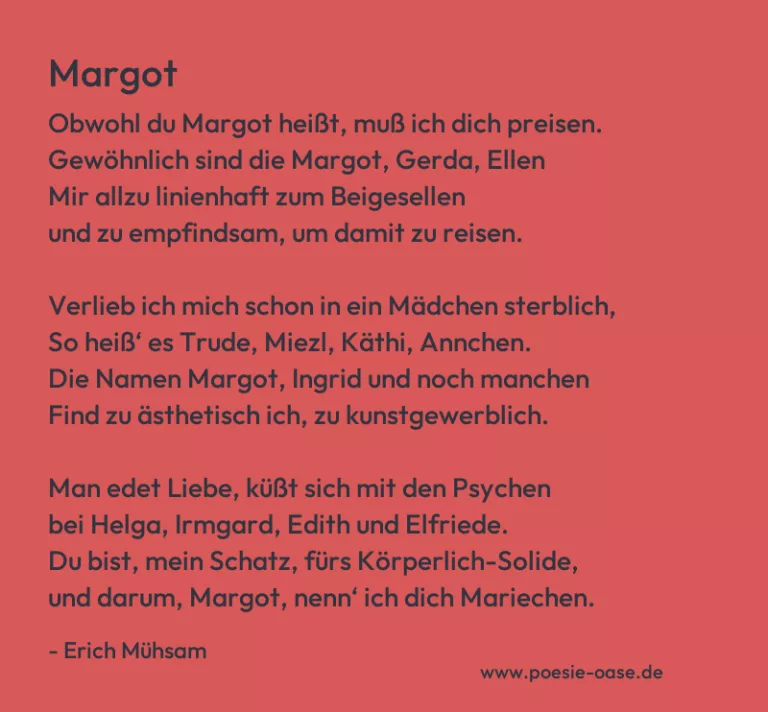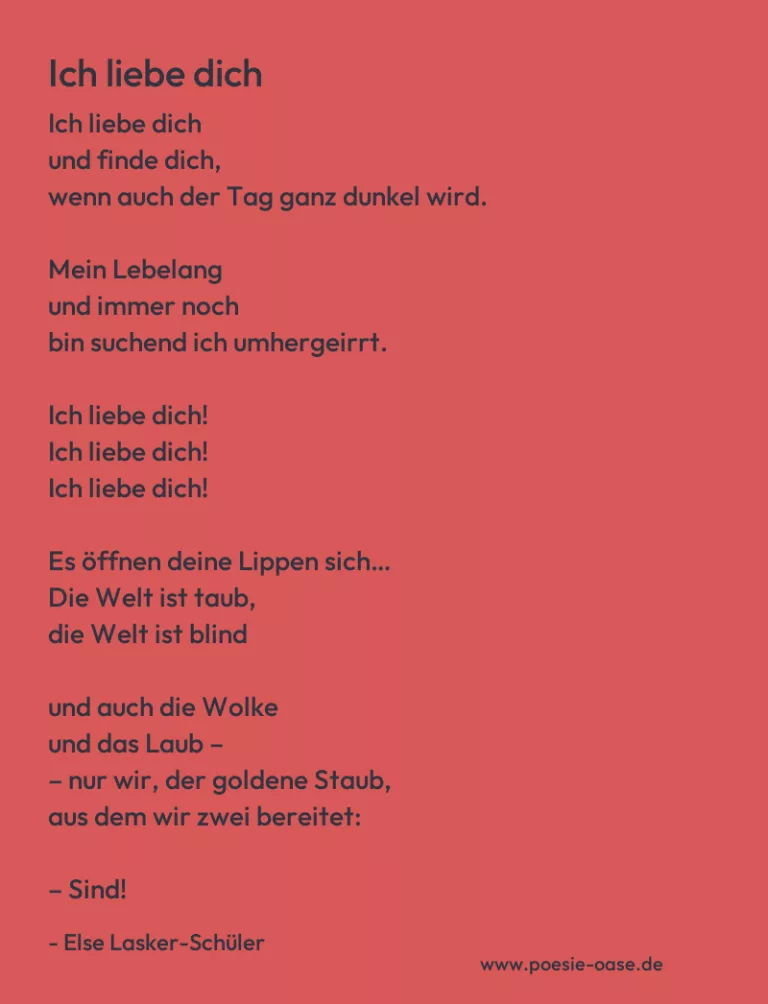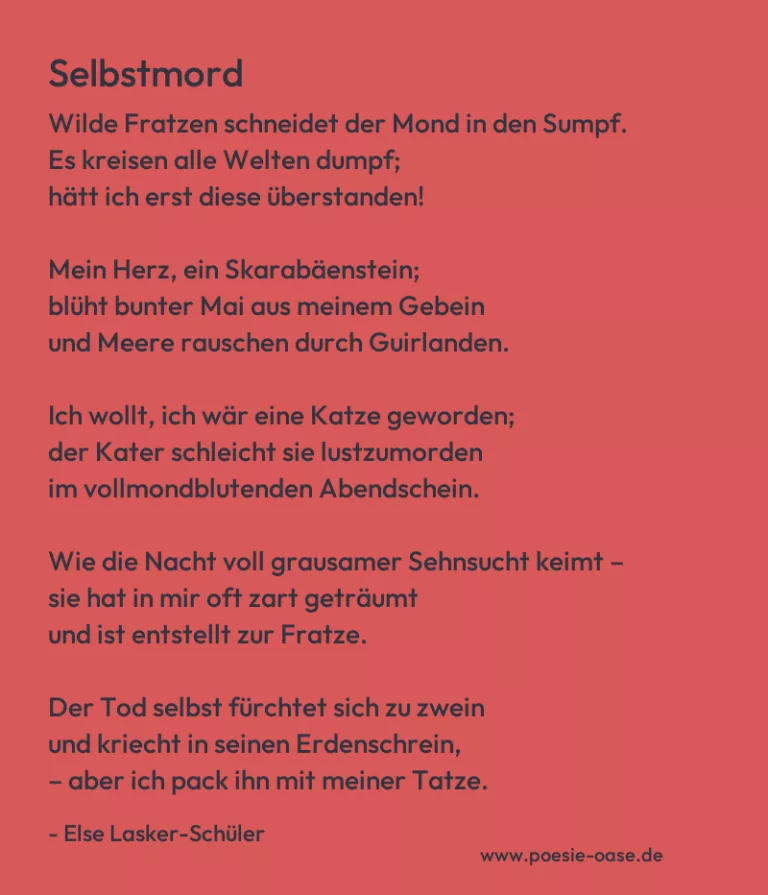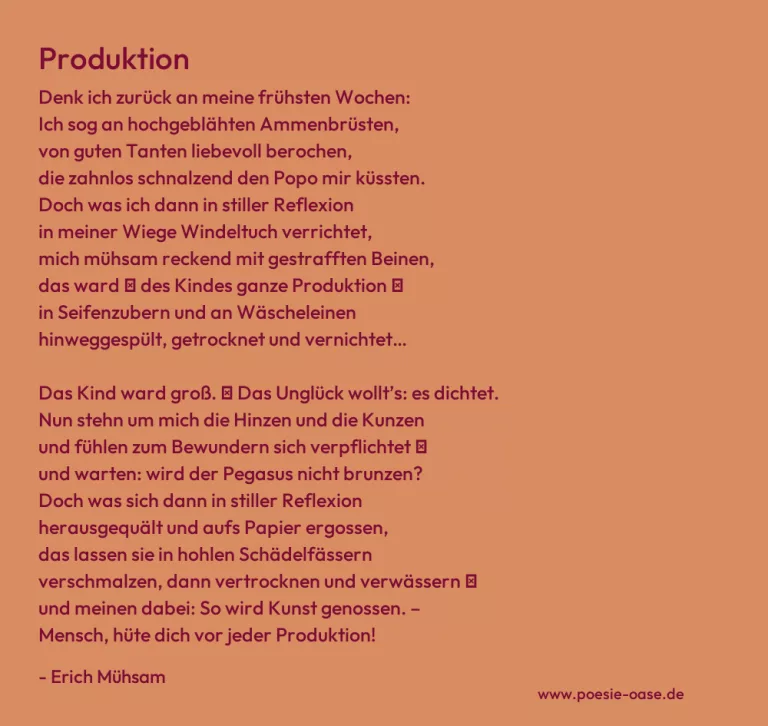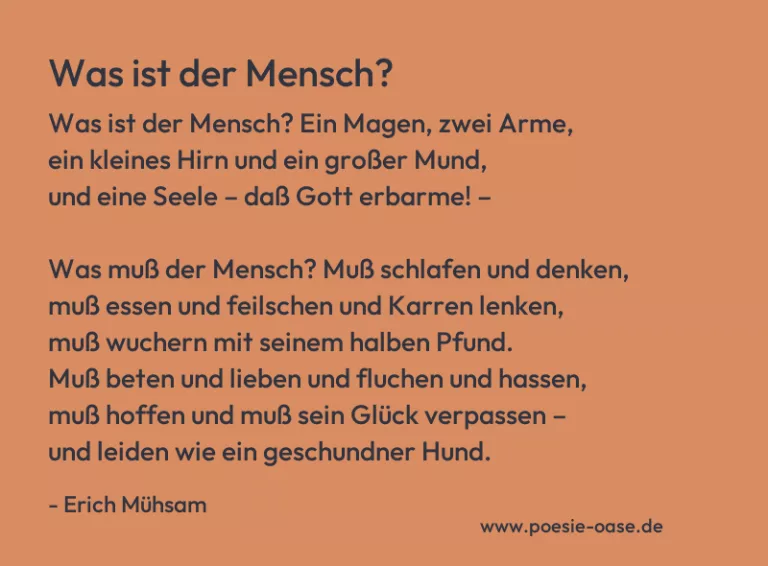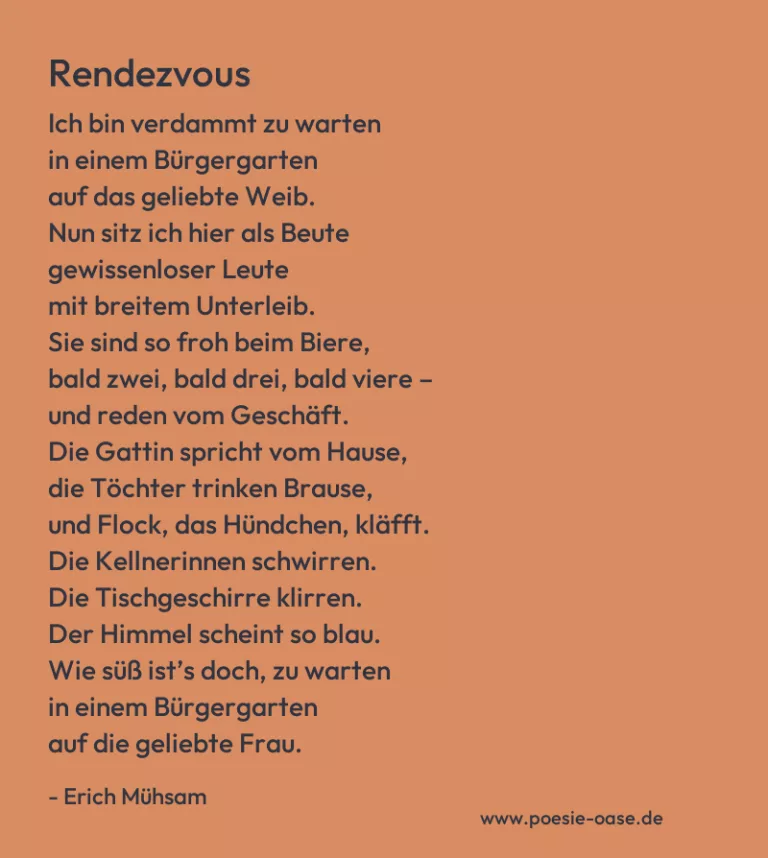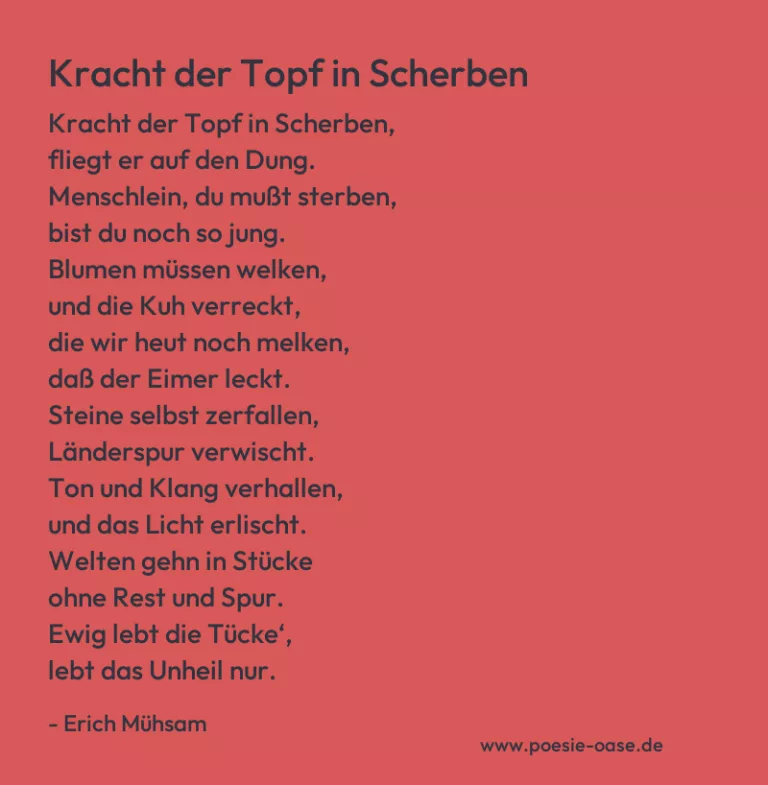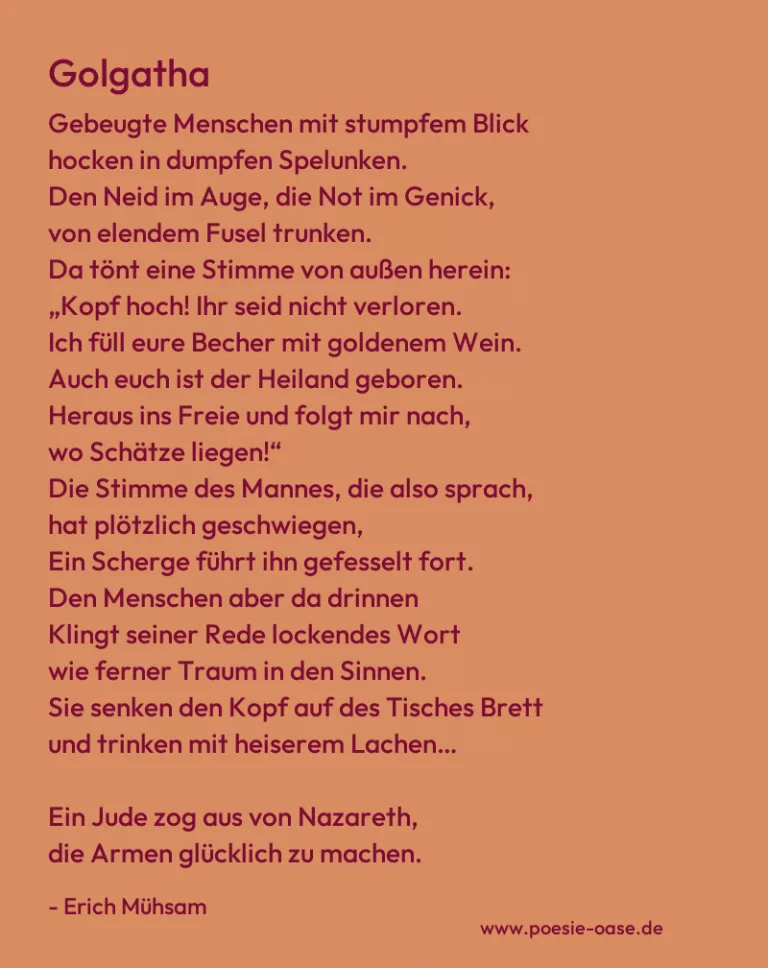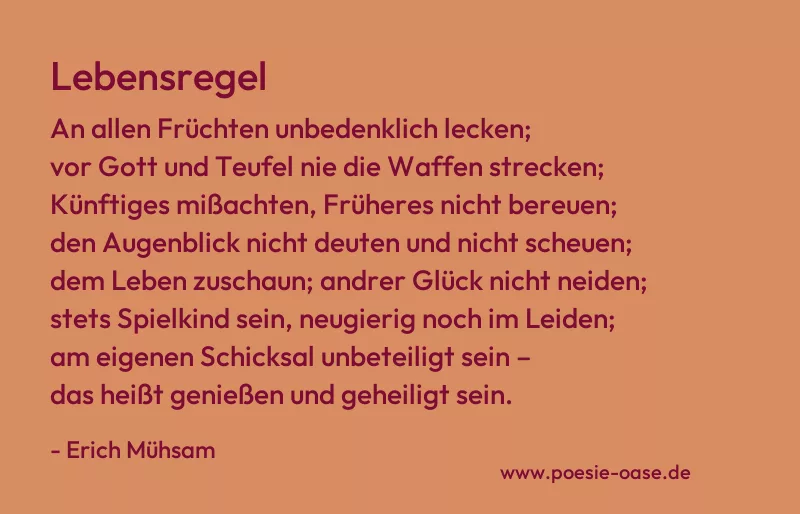Lebensregel
An allen Früchten unbedenklich lecken;
vor Gott und Teufel nie die Waffen strecken;
Künftiges mißachten, Früheres nicht bereuen;
den Augenblick nicht deuten und nicht scheuen;
dem Leben zuschaun; andrer Glück nicht neiden;
stets Spielkind sein, neugierig noch im Leiden;
am eigenen Schicksal unbeteiligt sein –
das heißt genießen und geheiligt sein.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
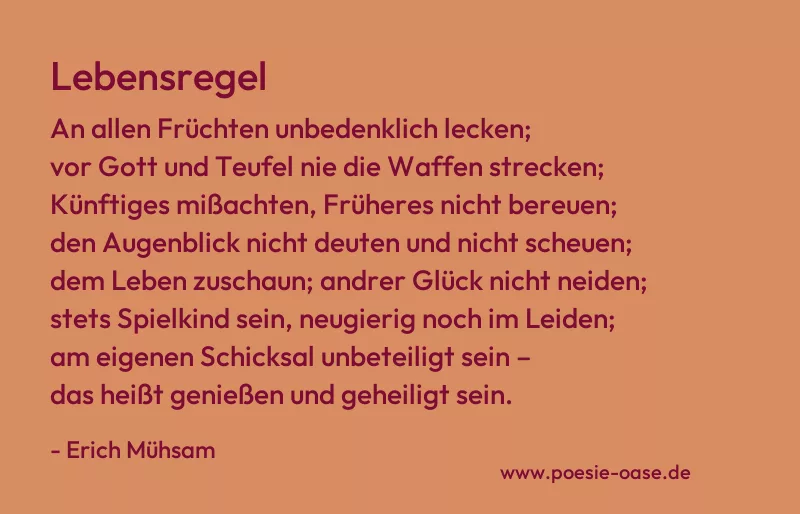
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Lebensregel“ von Erich Mühsam ist eine konzentrierte poetische Maxime, die in knapper, aphoristischer Form eine Haltung der Freiheit, Unabhängigkeit und inneren Distanz zum Leben formuliert. In zehn Versen legt Mühsam eine Art persönliches Manifest vor, das sich gegen Konvention, Moralismus und Existenzangst richtet – und stattdessen für ein bewusstes, spielerisches und zugleich stoisches Dasein plädiert.
Der Text beginnt mit dem Bild des „leckens an allen Früchten“, was sinnbildlich für eine uneingeschränkte Neugier und Genussfähigkeit steht. Moralische Begrenzungen – „vor Gott und Teufel nie die Waffen strecken“ – sollen ebenso abgelehnt werden wie zeitliche Einengungen durch Vergangenheit oder Zukunft. Mühsam empfiehlt, den Augenblick weder zu analysieren noch zu fürchten, sondern ihn einfach hinzunehmen und zu beobachten.
Dabei betont das Gedicht eine passive, fast meditative Lebenshaltung: „dem Leben zuschaun“ statt es zu kontrollieren. Neid auf das Glück anderer und übermäßige Selbstbezüglichkeit werden als Hindernisse zur Gelassenheit erkannt. Stattdessen wird das Ideal des „Spielkinds“ beschworen – jemand, der offen, neugierig, ja sogar im Leiden experimentierfreudig bleibt.
Der letzte Vers fasst das Programm pointiert zusammen: Wer sich nicht vom eigenen Schicksal gefangen nehmen lässt, sondern ihm mit Gleichmut begegnet, kann wirklich genießen – und erreicht damit eine fast spirituelle Form der Heiligkeit. Mühsams „Lebensregel“ steht somit im Spannungsfeld von Anarchismus, Individualismus und philosophischem Hedonismus – ein Gedicht, das zur inneren Freiheit aufruft, ohne pathetisch zu sein.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.