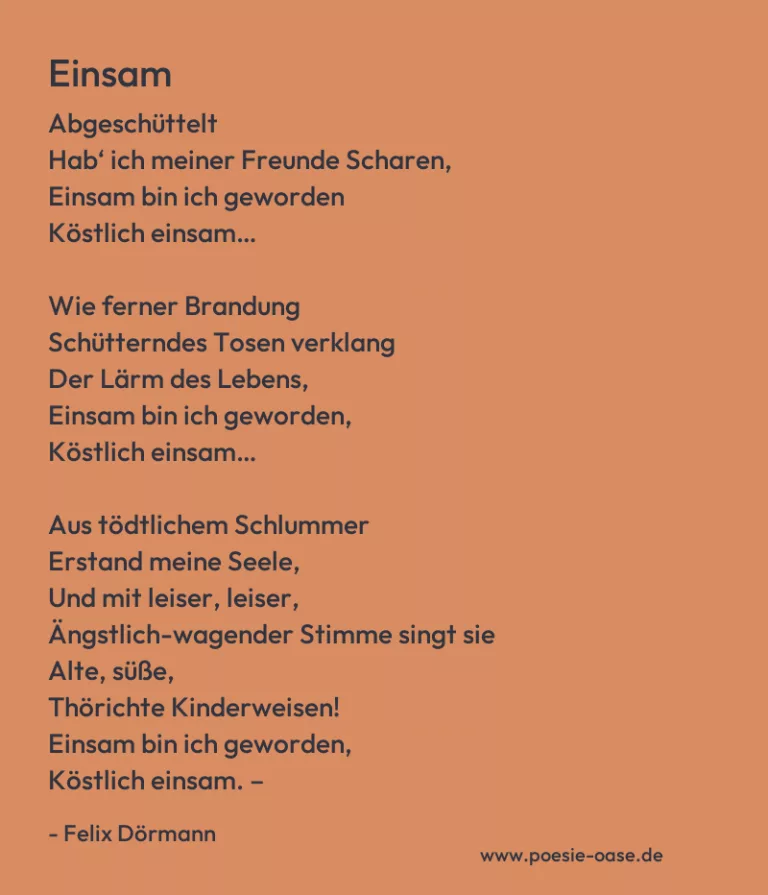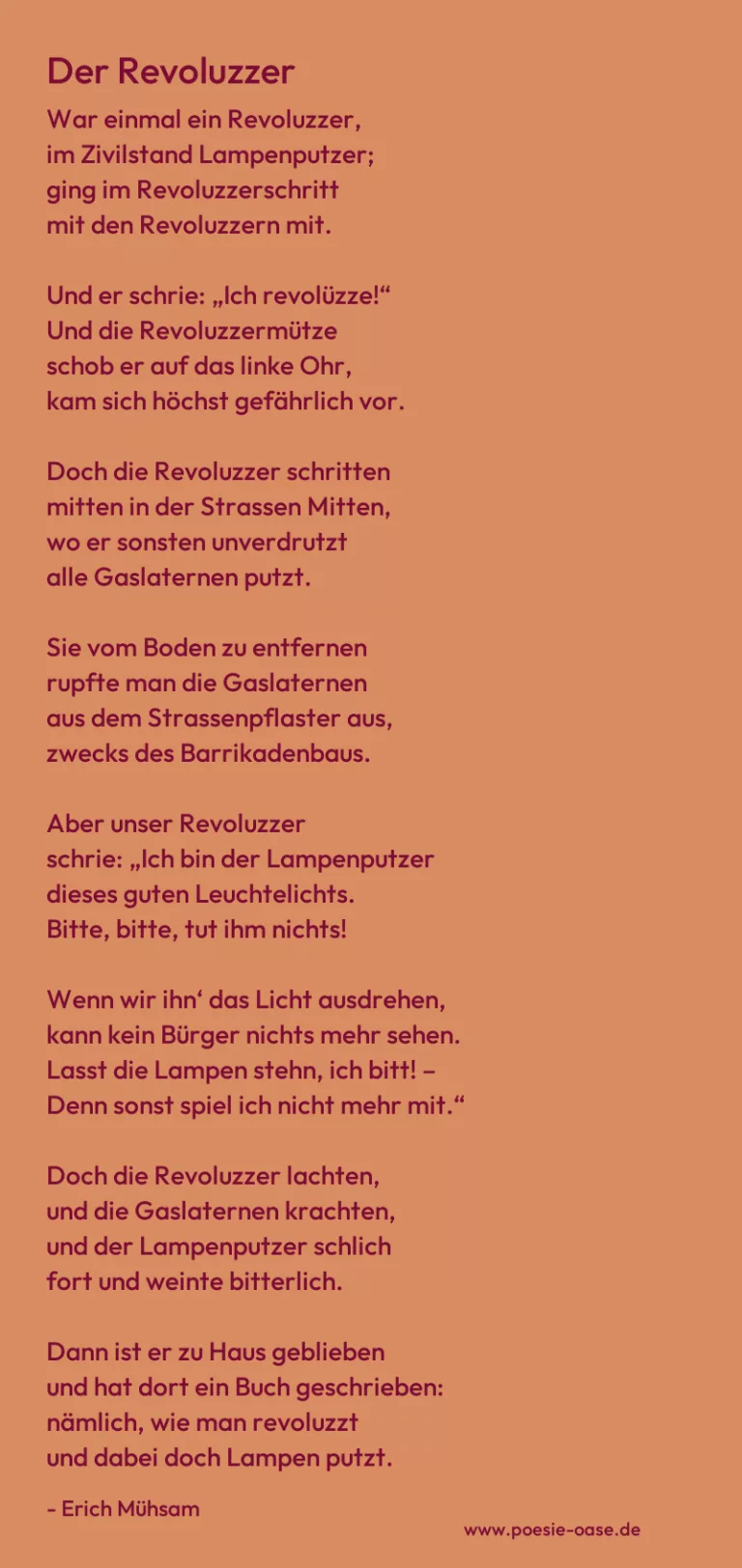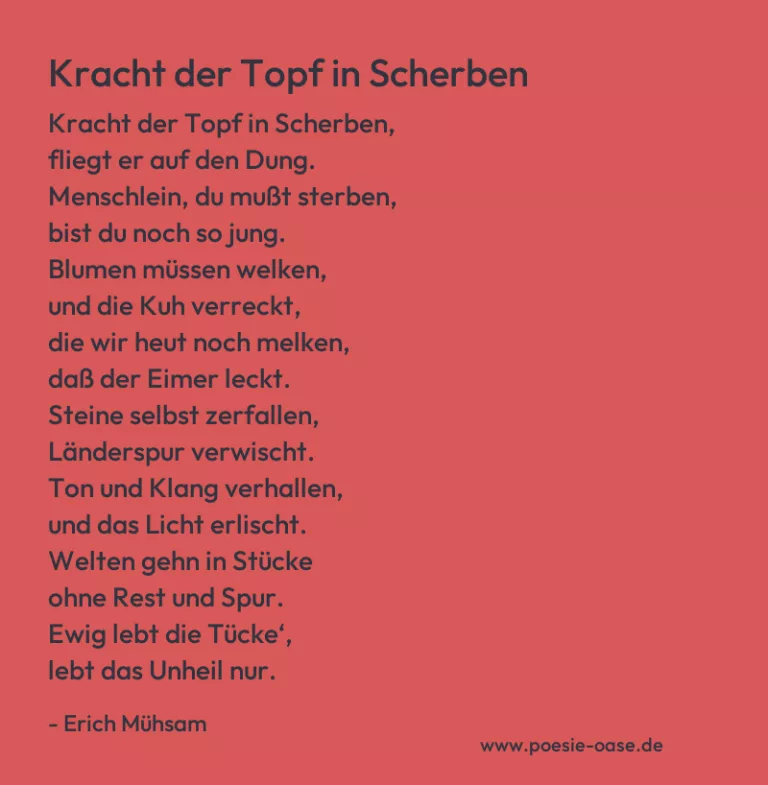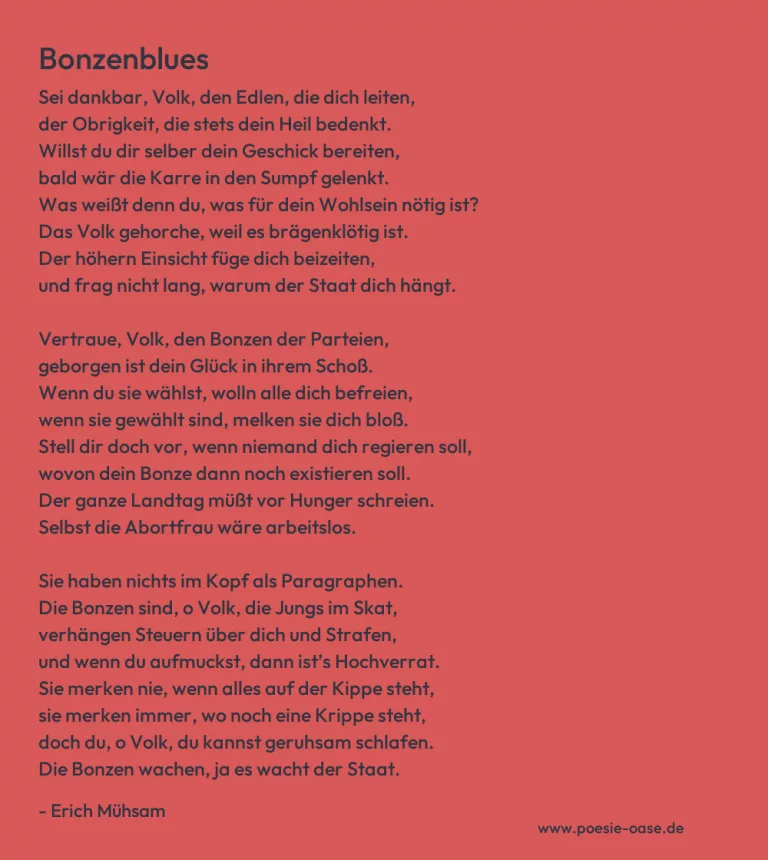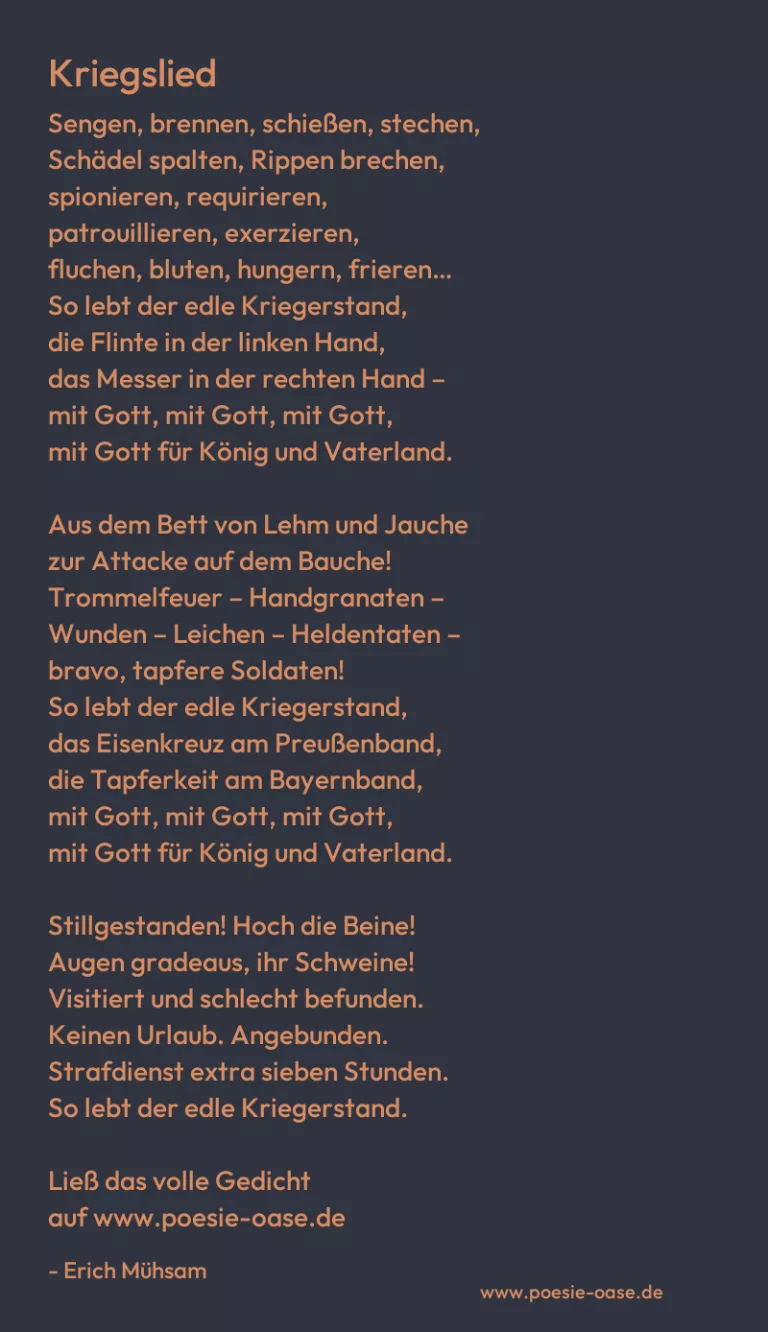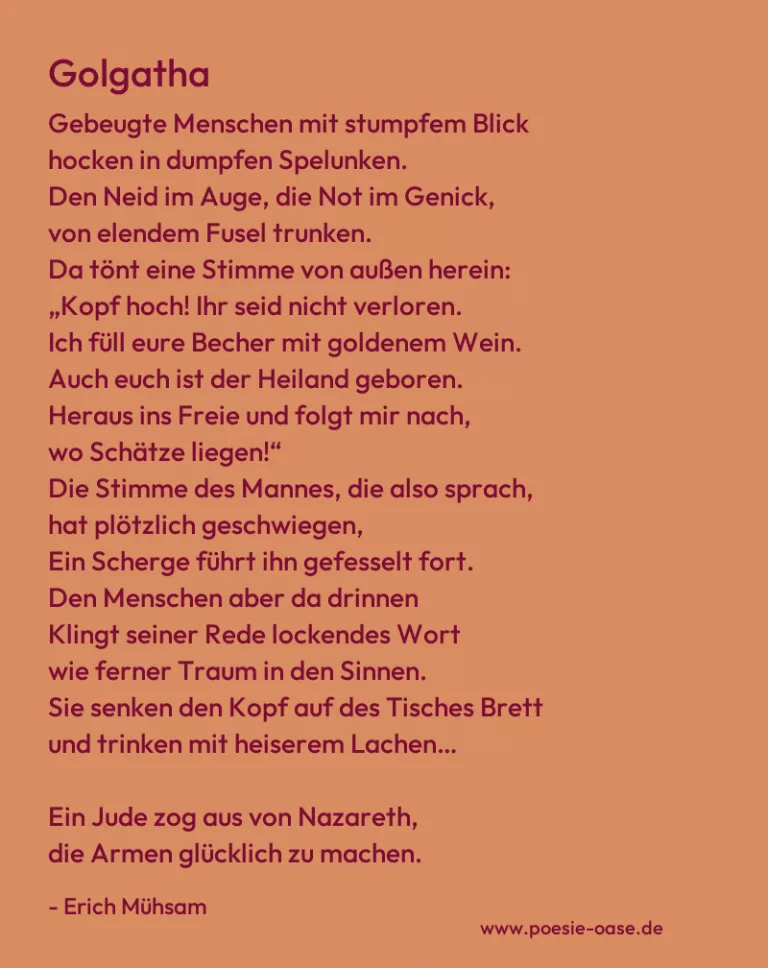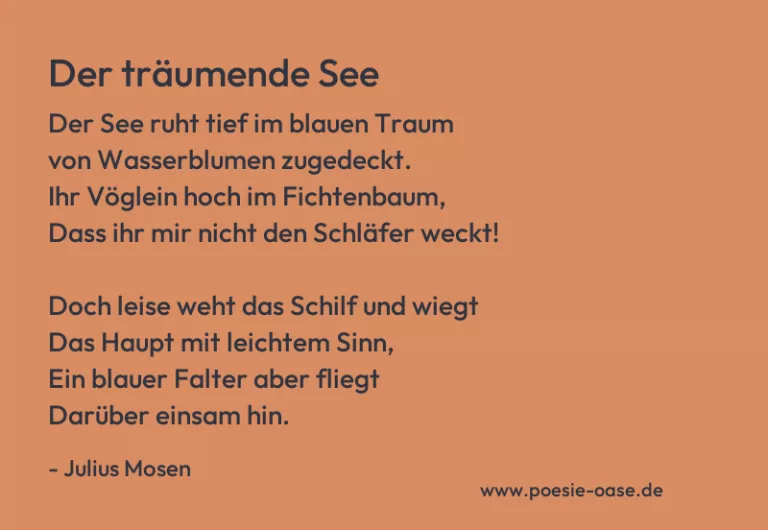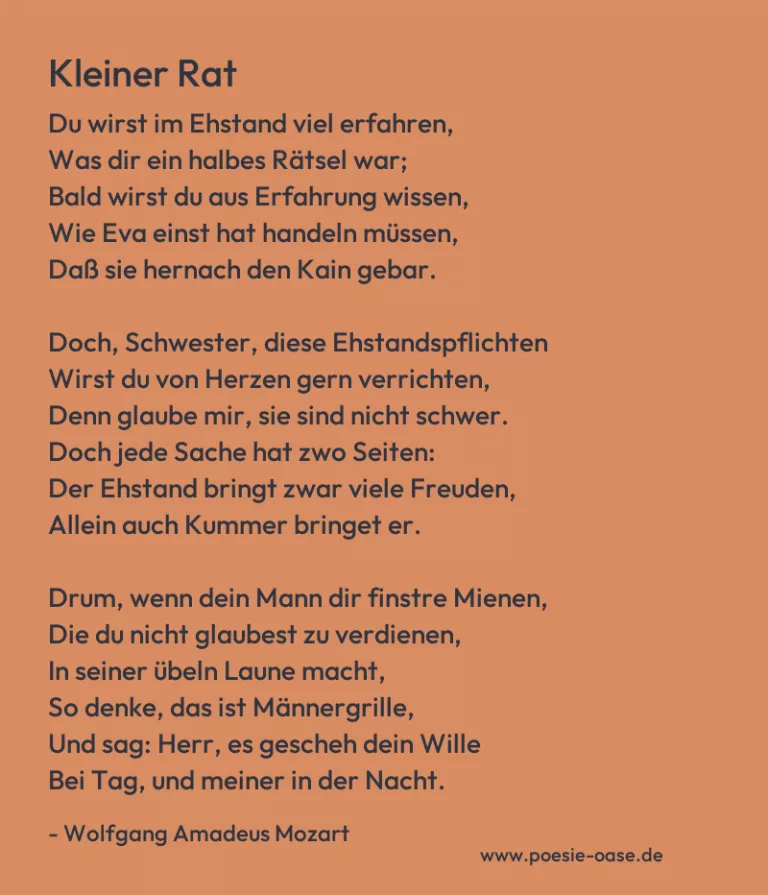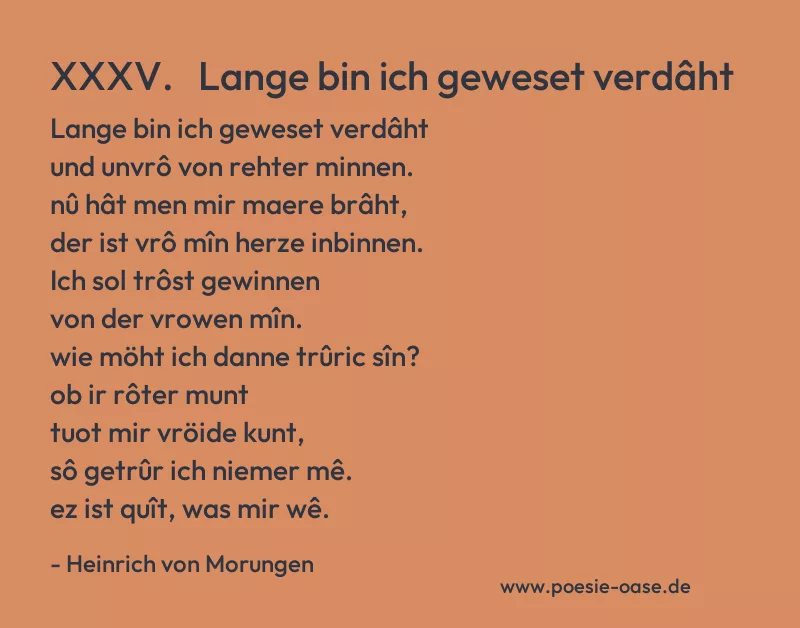XXXV. Lange bin ich geweset verdâht
Lange bin ich geweset verdâht
und unvrô von rehter minnen.
nû hât men mir maere brâht,
der ist vrô mîn herze inbinnen.
Ich sol trôst gewinnen
von der vrowen mîn.
wie möht ich danne trûric sîn?
ob ir rôter munt
tuot mir vröide kunt,
sô getrûr ich niemer mê.
ez ist quît, was mir wê.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
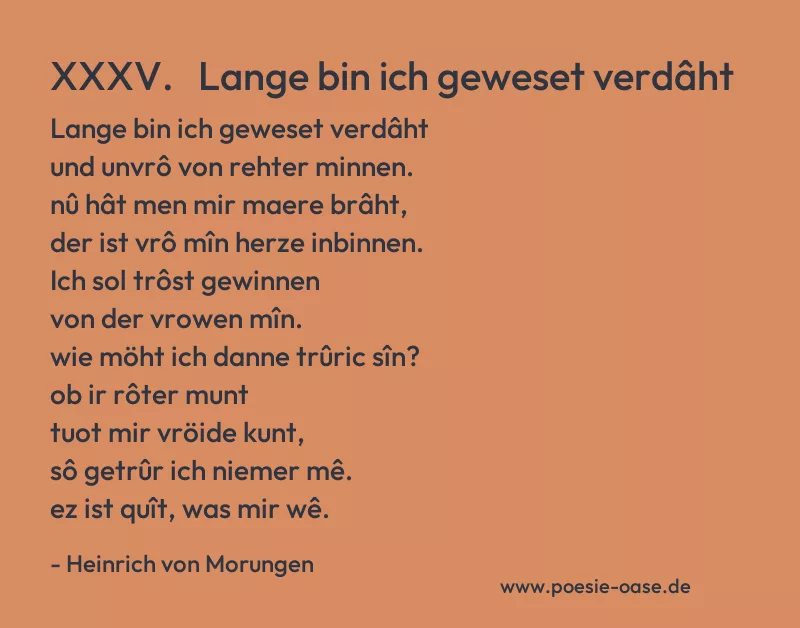
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Lange bin ich geweset verdâht“ von Heinrich von Morungen behandelt das Thema der Erlösung von Zweifeln und der Wiedererlangung von Liebe und Freude. Zu Beginn des Gedichts beschreibt der Sprecher, dass er lange Zeit von Verdacht und Misstrauen geplagt wurde, was zu einer tiefen Unzufriedenheit und einem Mangel an echter Liebe führte. Die Worte „und unvrô von rehter minnen“ deuten auf eine Entfremdung und ein Fehlen von wahrer Zuneigung hin, was den Sprecher in eine traurige und trostlose Lage versetzt hat.
Die Wende kommt mit der Nachricht, die ihm überbracht wird: Es gibt „maere“ (Neuigkeiten), die sein Herz erheitern und ihm Hoffnung bringen. Diese Nachricht bringt die „vrô“ (Freude) zurück, die sein Innerstes erleuchtet. Der Sprecher hofft nun, Trost und Heilung in der Liebe der „vrowen“ (Frau) zu finden. Die Frage „wie möht ich danne trûric sîn?“ verweist auf die Möglichkeit, dass Liebe und Zuneigung ihm helfen können, seinen Kummer und die Zweifel hinter sich zu lassen. Die Vorstellung, dass ihre „rôter munt“ (roter Mund) ihm Freude bereitet, ist ein Symbol für die Schönheit und Verheißung der Liebe, die dem Sprecher neue Lebensenergie schenkt.
Im letzten Abschnitt des Gedichts stellt der Sprecher fest, dass die Freude der Liebe die Traurigkeit vertreibt und ihm neues Vertrauen gibt. Das „getrûr ich niemer mê“ deutet darauf hin, dass das Vertrauen, das er nun in die Liebe setzt, ihn nicht wieder enttäuschen wird. Das Gedicht endet mit der Bemerkung, dass der Schmerz (das „wê“) nun vollständig beseitigt ist – die Liebe hat den Verdacht und das Leid verdrängt und eine tiefere, beruhigende Harmonie im Herzen des Sprechers hergestellt.
Heinrich von Morungen beschreibt in diesem Gedicht die transformative Kraft der Liebe, die von einer anfänglichen Enttäuschung und Verdächtigung hin zu einem Zustand der Freude und des Vertrauens führt. Die Erneuerung des Vertrauens in die Liebe wird als eine heilende und befreiende Erfahrung dargestellt, die den Sprecher von seinen inneren Qualen befreit und ihm eine neue Perspektive auf das Leben gibt. Die bildhafte Sprache und die emotionalen Ausdrücke vermitteln die tiefe Sehnsucht nach Erlösung und die Freude an der Verwandlung durch die Liebe.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.